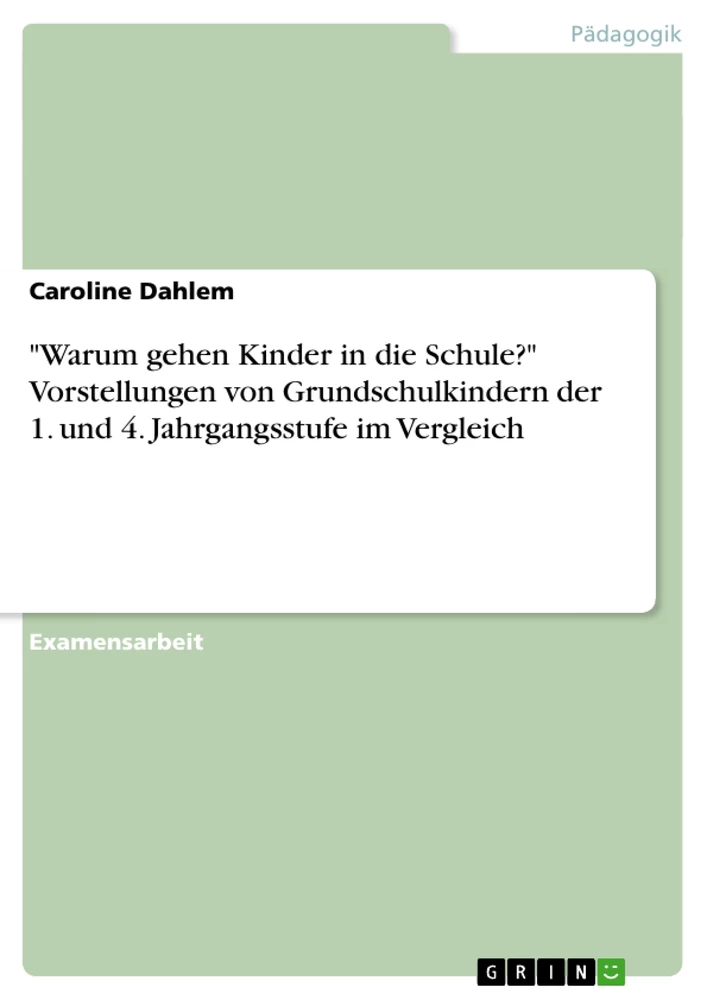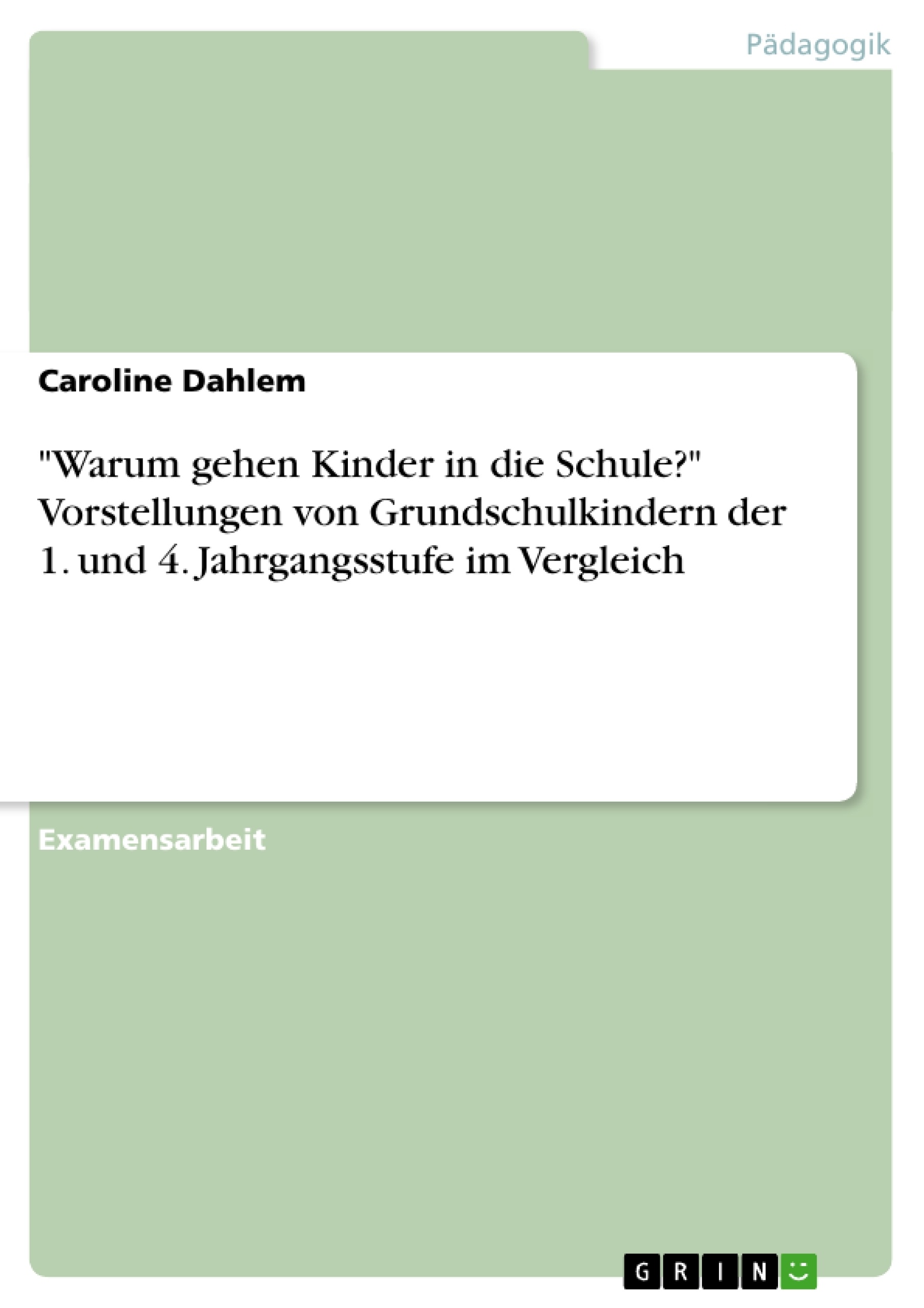Bereits vor dem ersten Schultag haben Kinder schon ganz konkrete Vorstellungen von Schule. Die meisten begegnen diesem Tag mit großer Erwartungshaltung. Sie wollen möglichst schnell Schreiben, Lesen und Rechnen lernen, um endlich intensiv an der Kultur der Erwachsenen teilnehmen zu können. Doch der Eintritt in die Schule ist auch mit großen Veränderungen für die Kinder verbunden. Nicht nur die Struktur der Zeit ist anders als im Kindergarten und zu Hause, auch der Raum und seine Möglichkeiten ändern sich. Die Veränderungen in den sozialen Beziehungen belasten die Kinder zusätzlich. Sie müssen sich nicht nur von den Eltern ablösen, sondern werden zusätzlich auch mit unbekannten Mitschüler und Lehrern konfrontiert. Die Begegnung mit diesem komplexen, anfangs auch verwirrenden neuen Lebensraum prägt nachhaltig das Bild, das die Kinder von Schule und schulischem Lernen gewinnen. Aber mit dem Eintritt in die Schule ist dieses Bild keinesfalls vollständig, denn die Vorstellungen der Kinder entwickeln sich permanent aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie im Laufe ihrer Schulzeit sammeln, weiter. Aus ihnen gehen Einstellungen, Erwartungen, Wünsche und Idealbilder hervor. Mit jedem Schultag kann es zu einer Modifikation dieses subjektiven Bildes kommen. Mögliche Gründe könnten u.a. Veränderungen in den sozialen Beziehungen zu Mitschülern, Lehrern etc. sein sowie positive oder negative Erlebnisse, Erfolge und Misserfolge aber auch Überforderungen und Unterforderungen der Schüler. Obwohl diese Veränderungen im Laufe der Jahre viel über die Qualität von Schule aussagen können, wurden sie bisher in der Forschung – vor allem für die Grundschule – jedoch kaum berücksichtigt.
Gerade diese Tatsache bot den Anlass, sich näher mit dem subjektiven Bild der Schüler zu beschäftigen. Sie sind es schließlich, für die Schule und Unterricht stattfindet und um die Gestaltung von Schule verbessern zu können, ist es dringend notwendig, gerade ihre Stimmen zu hören.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Untersuchungsanlass und Zielsetzung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Begriffsklärungen
- 2.1.1 Vorstellung
- 2.1.2 Einstellung
- 2.1.3 Erwartungen
- 2.1.4 Wunsch und Ideal
- 2.2 Grundlegende gesellschaftliche Aufgaben von Schule
- 2.3 Bedeutung des Lernens allgemein
- 2.3.1 Lernen vor und außerhalb der Schule
- 2.3.2 Lernen innerhalb der Schule
- 2.3.3 Förderungsmöglichkeiten schulischen Lernens
- 2.4 Bedeutung der Schule für Schüler
- 2.5 Relevanz der subjektiven Sicht von Schülern
- 2.1 Begriffsklärungen
- 3 Untersuchung
- 3.1 Untersuchungskonzept
- 3.1.1 Methodenwahl - Interview
- 3.1.2 Besonderheiten dieser Methode
- 3.1.3 Interview und Gütekriterien
- 3.2 Planung
- 3.2.1 Entwicklung des Interviewleitfadens
- 3.2.2 Auswahl der Schüler
- 3.3 Durchführung und Ablauf
- 3.4 Ergebnisse der einzelnen Interviewfragen
- 3.1 Untersuchungskonzept
- 4 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse
- 5 Zusammenfassung und Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die subjektiven Vorstellungen von Grundschulkindern der 1. und 4. Jahrgangsstufe bezüglich des Schulbesuchs. Ziel ist es, einen Einblick in die individuellen Perspektiven der Kinder zu gewinnen und diese im Vergleich zu analysieren. Die Studie nutzt qualitative Methoden, um die komplexen und vielschichtigen Ansichten der Schüler zu erfassen.
- Individuelle Vorstellungen von Grundschulkindern zum Schulbesuch
- Vergleich der Perspektiven zwischen Erst- und Viertklässlern
- Bedeutung von Lernen innerhalb und außerhalb der Schule aus Kindersicht
- Wünsche und Erwartungen der Kinder an die Schule und den Unterricht
- Analyse der subjektiven Sicht der Schüler auf die Rolle der Schule in der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1 Untersuchungsanlass und Zielsetzung: Dieses Kapitel erläutert den Ausgangspunkt der Untersuchung, nämlich das Interesse an den subjektiven Schülerperspektiven zum Schulbesuch, die im normalen Schulalltag oft verborgen bleiben. Es wird die Notwendigkeit der Erforschung dieser individuellen Sichtweisen betont und die Methodik der Studie, basierend auf Interviews, vorgestellt. Das Kapitel legt den Fokus auf die Notwendigkeit, die komplexen, individuellen Antworten der Kinder zu analysieren und zu vergleichen, um daraus fundierte Schlussfolgerungen zu ziehen.
2 Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Studie dar. Es werden zentrale Begriffe wie Vorstellung, Einstellung, Erwartung und Wunsch im Kontext von Schule und Lernen definiert und eingegrenzt. Weiterhin wird die gesellschaftliche Bedeutung von Schule sowie die Bedeutung des Lernens innerhalb und außerhalb der Schule aus pädagogischer Sicht beleuchtet. Besonderes Augenmerk liegt auf der Relevanz der subjektiven Schülerperspektive für das Verständnis von Bildungsprozessen. Die verschiedenen Unterkapitel dienen der präzisen Definition der zentralen Begriffe und bieten einen theoretischen Rahmen für die Auswertung der empirischen Daten.
3 Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt detailliert den Ablauf der empirischen Untersuchung. Es wird die gewählte Methode (Interviews) begründet und deren Stärken und Schwächen im Hinblick auf die Forschungsfrage diskutiert. Die Planung der Studie, einschließlich der Entwicklung des Interviewleitfadens und der Auswahl der teilnehmenden Schüler, wird transparent dargestellt. Der Kapitelteil zur Durchführung und zum Ablauf gibt Einblick in die praktische Umsetzung der Interviews. Die Ergebnisse der einzelnen Interviewfragen werden lediglich in der Einleitung erwähnt, eine detaillierte Analyse erfolgt in den weiteren Kapiteln. Der Fokus liegt auf der methodischen Vorgehensweise und der Gewährleistung der methodischen Gütekriterien.
Schlüsselwörter
Grundschule, Schülerperspektiven, Interview, qualitative Forschung, Lernen, Schule, Erwartungen, Vorstellungen, Einstellungen, Wünsche, Vergleich, Jahrgangsstufe.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Subjektive Vorstellungen von Grundschulkindern zum Schulbesuch
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Die Studie untersucht die subjektiven Vorstellungen von Grundschulkindern der 1. und 4. Jahrgangsstufe bezüglich des Schulbesuchs. Ziel ist es, einen Einblick in die individuellen Perspektiven der Kinder zu gewinnen und diese im Vergleich zu analysieren.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Studie verwendet qualitative Methoden, insbesondere Interviews, um die komplexen und vielschichtigen Ansichten der Schüler zu erfassen. Die Wahl des Interviews wird im Kapitel 3.1.1 begründet und im Hinblick auf Gütekriterien diskutiert.
Welche Themen werden in der Studie behandelt?
Die Studie befasst sich mit den individuellen Vorstellungen der Kinder zum Schulbesuch, vergleicht die Perspektiven von Erst- und Viertklässlern, untersucht die Bedeutung von Lernen innerhalb und außerhalb der Schule aus Kindersicht, analysiert die Wünsche und Erwartungen der Kinder an Schule und Unterricht und betrachtet die subjektive Sicht der Schüler auf die Rolle der Schule in der Gesellschaft.
Wie ist die Studie aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Untersuchungsanlass und Zielsetzung, 2. Theoretische Grundlagen (inkl. Begriffsklärungen zu Vorstellung, Einstellung, Erwartung, Wunsch und Ideal; gesellschaftliche Aufgaben von Schule; Bedeutung des Lernens; Relevanz der subjektiven Sicht von Schülern), 3. Untersuchung (inkl. Untersuchungskonzept, Planung, Durchführung und Ergebnisse), 4. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse und 5. Zusammenfassung und Schlussbemerkung. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis findet sich zu Beginn der Arbeit.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen dar. Es werden zentrale Begriffe wie Vorstellung, Einstellung, Erwartung und Wunsch im Kontext von Schule und Lernen definiert. Die gesellschaftliche Bedeutung von Schule und die Bedeutung des Lernens innerhalb und außerhalb der Schule werden aus pädagogischer Sicht beleuchtet. Die Relevanz der subjektiven Schülerperspektive für das Verständnis von Bildungsprozessen steht im Mittelpunkt.
Wie wurde die Untersuchung durchgeführt?
Kapitel 3 beschreibt detailliert den Ablauf der empirischen Untersuchung. Es wird die Methode (Interviews) begründet, die Planung (inkl. Entwicklung des Interviewleitfadens und Auswahl der Schüler) dargestellt und die Durchführung erläutert. Die Ergebnisse der einzelnen Interviewfragen werden im Kapitel 3.4 zusammengefasst; eine detaillierte Analyse folgt in den weiteren Kapiteln.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Schlüsselwörter sind: Grundschule, Schülerperspektiven, Interview, qualitative Forschung, Lernen, Schule, Erwartungen, Vorstellungen, Einstellungen, Wünsche, Vergleich, Jahrgangsstufe.
Für wen ist diese Studie relevant?
Diese Studie ist für alle relevant, die sich mit der subjektiven Perspektive von Grundschulkindern auf den Schulbesuch auseinandersetzen, z.B. Pädagogen, Bildungsforscher und Personen im Bereich der Schulentwicklung.
Wo finde ich detaillierte Ergebnisse?
Detaillierte Ergebnisse der einzelnen Interviewfragen sowie deren Interpretation und Diskussion finden sich in Kapitel 4 der vollständigen Studie.
- Quote paper
- Caroline Dahlem (Author), 2007, "Warum gehen Kinder in die Schule?" Vorstellungen von Grundschulkindern der 1. und 4. Jahrgangsstufe im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84917