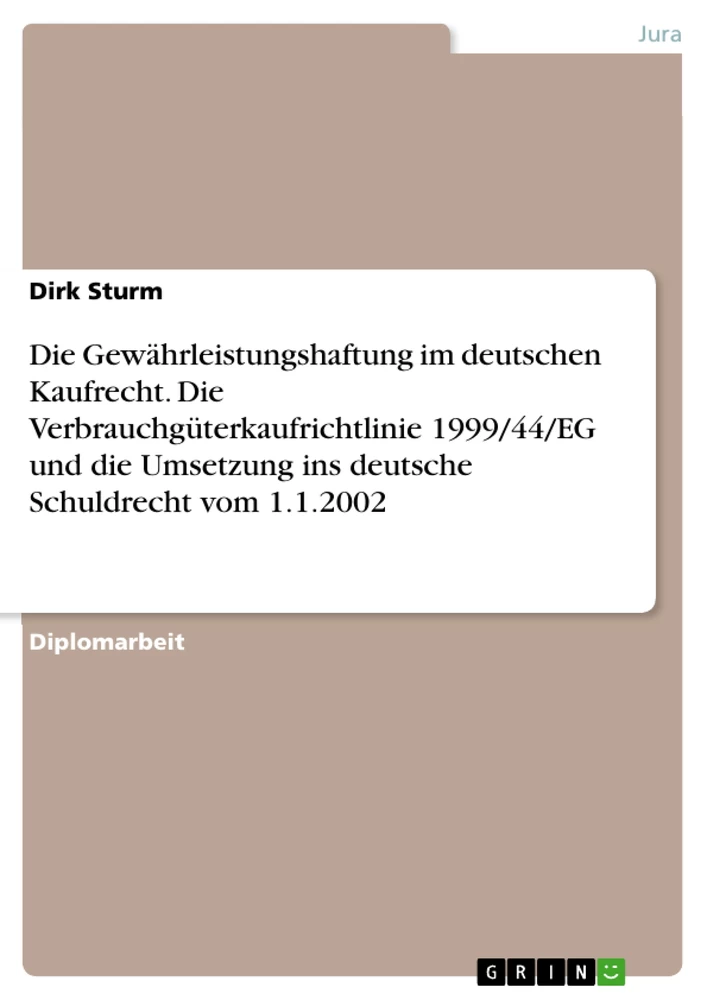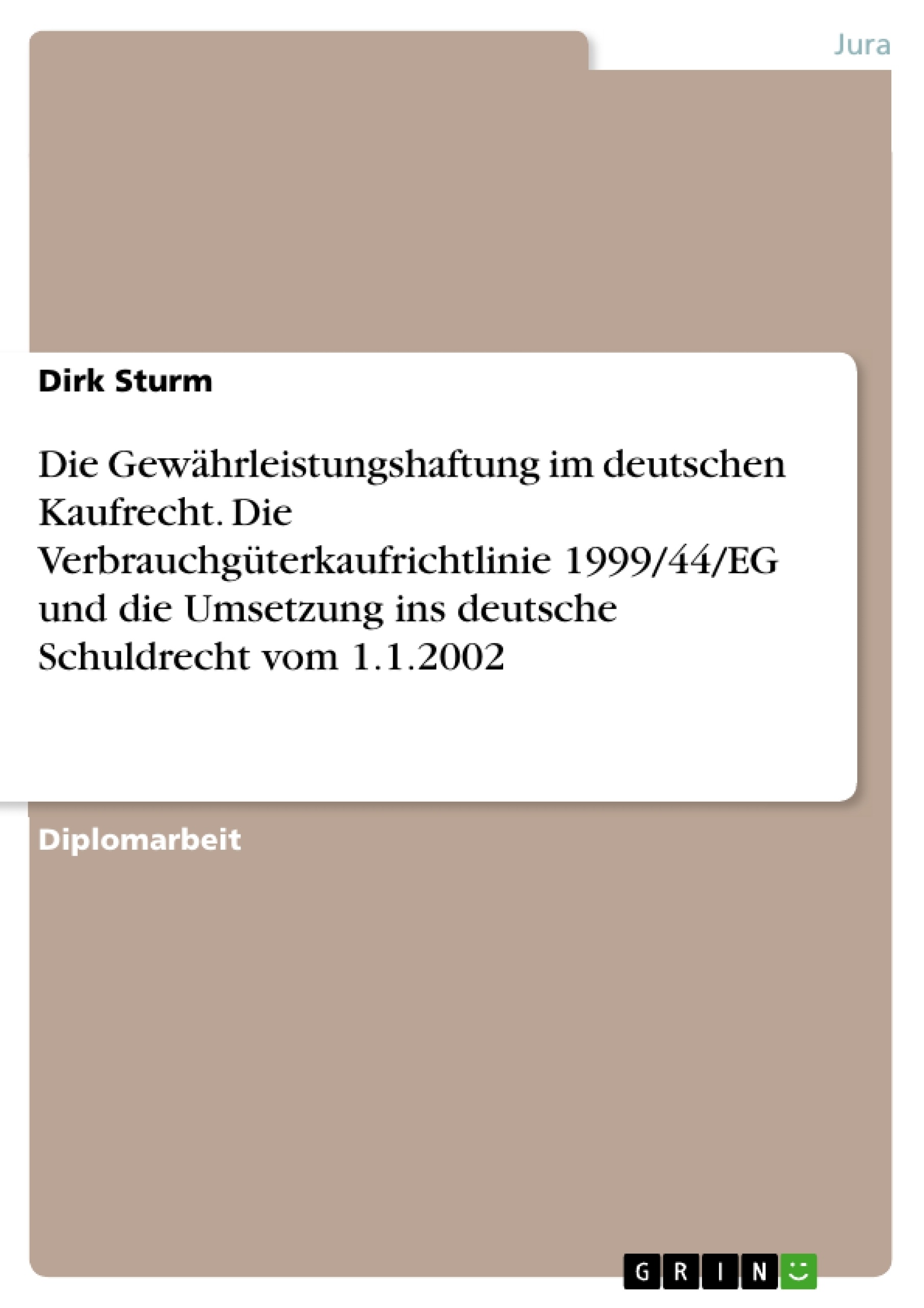Zeitlich weit voraus war es damals Ernst Rabel der mit seinen Vorarbeiten, beginnend 1928 erstmalig, die Grundlage für ein vereinheitlichtes Kaufrecht über den internationalen Kauf von beweglichen Sachen (EKG) und den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen (EAG) schaffte.
„Es gilt, eine Bresche zu schlagen für die Vereinheitlichung des Schuldrechts, für die Annäherung der Rechtssysteme, wo kein sachlicher Grund es rechtfertigt, dasselbe Problem verschiedenen Lösungen zuzuführen.“
Allerdings erlangten die Haager Kaufgesetzte kaum praktische Bedeutung, was wohl unter anderem daran lag, dass von den 28 teilnehmenden Staaten, die die Schlussakte unterzeichneten, nur neun Staaten das Abkommen wirklich ratifizierten. Für die Bundesrepublik traten die Kaufgesetze EKG und EAG am 16.04.1974 in Kraft. Auch erlangten sie ihre eigentliche Bedeutung nicht in einer erfolgreichen Kaufrechtsvereinheitlichung, sondern vielmehr darin, dass sie die Grundlage und der Ausgangspunkt für die Entwicklung eines neuen einheitlichen Kaufrechts wurden. Die Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht UNCITRAL unternahm dabei die ersten Schritte für eine internationale Kaufrechtsvereinheitlichung. Im Ergebnis dieser und weiterer Bemühungen wurde dann am 11.04.1980 das wichtige einheitliche Wiener UN-Kaufrecht (CISG) beschlossen. Es vereinheitlicht die materiellen Kaufrechte und löst damit das Haager Einheitskaufrecht ab.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Hintergrund
- 2. Gegenstand, Vorgehen und Ziel der Untersuchung
- 3. Gang der Untersuchung
- II. Kaufvertrag
- III. Pflichten des Verkäufers
- 1. Übergabe und Eigentumsverschaffung, Rechtsverschaffung
- 2. Sachmängelfreiheit als Gegenstand der Leistungspflicht
- 3. Rechtsmängelfreiheit
- 4. Nebenpflichten des Verkäufers
- IV. Pflichten des Käufers
- 1. Zahlungs- und Abnahmepflicht
- 2. Sicherung des Verkäufers durch Eigentumsvorbehalt
- V. Leistungsort
- 1. Holschuld
- 2. Bringschuld
- 3. Schickschuld
- VI. Gefahrtragung beim Kauf
- 1. Übergabe
- 2. Verbrauchsgüterkauf
- VII. Pflicht zur Lieferung mangelfreier Ware
- 1. Definition der Sachmängel
- 1.1 Subjektiver Fehlerbegriff, Arten von Sachmängeln
- 1.1.1 Vereinbarte Beschaffenheit
- 1.1.2 Vertraglich vorausgesetzte Verwendung
- 1.2 Objektiver Fehlerbegriff
- 1.2.1 Maßgeblichkeit der Verkehrserwartung / Gewöhnliche Verwendung
- 1.2.2 Öffentliche Äußerungen in Werbung
- 1.3 Fehlerhafte Montage
- 1.4 Aluid-Lieferung / Zuweniglieferung (Mankolieferung)
- 1.5 Bagatellgrenze
- 2. Maßgeblicher Zeitpunkt für Mangelfreiheit
- 3. Beweislast
- VIII. Rangfolge der Käuferrechte
- IX. Sachliche Schranken der Käuferrechte
- 1. Kenntnis und Unkenntnis eines Sachmangels
- 2. Vertragliche Schranken
- 3. Der beidseitige Handelskauf
- 3.1 Obliegenheiten des Käufers zur Untersuchung der Ware
- 3.2 Obliegenheit des Käufers zur Rüge des Sachmangels
- 3.3 Rechtsfolgen bei nicht ordnungsgemäßer oder unterbliebener Rüge
- 3.4 Rechtsfolgen bei ordnungsgemäßer Rüge
- 3.5 Regress beim Verbrauchsgüterkauf
- X. Zeitliche Schranken der Käuferrechte
- 1. Fristen und Fristbeginn der Verjährung
- 2. Gegenstand der Verjährung
- 2.1 Nacherfüllungsanspruch und Schadenersatzanspruch
- 2.2 Rücktritt und Minderung
- 3. Hemmung und Neubeginn der Verjährung
- 4. Erhaltung der Mängeleinrede
- 5. Verjährungsmodifikationen beim Regressanspruch
- XI. Die einzelnen Käuferrechte, die Wahl, Art und Weise
- 1. Mängeleinrede
- 1.1 Einrede des nicht erfüllten Vertrags (behebbarer Mangel)
- 1.2 Rücktritts- oder Minderungseinrede (unbehebbarer Mangel)
- 2. Anspruch auf Nacherfüllung, Recht zur zweiten Andienung
- 2.1 Vorrang der Nacherfüllung
- 2.2 Modalitäten der Nacherfüllung
- 2.3 Kosten
- 2.4 Verweigerungsrecht des Verkäufers
- 2.5 Fehlschlagen der Nachlieferung
- 2.6 Unzumutbarkeit der Nacherfüllung
- 2.7 Echte und unechte Unmöglichkeit der Nacherfüllung: „Qualitative Unmöglichkeit“
- 3. Gestaltungsrecht Rücktritt
- 3.1 Voraussetzung des Rücktritt
- 3.1.1 Nicht vertragsgemäße Erbringung einer fälligen Leistung
- 3.1.2 Erfolgloser Ablauf einer Nacherfüllungsfrist
- 3.1.3 Ausnahmen vom Fristsetzungserfordernis
- 3.2 Ausübung des Rücktrittsrechts, Fristsetzung und ius variandi
- 3.3 Folgen des Rücktritts
- 4. Gestaltungsrecht Minderung
- 4.1 Ankopplung an das Rücktrittsrecht
- 4.2 Berechnung der Minderung
- 4.3 Ausübung der Minderung
- 4.4 Folgen der Minderung
- 5. Auf Geldausgleich gerichtete Ansprüche, Schadenersatz bzw. Aufwendungsersatz
- 5.1 Haftung für Sachmängel
- 5.1.1 Anfängliche unbehebbare Sachmängel
- 5.1.2 Nachträgliche unbehebbare Sachmängel
- 5.1.3 Behebbare Sachmängel
- 5.2 Haftung für das Fehlen von zugesicherten Beschaffenheiten
- 5.3 Inhalt des Schadenersatzanspruchs „statt der mangelfreien Leistung“
- 5.3.1 Umfang, Mangelfolgeschäden
- 5.3.2 Großer Schadenersatz
- 5.3.3 Kleiner Schadenersatz
- 5.3.4 Verhältnis zum Rücktrittsrecht
- 5.4 Aufwendungsersatz
- 5.5 Schicksal des Anspruchs auf mangelfreie Leistung, ius variandi
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gewährleistungshaftung im deutschen Kaufrecht. Ziel ist es, die Rechte des Käufers bei Mängeln der Kaufsache umfassend darzustellen und zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet dabei die verschiedenen Käuferrechte, deren Voraussetzungen und die jeweiligen Rechtsfolgen.
- Rechte des Käufers bei Sachmängeln
- Voraussetzungen und Rechtsfolgen der einzelnen Käuferrechte (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung, Schadenersatz)
- Zeitliche und sachliche Schranken der Käuferrechte
- Unterschiede zwischen Verbrauchsgüterkauf und Handelskauf
- Bedeutung der Beweislastverteilung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Gewährleistungshaftung im deutschen Kaufrecht ein, beschreibt den Gegenstand der Untersuchung und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie legt den Fokus auf die umfassende Analyse der Käuferrechte bei mangelhafter Ware.
II. Kaufvertrag: Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Elemente eines Kaufvertrages und dient als Grundlage für die folgenden Kapitel, die sich mit den Rechten und Pflichten der Vertragspartner befassen. Es wird auf die essentielle Bedeutung eines wirksamen Kaufvertrages als Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen hingewiesen.
III. Pflichten des Verkäufers: Hier werden die Hauptpflichten des Verkäufers im Kaufvertrag detailliert erläutert. Im Fokus stehen die Pflicht zur Übergabe und Eigentumsverschaffung, die Gewährleistung der Sach- und Rechtsmängelfreiheit sowie die Erfüllung von Nebenpflichten. Die Ausführungen zeigen die vielfältigen Verpflichtungen des Verkäufers auf, die für die Erfüllung des Kaufvertrages essentiell sind.
IV. Pflichten des Käufers: Dieses Kapitel widmet sich den Pflichten des Käufers, insbesondere der Zahlungspflicht und der Abnahmepflicht. Der Eigentumsvorbehalt als Sicherungsmittel des Verkäufers wird ebenfalls beleuchtet. Die Ausführungen betonen die wechselseitigen Verpflichtungen der Vertragsparteien und deren Bedeutung für ein ausgewogenes Vertragsverhältnis.
V. Leistungsort: Das Kapitel befasst sich mit der Bestimmung des Leistungsortes im Kaufvertrag. Die unterschiedlichen Arten der Leistungspflicht (Holschuld, Bringschuld, Schickschuld) werden im Detail erklärt und ihre jeweiligen Auswirkungen auf die Gefahrtragung im Kaufvertrag verdeutlicht.
VI. Gefahrtragung beim Kauf: Dieses Kapitel klärt die Frage, wer die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Beschädigung der Kaufsache trägt. Der Zeitpunkt der Gefahrtragung wird im Zusammenhang mit der Übergabe der Ware und im besonderen Fall des Verbrauchsgüterkaufs definiert und erläutert.
VII. Pflicht zur Lieferung mangelfreier Ware: Dieses zentrale Kapitel definiert den Begriff des Sachmangels umfassend, sowohl subjektiv (vereinbarte Beschaffenheit, vertraglich vorausgesetzte Verwendung) als auch objektiv (Verkehrserwartung, gewöhnliche Verwendung, Werbung). Es werden verschiedene Arten von Mängeln wie fehlerhafte Montage, Minder- und Fehllieferungen sowie die Bedeutung der Bagatellgrenze ausführlich behandelt. Der maßgebliche Zeitpunkt der Mangelfreiheit und die Beweislastverteilung werden ebenfalls beleuchtet.
VIII. Rangfolge der Käuferrechte: Dieses Kapitel beschreibt die Prioritäten der verschiedenen Käuferrechte bei Vorliegen eines Mangels. Es liefert einen Überblick über die Reihenfolge, in der der Käufer seine Ansprüche geltend machen kann.
IX. Sachliche Schranken der Käuferrechte: Dieses Kapitel behandelt die Einschränkungen der Käuferrechte, die sich aus dem Wissen des Käufers über den Mangel, vertraglichen Vereinbarungen und dem beidseitigen Handelskauf ergeben. Insbesondere die Untersuchungspflicht und Rügepflicht des Käufers im Handelskauf werden detailliert dargestellt.
X. Zeitliche Schranken der Käuferrechte: Hier werden die zeitlichen Grenzen der Geltendmachung von Käuferrechten durch Verjährungsfristen erläutert. Es werden der Fristbeginn, die Verjährungsfristen für verschiedene Ansprüche, Hemmungs- und Neubeginnstatbestände sowie die Erhaltung der Mängeleinrede und die spezifischen Verjährungsregelungen beim Regressanspruch behandelt.
Schlüsselwörter
Gewährleistung, Kaufrecht, Sachmangel, Rechtsmangel, Käuferrechte, Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung, Schadenersatz, Verbrauchsgüterkauf, Handelskauf, Beweislast, Verjährung, Untersuchungspflicht, Rügepflicht.
Häufig gestellte Fragen zum Thema Gewährleistung im deutschen Kaufrecht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet eine umfassende Analyse der Gewährleistungshaftung im deutschen Kaufrecht. Der Fokus liegt auf der Darstellung und Analyse der Rechte des Käufers bei Mängeln der Kaufsache. Die verschiedenen Käuferrechte, ihre Voraussetzungen und Rechtsfolgen werden detailliert untersucht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rechte des Käufers bei Sachmängeln, die Voraussetzungen und Rechtsfolgen der einzelnen Käuferrechte (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung, Schadenersatz), die zeitlichen und sachlichen Schranken der Käuferrechte, die Unterschiede zwischen Verbrauchsgüterkauf und Handelskauf und die Bedeutung der Beweislastverteilung.
Welche Käuferrechte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt ausführlich die Käuferrechte bei Sachmängeln, darunter insbesondere Nacherfüllung (Reparatur oder Ersatzlieferung), Rücktritt vom Vertrag, Minderung des Kaufpreises und Schadenersatzansprüche (Mangelfolgeschäden).
Welche Voraussetzungen müssen für die Geltendmachung der Käuferrechte erfüllt sein?
Die Voraussetzungen für die Geltendmachung der einzelnen Käuferrechte werden detailliert beschrieben. Dies umfasst das Vorliegen eines Sachmangels, den Zeitpunkt des Mangels, die Untersuchungspflicht und Rügepflicht des Käufers (insbesondere beim Handelskauf), sowie die Einhaltung von Fristen und die Berücksichtigung sachlicher Schranken.
Welche Rechtsfolgen sind mit den einzelnen Käuferrechten verbunden?
Für jedes Käuferrecht werden die jeweiligen Rechtsfolgen im Detail erläutert. Dies beinhaltet beispielsweise die Rückabwicklung des Vertrages beim Rücktritt, die Anpassung des Kaufpreises bei Minderung und die verschiedenen Möglichkeiten des Schadenersatzes.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel, beginnend mit einer Einleitung und einem Überblick über die Zielsetzung und Themenschwerpunkte. Es folgen Kapitel zum Kaufvertrag, den Pflichten des Verkäufers und des Käufers, dem Leistungsort und der Gefahrtragung. Ein zentraler Abschnitt befasst sich mit der Pflicht zur Lieferung mangelfreier Ware, einschließlich der Definition des Sachmangels und verschiedener Arten von Mängeln. Weitere Kapitel behandeln die Rangfolge und die sachlichen und zeitlichen Schranken der Käuferrechte. Schließlich werden die einzelnen Käuferrechte (Mängeleinrede, Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung, Schadenersatz) im Detail analysiert.
Was ist der Unterschied zwischen Verbrauchsgüterkauf und Handelskauf?
Die Arbeit beleuchtet die Unterschiede zwischen Verbrauchsgüterkauf und Handelskauf, insbesondere im Hinblick auf die Untersuchungspflicht und Rügepflicht des Käufers. Diese Unterschiede beeinflussen die Geltendmachung der Käuferrechte maßgeblich.
Welche Rolle spielt die Beweislast?
Die Bedeutung der Beweislastverteilung bei der Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen wird ausführlich diskutiert. Die Arbeit klärt, wer im jeweiligen Fall die Beweislast für das Vorliegen eines Mangels und für andere relevante Tatsachen trägt.
Welche zeitlichen Schranken gelten für die Geltendmachung von Käuferrechten?
Die Arbeit behandelt ausführlich die zeitlichen Schranken der Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen durch Verjährung. Es werden die verschiedenen Verjährungsfristen, der Fristbeginn, Hemmungs- und Neubeginnstatbestände sowie Ausnahmen und Modifikationen erläutert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter, die den Inhalt der Arbeit beschreiben, sind: Gewährleistung, Kaufrecht, Sachmangel, Rechtsmangel, Käuferrechte, Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung, Schadenersatz, Verbrauchsgüterkauf, Handelskauf, Beweislast, Verjährung, Untersuchungspflicht, Rügepflicht.
- Quote paper
- Dirk Sturm (Author), 2007, Die Gewährleistungshaftung im deutschen Kaufrecht. Die Verbrauchgüterkaufrichtlinie 1999/44/EG und die Umsetzung ins deutsche Schuldrecht vom 1.1.2002, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84823