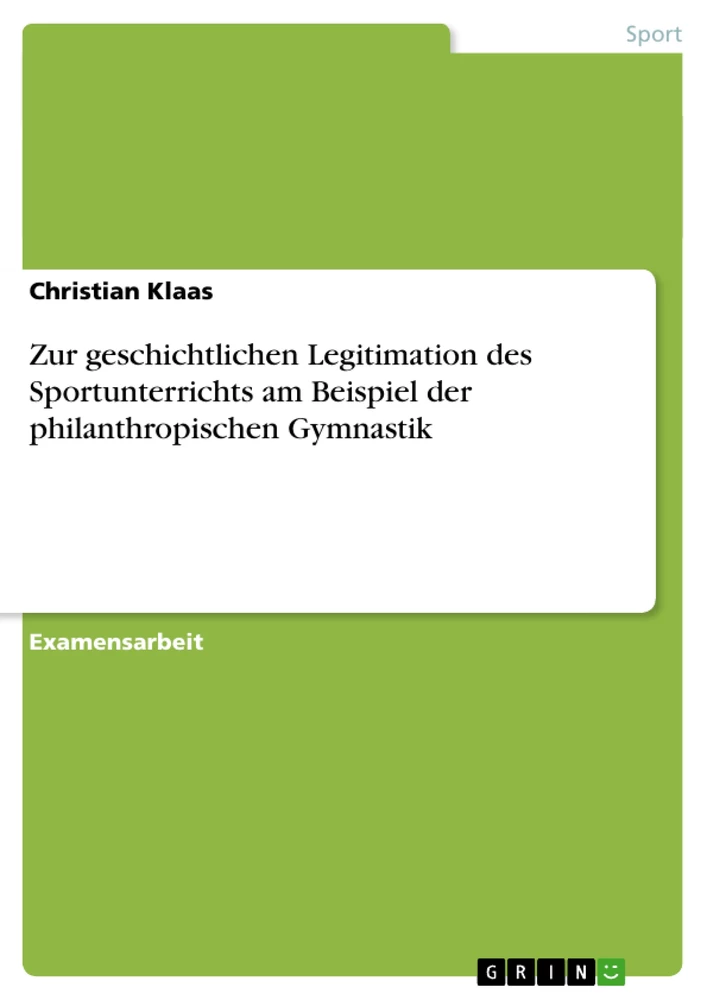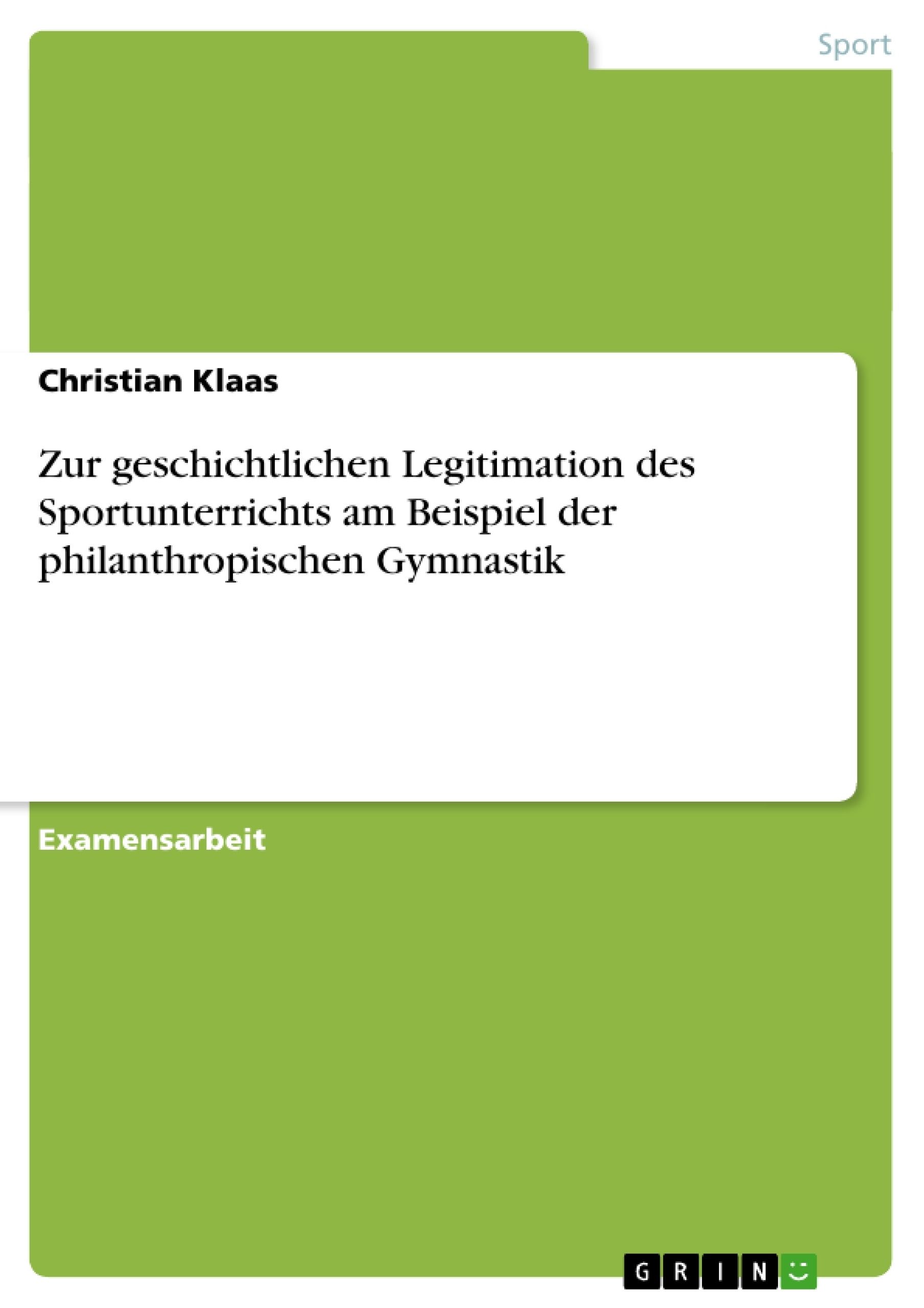Sportunterricht und seine Legitimation sind heute wieder in aller Munde. Vor dem Hintergrund der Diskussionen nach dem schlechten deutschen PISA-Abschneiden einerseits (der Sport erscheint hier im Vergleich zu den so genannten Kernfächern als entbehrlich) und der vorherrschenden Bewegungs- und Erfahrungsarmut unseres alltäglichen Lebens andererseits wird wieder verstärkt nachgedacht über die Gründe, ob und warum Sport in der Schule überhaupt unterrichtet und auf welche Weise das getan werden sollte.
Diese Diskussion ist nun kein wirklich neues Phänomen, vielmehr zieht sie sich quer durch die Geschichte der modernen Leibeserziehung, deren Beginn in der Literatur übereinstimmend bei den Philanthropen verortet ist. Es ist ein Trugschluss in der (Sport)Pädagogik von einem stetig zunehmenden Erkenntnisgewinn hin zu immer größerer Allgemeinheit und Reichweite auszugehen. Ziele, Methoden und Inhalte wandeln sich, sie sind abhängig von der jeweiligen Zeit, von der gesellschaftlichen Lage und Stimmung. Dabei gibt es keinen ständigen Fortschritt, alt bekanntes taucht wieder auf und verschwindet in der Versenkung, nur um einige Zeit später in neuem Gewand wieder zu erscheinen. Es scheint daher lehrreich einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, weil er die Abhängigkeit und Relativität dessen, was uns heute richtig erscheint, freilegen kann (vgl. Kurz, 1993, S. 12). Vor diesem Hintergrund erscheint es interessant einmal genauer nachzuschauen, wie sich die Begründungen für Leibeserziehung/Sportunterricht (Ziele) und ebenso wichtig, die jeweilige Umsetzung in die Praxis (Inhalte/Methoden), denn ohne den Blick auf die reale Praxis bleibt der Blick auf die Ziele eine leere Hülle, im Laufe der Zeit gewandelt haben. Was bleibt, was kommt und geht und was kann uns das für heute sagen, das ist die entscheidende Frage. Aus diesem Grund ist der Fortlauf dieser Arbeit in drei große Teile gegliedert. Der erste Teil ist der Analyse des Zeitalters der Philanthropen, dem Beginn der modernen Leibeserziehung, gewidmet (Rahmenbedingungen, Ziele, Inhalte, Methoden der Leibeserziehung), während im zweiten Teil der heutige Ist-Zustand des Sportunterrichts anhand von fachdidaktischen Modellen, Lehrplänen und einem Blick in die Schulrealität beleuchtet wird. Abschließend erfolgt dann ein Vergleich der beiden Zeiten, aus dem wir interessante Folgerungen für die heutige bzw. zukünftige Begründung von Sportunterricht und deren Umsetzung in die Praxis ziehen können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das Zeitalter der Philanthropen
- 2.1 Der Rahmen-Wurzeln in der Aufklärung und Rousseau
- 2.2 Die philanthropische Leibeserziehung
- 2.2.1 Wozu Körperbildung? Die Ziele der Philanthropen
- 2.2.2 Was für Leibesübungen? Die inhaltliche Ausrichtung der Philanthropen
- 2.2.2.1 Ernsthafte, anhaltende Arbeit
- 2.2.2.2 Gesellschaftliche Jugendspiele
- 2.2.2.3 Die eigentlich gymnastischen Übungen
- 2.2.3 Wie Leibesübungen vermitteln? Die methodische Ausrichtung der Philanthropen
- 3 Meilensteine der Sportgeschichte
- 3.1 Heinrich Pestalozzi - Theoretische Weitsicht und praktische Einengung
- 3.2 Friedrich Ludwig Jahn – Der Durchbruch der bürgerlichen Gymnastik
- 3.3 Adolf Spieß Vater des Schulturnens
- 3.4 Die Reformbewegung – Wiederentdeckung des Kindes
- 3.5 Die Sportbewegung – Zweite Wurzel mit enormer Strahlkraft
- 4 Sport und Sportunterricht heute
- 4.1 Sportliche und sportunterrichtliche Entwicklungen der letzten 50 Jahre
- 4.1.1 Die Theorie der Leibeserziehung
- 4.1.2 Die Versportlichung der Leibeserziehung
- 4.1.3 Entwicklungen bis heute
- 4.2 Der heutige Sportunterricht – Begründungen und ihre praktische Umsetzung
- 4.2.1 Begründungen für den Sportunterricht in der Fachdidaktik
- 4.2.1.1 Das Sportartenkonzept
- 4.2.1.2 Mehrperspektivischer Unterricht nach Kurz
- 4.2.1.3 Bewegte Schule
- 4.2.1.4 Mehrperspektivischer Unterricht bei Ehni
- 4.2.1.5 Das Konzept der Körpererfahrung
- 4.2.1.6 Der offene Sportunterricht
- 4.2.2 Begründungen für den Sportunterricht in den Lehrplänen
- 4.2.3 Die Praxis des Sportunterrichts
- 4.2.1 Begründungen für den Sportunterricht in der Fachdidaktik
- 4.1 Sportliche und sportunterrichtliche Entwicklungen der letzten 50 Jahre
- 5 Das „Erbe\" der Philanthropen
- 5.1 Philanthropische Leibeserziehung und moderner Sportunterricht – ein Vergleich
- 5.1.1 Vergleich der Begründungen
- 5.1.2 Vergleich der Inhalte
- 5.1.3 Vergleich der Methoden
- 5.2 Folgerungen - Abschied von der pädagogischen Begründung?
- 5.1 Philanthropische Leibeserziehung und moderner Sportunterricht – ein Vergleich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die geschichtliche Legitimation des Sportunterrichts anhand der philanthropischen Gymnastik. Ziel ist es, die Entwicklung der Begründungen und Praktiken des Sportunterrichts aufzuzeigen und deren Relevanz für den heutigen Sportunterricht zu beleuchten. Die Arbeit analysiert, wie sich Ziele, Inhalte und Methoden im Laufe der Zeit verändert haben und welche Aspekte aus der philanthropischen Tradition bis heute nachwirken.
- Entwicklung der Begründungen für Sportunterricht
- Einfluss der Philanthropen auf die Leibeserziehung
- Vergleich philanthropischer und moderner Sportunterrichtskonzepte
- Relevanz historischer Perspektiven für die aktuelle Sportunterrichtsdebatte
- Wandel von Zielen, Inhalten und Methoden im Sportunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Diskussion um die Legitimation des Sportunterrichts und stellt die Notwendigkeit einer historischen Perspektive heraus. Sie zeigt den Konflikt zwischen der Abwertung des Sportunterrichts im Vergleich zu kognitiven Fächern und den gleichzeitig zunehmenden gesundheitlichen Problemen bei Kindern und Jugendlichen auf. Die Arbeit kündigt eine Analyse der historischen Entwicklung der Begründungen und Praktiken des Sportunterrichts an, um die gegenwärtige Debatte besser zu verstehen.
2 Das Zeitalter der Philanthropen: Dieses Kapitel untersucht die philanthropische Leibeserziehung im Kontext der Aufklärung und Rousseaus Gedanken. Es analysiert die Ziele der Philanthropen (körperliche und moralische Bildung), die von ihnen eingesetzten Übungen (ernsthafte Arbeit, Gesellschaftsspiele, gymnastische Übungen) und ihre methodischen Ansätze. Der Fokus liegt auf der Verbindung von körperlicher und geistiger Entwicklung und der Bedeutung von sozialer Integration durch Bewegung.
3 Meilensteine der Sportgeschichte: Dieses Kapitel skizziert wichtige Entwicklungsstufen der Sportgeschichte, von Pestalozzis theoretischen Ansätzen bis zur Sportbewegung des 20. Jahrhunderts. Es werden die Beiträge von Persönlichkeiten wie Friedrich Ludwig Jahn und Adolf Spieß beleuchtet und die Entwicklungen der Reformbewegung und der Sportbewegung in ihren jeweiligen gesellschaftlichen Kontexten dargestellt. Der Schwerpunkt liegt auf dem Wandel der Konzepte und Praktiken der Leibeserziehung und deren Bedeutung für die Entwicklung des modernen Sportunterrichts.
4 Sport und Sportunterricht heute: Dieses Kapitel analysiert den heutigen Sportunterricht, seine Begründungen in der Fachdidaktik und den Lehrplänen sowie seine praktische Umsetzung. Es werden verschiedene Konzepte und Modelle des Sportunterrichts vorgestellt und miteinander verglichen (Sportartenkonzept, mehrperspektivischer Unterricht, bewegte Schule, offener Sportunterricht). Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Ansätzen zur Legitimation und Gestaltung des heutigen Sportunterrichts.
5 Das „Erbe\" der Philanthropen: Das Kapitel vergleicht die philanthropische Leibeserziehung mit dem modernen Sportunterricht hinsichtlich seiner Begründungen, Inhalte und Methoden. Es wird untersucht, inwiefern die Ideen und Prinzipien der Philanthropen im heutigen Sportunterricht weiterleben und welche Veränderungen sich im Laufe der Zeit vollzogen haben. Die Analyse dient dazu, die Kontinuitäten und Brüche in der Entwicklung des Sportunterrichts aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Philanthropische Gymnastik, Sportunterricht, Leibeserziehung, Sportpädagogik, Sportdidaktik, geschichtliche Legitimation, pädagogische Begründung, körperliche Bildung, moralische Bildung, Bewegung, Gesundheit, Entwicklung des Kindes, moderne Sportunterrichtskonzepte, Vergleich, Kontinuität, Wandel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Geschichte der Begründungen und Praktiken des Sportunterrichts
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die historische Entwicklung der Begründungen und Praktiken des Sportunterrichts, insbesondere im Hinblick auf die philanthropische Gymnastik. Sie analysiert den Wandel von Zielen, Inhalten und Methoden im Laufe der Zeit und beleuchtet die Relevanz historischer Perspektiven für die aktuelle Sportunterrichtsdebatte.
Welche Epochen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung vom Zeitalter der Philanthropen (Aufklärung und Rousseau) über wichtige Meilensteine der Sportgeschichte (Pestalozzi, Jahn, Spieß, Reform- und Sportbewegung) bis hin zum heutigen Sportunterricht.
Welche zentralen Personen werden betrachtet?
Die Arbeit widmet sich zentralen Persönlichkeiten wie Heinrich Pestalozzi, Friedrich Ludwig Jahn und Adolf Spieß, deren Beiträge zur Entwicklung der Leibeserziehung und des Sportunterrichts entscheidend waren.
Welche Konzepte des Sportunterrichts werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht verschiedene Konzepte des Sportunterrichts, darunter das Sportartenkonzept, den mehrperspektivischen Unterricht (nach Kurz und Ehni), die bewegte Schule und den offenen Sportunterricht, sowohl mit der philanthropischen Leibeserziehung als auch untereinander.
Was ist der Fokus des Kapitels über die Philanthropen?
Das Kapitel über die Philanthropen analysiert deren Ziele (körperliche und moralische Bildung), die von ihnen eingesetzten Übungen (ernsthafte Arbeit, Gesellschaftsspiele, Gymnastik) und ihre methodischen Ansätze im Kontext der Aufklärung und Rousseaus Philosophie. Der Fokus liegt auf der Verbindung von körperlicher und geistiger Entwicklung sowie der sozialen Integration durch Bewegung.
Wie wird der heutige Sportunterricht analysiert?
Der heutige Sportunterricht wird anhand seiner Begründungen in der Fachdidaktik und den Lehrplänen sowie seiner praktischen Umsetzung analysiert. Verschiedene Konzepte und Modelle werden vorgestellt und verglichen, um die unterschiedlichen Ansätze zur Legitimation und Gestaltung des Unterrichts aufzuzeigen.
Wie wird der Vergleich zwischen philanthropischer Leibeserziehung und modernem Sportunterricht durchgeführt?
Der Vergleich zwischen philanthropischer Leibeserziehung und modernem Sportunterricht erfolgt anhand der Begründungen, Inhalte und Methoden. Es wird untersucht, welche Aspekte der philanthropischen Tradition im heutigen Sportunterricht weiterleben und welche Veränderungen sich im Laufe der Zeit ergeben haben.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zur Kontinuität und zum Wandel in der Entwicklung des Sportunterrichts und diskutiert die Relevanz der philanthropischen Tradition für die heutige Sportunterrichtsdebatte. Es wird auch die Frage nach der pädagogischen Begründung des Sportunterrichts kritisch beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Philanthropische Gymnastik, Sportunterricht, Leibeserziehung, Sportpädagogik, Sportdidaktik, geschichtliche Legitimation, pädagogische Begründung, körperliche Bildung, moralische Bildung, Bewegung, Gesundheit, Entwicklung des Kindes, moderne Sportunterrichtskonzepte, Vergleich, Kontinuität, Wandel.
- Quote paper
- Christian Klaas (Author), 2007, Zur geschichtlichen Legitimation des Sportunterrichts am Beispiel der philanthropischen Gymnastik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84652