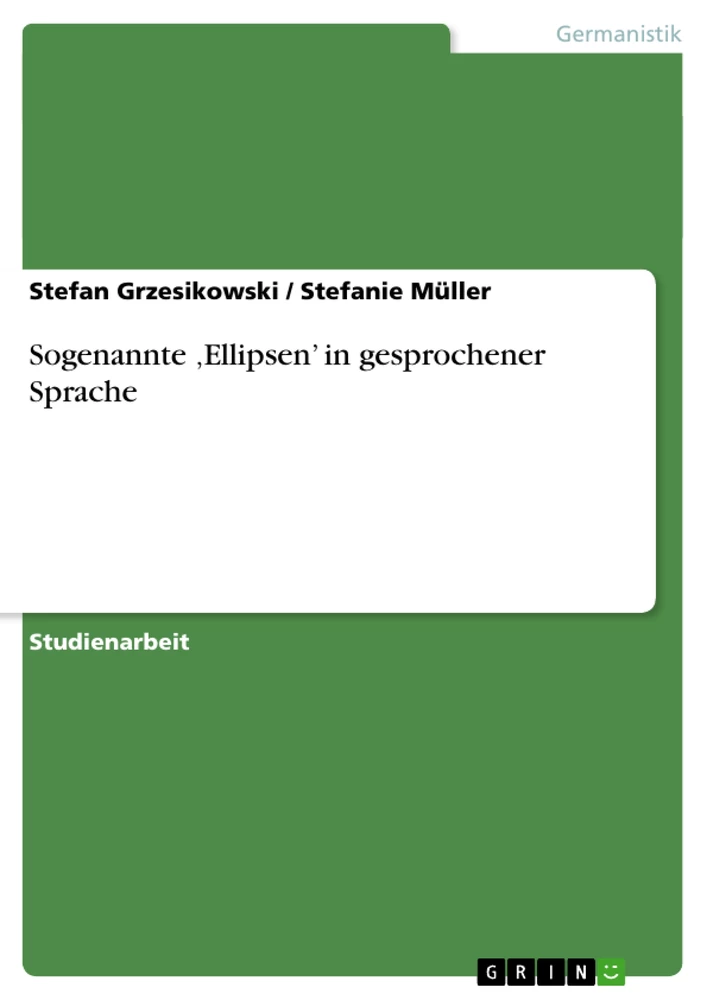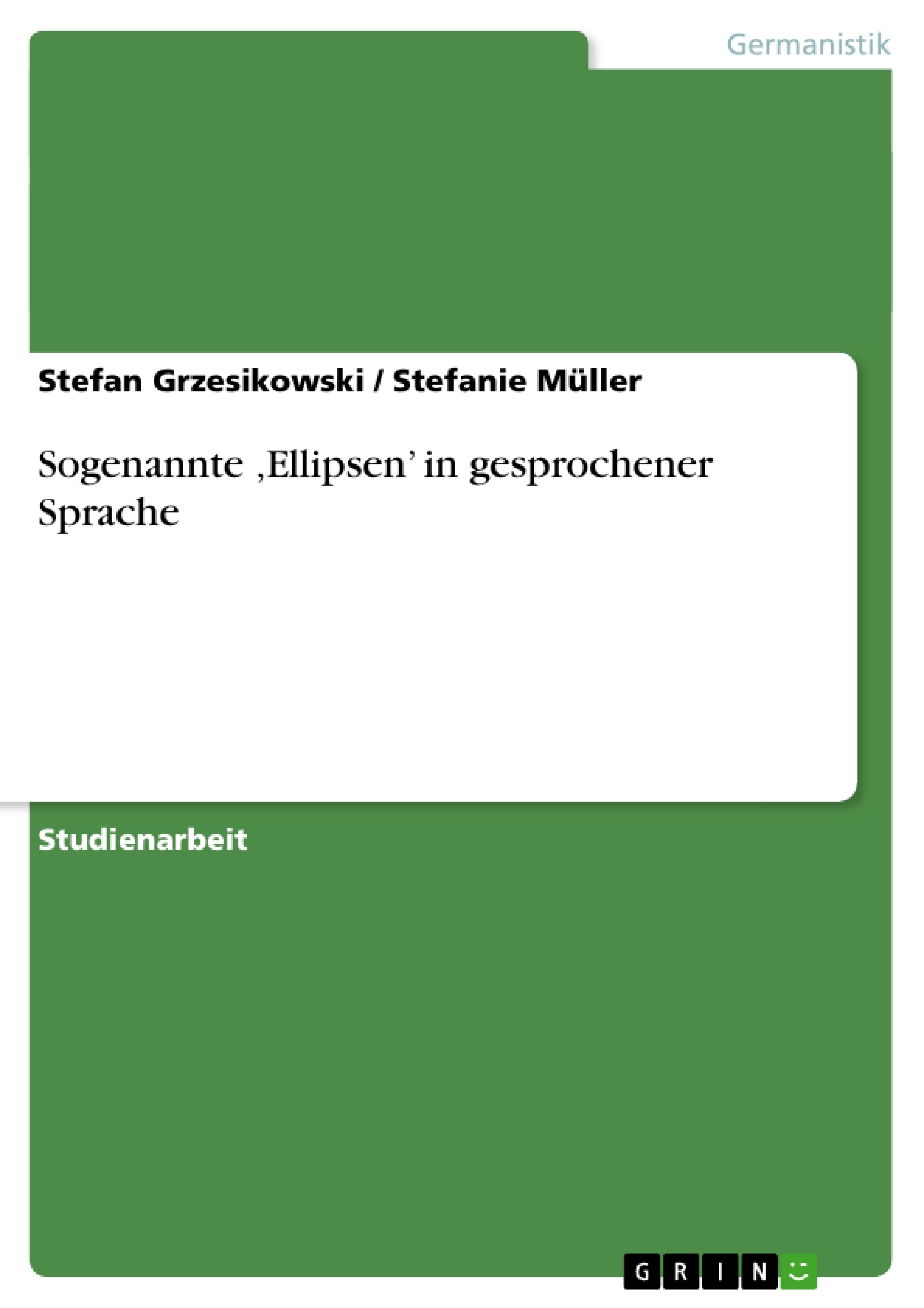Wie die Arbeit im weiteren Verlauf noch aufzeigen wird, beinhaltet der Ellipsenbegriff gewisse Probleme. Buss (2004) macht die Entstehungsgeschichte dafür mitverantwortlich. So ist der Begriff der Ellipse zur Beschreibung eines syntaktischen Phänomens aus der Rhetorik importiert worden. Hier bezeichnet die Ellipse die kunstvolle Tilgung bestimmter Elemente der Rede. Neben dieser positiven Wortbedeutung als rhetorische Figur bezeichnet der Begriff allerdings auch bereits bei Quintilian einen zu vermeidenden grammatischen Ausdrucksfehler. Während in der Rhetorik die positive Wortbedeutung, elliptische Konstruktionen als bewusst eingesetztes Verfahren, vorherrscht, wurde in die grammatische Tradition vorwiegend die Bedeutung als Regelverstoß durch mangelnde Vollständigkeit übernommen. Grammatisch wird die Ellipse also als syntaktisches Defizit verstanden, wobei hier immer die Norm der schriftbasierten Standardsprache zu Grunde liegt, auch um Phänomene der gesprochenen Sprache einzuschätzen. Auch bei Bußmann (1990) wird die Ellipse als „Aussparung von sprachlichen Elementen, die aufgrund von syntaktischen Regeln oder lexikalischen Eigenschaften (z.B. Valenz eines Verbs) notwendig sind“ definiert, damit auch lediglich über einen Mangel. Auch in der Linguistik, die den Fokus ja eigentlich auf die gesprochene Sprache legt, wurde lange mit schriftsprachorientierten Analyse- und Beschreibungskategorien gearbeitet und zudem wurden schriftliche Texte als empirische Grundlage der Forschung verwendet. Dies hat bezüglich der Ellipsen zur Folge, dass sich zwei Auffassungen gegenüberstehen, zum einen die Ableitungsthese und zum anderen die Autonomiethese.
Bevor jedoch mit Blick auf die unterschiedlichen Ellipsentheorien auch auf diesen Streit eingegangen werden wird, sollen unterschiedliche Ellipsenarten nach Klein (1985 und 1993) dargestellt werden. Nachdem mit Selting (1997) auf die Schwierigkeiten einer klaren Ellipsendefinition eingegangen werden wird und für die Unbrauchbarkeit des Ellipsenbegriffs plädiert wird, soll schließlich auf Günthner (2006) eingegangen werden, die mit ihren ‚dichten Konstruktionen’ eventuell Seltings Forderung nach neuen, passenden Begrifflichkeiten einlöst. Abschließend wird dann versucht werden, dichte Konstruktionen in einer kleiner Stichprobe ausfindig zu machen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitende Bemerkungen
- 2. Überblick zu Arten von Ellipsen und Ellipsentheorien
- 2.1. Arten der Ellipse nach Klein
- 2.2. Ellipsentheorien
- 2.2.1. Grammatische Ellipsen-Theorien
- 2.2.2. Funktionale Ellipsentheorien
- 2.2.3. Kommunikative Ellipsentheorien
- 2.3. Fazit
- 3. Definitions- und Abgrenzungsprobleme nach Selting
- 3.1. Vorbemerkungen
- 3.2. Versuch einer syntaktischen Abgrenzung
- 3.3. Versuch einer prosodischen Abgrenzung
- 3.4. Die Kombination von Syntax, Prosodie und Kontext
- 3.5. Schlussfolgerungen
- 4. Verdichtung statt Defizit
- 4.1. Allgemein
- 4.2. Uneigentliche Verbspitzenstellung
- 4.3. Infinitkonstruktionen
- 4.4. Subjektlose Infinitkonstruktionen
- 4.5. Minimale Setzungen
- 5. Suche nach dichten Konstruktionen in einer Stichprobe
- 5.1. Vorbemerkungen
- 5.2. Uneigentliche Verbspitzenstellung
- 5.3. Infinitkonstruktionen
- 5.4. Subjektlose Infinitkonstruktionen
- 5.5. Minimale Setzungen
- 6. Abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Ellipsenbegriff in der gesprochenen Sprache. Sie beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Definition und Abgrenzung von Ellipsen, insbesondere im Vergleich zu schriftlicher Sprache. Die Arbeit hinterfragt den traditionellen Ansatz, Ellipsen als syntaktisches Defizit zu betrachten.
- Probleme der Ellipsendefinition in der Linguistik
- Unterscheidung verschiedener Ellipsenarten nach Klein
- Vergleichende Betrachtung grammatischer, funktionaler und kommunikativer Ellipsentheorien
- Der Ansatz "Verdichtung statt Defizit" als Alternative
- Analyse von "dichten Konstruktionen" in einer Sprachstichprobe
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitende Bemerkungen: Der einleitende Abschnitt beschreibt die Problematik des Ellipsenbegriffs, der aus der Rhetorik in die Grammatik übernommen wurde und dort oft negativ konnotiert ist. Die Arbeit stellt die gegensätzlichen Auffassungen der Ableitungsthese und der Autonomiethese vor und kündigt die folgenden Analysen der Ellipsenarten nach Klein, die Schwierigkeiten einer klaren Definition nach Selting und den Gegenvorschlag von Günthner mit "dichten Konstruktionen" an. Die Arbeit gliedert sich in die Darstellung verschiedener Ellipsenarten, die Auseinandersetzung mit Definitions- und Abgrenzungsproblemen sowie die Untersuchung von "dichten Konstruktionen" in einer Stichprobe.
2. Überblick zu Arten von Ellipsen und Ellipsentheorien: Dieses Kapitel präsentiert zunächst Kleins Klassifizierung von Ellipsen, die kontextabhängige und kontextkontrollierte Ellipsen unterscheidet. Die kontextabhängigen Ellipsen werden weiter unterteilt in Aufschriften, Textsortenellipsen, feste Ausdrücke, lexikalische Ellipsen, verarbeitungsbedingte und entwicklungsbedingte Ellipsen. Klein selbst betont die mangelnde Präzision dieser Klassifizierung, die jedoch die Vielfalt der mit dem Begriff "Ellipse" bezeichneten Phänomene aufzeigt. Das Kapitel bietet einen Überblick über die verschiedenen theoretischen Ansätze zur Erklärung von Ellipsen, ohne jedoch auf einzelne Theorien im Detail einzugehen.
3. Definitions- und Abgrenzungsprobleme nach Selting: Dieses Kapitel befasst sich mit den von Selting aufgezeigten Schwierigkeiten bei der Definition und Abgrenzung von Ellipsen. Es untersucht sowohl syntaktische als auch prosodische Kriterien und zeigt die Komplexität der Interaktion von Syntax, Prosodie und Kontext auf. Selting argumentiert für die Unbrauchbarkeit des Ellipsenbegriffs und plädiert für neue, passendere Begrifflichkeiten. Das Kapitel analysiert die Herausforderungen, die sich aus der unterschiedlichen Betrachtungsweise von Ellipsen in schriftlicher und gesprochener Sprache ergeben.
4. Verdichtung statt Defizit: Dieses Kapitel präsentiert Günthners Konzept der "dichten Konstruktionen" als Alternative zur traditionellen Defizit-Perspektive auf Ellipsen. Es erläutert den Ansatz und diskutiert verschiedene Arten von dichten Konstruktionen wie uneigentliche Verbspitzenstellung, Infinitkonstruktionen und minimale Setzungen. Das Kapitel argumentiert, dass die vermeintliche Unvollständigkeit von Ellipsen nicht als Mangel, sondern als sprachökonomische Strategie interpretiert werden sollte, die die Kohärenz und Verständlichkeit gesprochener Sprache erhöht.
5. Suche nach dichten Konstruktionen in einer Stichprobe: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise bei der Suche nach "dichten Konstruktionen" in einer ausgewählten Sprachstichprobe. Es präsentiert die Ergebnisse der Analyse und diskutiert die gefundenen Beispiele im Kontext der theoretischen Überlegungen der vorhergehenden Kapitel. Die Ergebnisse bestätigen die Hypothese, dass "dichte Konstruktionen" in der gesprochenen Sprache häufig vorkommen und eine wichtige Rolle für die sprachliche Ökonomie spielen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Ellipsen in der gesprochenen Sprache
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Ellipsenbegriff in der gesprochenen Sprache. Sie beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Definition und Abgrenzung von Ellipsen, insbesondere im Vergleich zu schriftlicher Sprache, und hinterfragt den traditionellen Ansatz, Ellipsen als syntaktisches Defizit zu betrachten. Sie präsentiert alternative Perspektiven, wie den Ansatz der "Verdichtung statt Defizit".
Welche Arten von Ellipsen werden behandelt?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Ellipsenarten nach Klein, darunter kontextabhängige und kontextkontrollierte Ellipsen, die wiederum in verschiedene Unterkategorien wie Aufschriften, Textsortenellipsen, feste Ausdrücke, lexikalische Ellipsen, verarbeitungsbedingte und entwicklungsbedingte Ellipsen unterteilt werden. Die Arbeit konzentriert sich außerdem auf "dichte Konstruktionen" als alternatives Konzept.
Welche Ellipsentheorien werden verglichen?
Die Arbeit gibt einen Überblick über grammatische, funktionale und kommunikative Ellipsentheorien, ohne auf einzelne Theorien im Detail einzugehen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich verschiedener theoretischer Ansätze und der Herausarbeitung ihrer Stärken und Schwächen.
Welche Probleme bei der Definition und Abgrenzung von Ellipsen werden diskutiert?
Die Arbeit analysiert die von Selting aufgezeigten Schwierigkeiten bei der Definition und Abgrenzung von Ellipsen, unter Berücksichtigung syntaktischer und prosodischer Kriterien sowie des Kontextes. Sie zeigt die Komplexität der Interaktion dieser Faktoren und die Herausforderungen, die sich aus der unterschiedlichen Betrachtungsweise von Ellipsen in schriftlicher und gesprochener Sprache ergeben.
Was ist das Konzept der "Verdichtung statt Defizit"?
Dieser Ansatz, vertreten von Günthner, betrachtet Ellipsen nicht als syntaktisches Defizit, sondern als sprachökonomische Strategie. Er argumentiert, dass die vermeintliche Unvollständigkeit von Ellipsen die Kohärenz und Verständlichkeit gesprochener Sprache erhöht. Verschiedene Arten von "dichten Konstruktionen" wie uneigentliche Verbspitzenstellung, Infinitkonstruktionen und minimale Setzungen werden im Detail erläutert.
Wie wird das Konzept der "dichten Konstruktionen" empirisch untersucht?
Die Arbeit beschreibt die methodische Vorgehensweise bei der Suche nach "dichten Konstruktionen" in einer ausgewählten Sprachstichprobe. Sie präsentiert die Ergebnisse der Analyse und diskutiert die gefundenen Beispiele im Kontext der theoretischen Überlegungen. Die Ergebnisse sollen die Hypothese bestätigen, dass "dichte Konstruktionen" in der gesprochenen Sprache häufig vorkommen und eine wichtige Rolle für die sprachliche Ökonomie spielen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert die Implikationen für das Verständnis von Ellipsen in der gesprochenen Sprache. Sie betont die Notwendigkeit, über den traditionellen Defizit-Ansatz hinauszugehen und alternative Perspektiven wie den Ansatz der "Verdichtung statt Defizit" zu berücksichtigen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: 1. Einleitende Bemerkungen, 2. Überblick zu Arten von Ellipsen und Ellipsentheorien, 3. Definitions- und Abgrenzungsprobleme nach Selting, 4. Verdichtung statt Defizit, 5. Suche nach dichten Konstruktionen in einer Stichprobe, 6. Abschließende Bemerkungen. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas Ellipsen in der gesprochenen Sprache.
- Citar trabajo
- Stefan Grzesikowski (Autor), Stefanie Müller (Autor), 2007, Sogenannte ‚Ellipsen’ in gesprochener Sprache, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84470