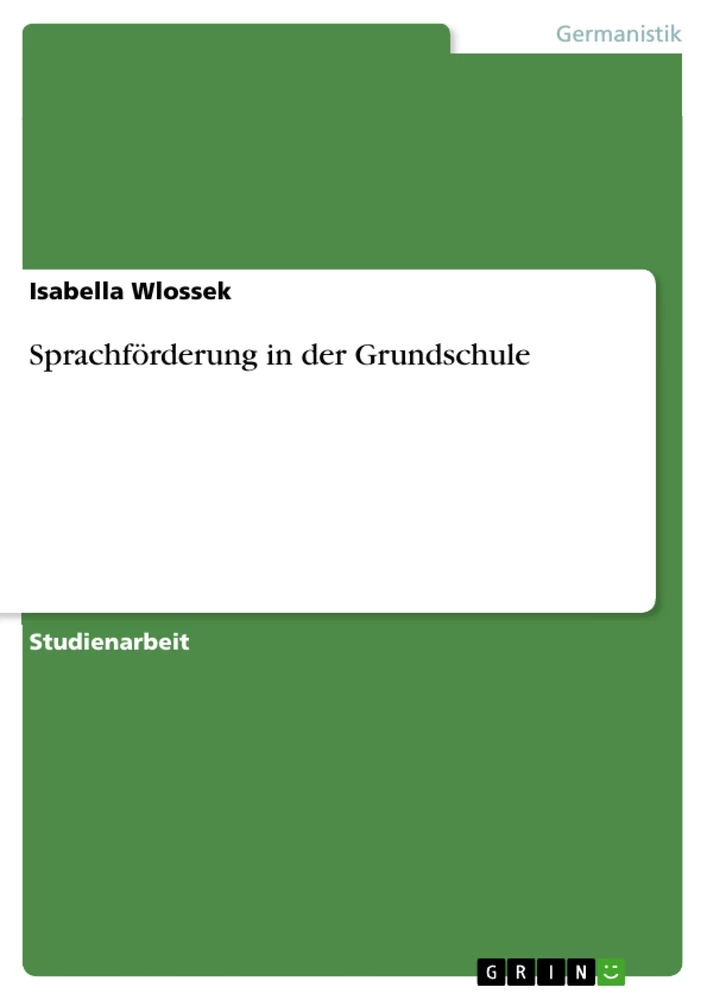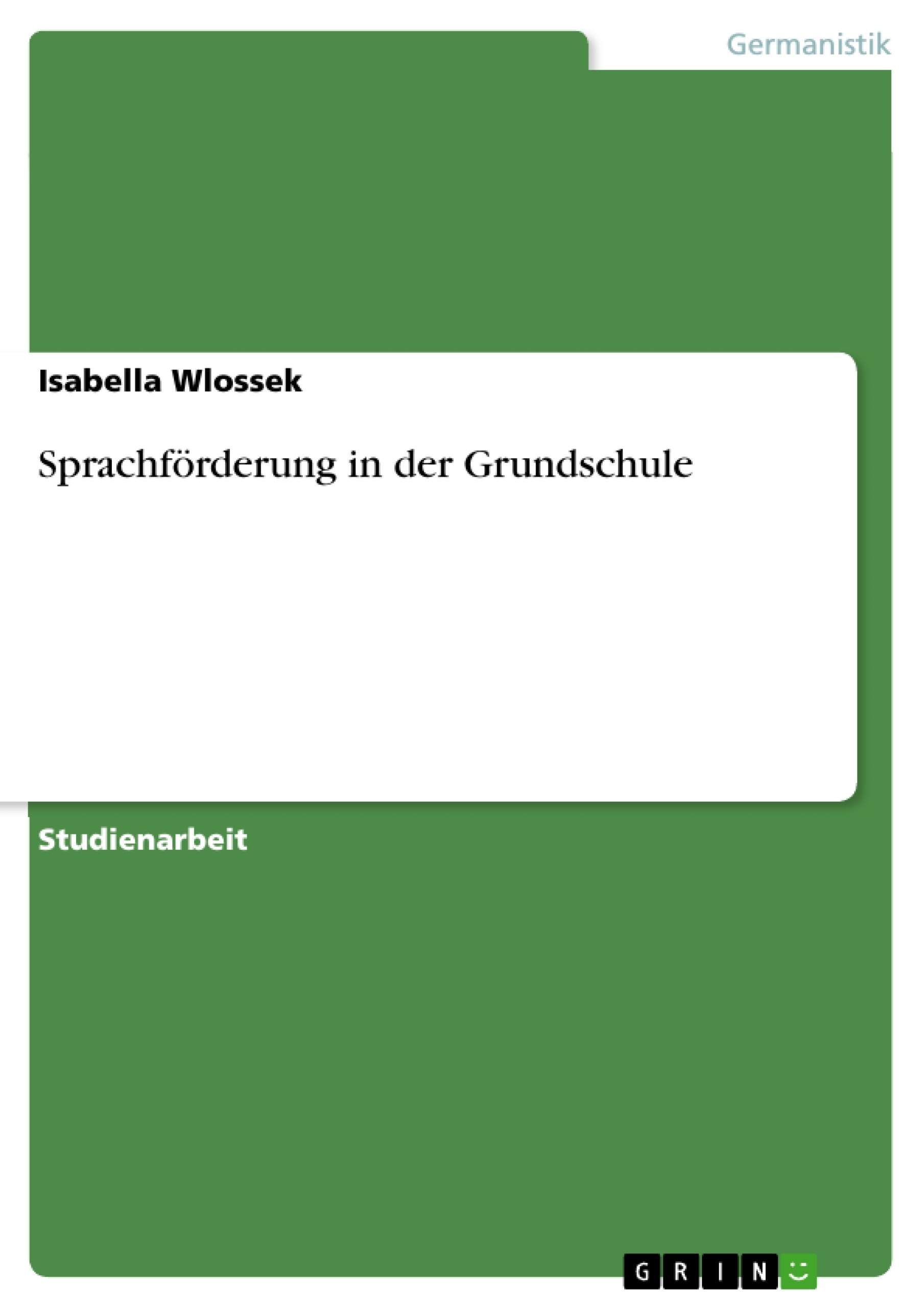Es ist wohl keine neue Erkenntnis, dass die sprachlichen Fähigkeiten eines Menschen ein
entscheidendes Kriterium für seinen Schulerfolg und somit auch für seine späteren
beruflichen Chancen darstellen. Darüber hinaus ist Sprachkompetenz sozusagen die
Eintrittskarte für die Möglichkeit einer aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und
dessen Gestaltung.
Dem Bildungssystem fällt demnach eine tragende Funktion für das langfristige Gelingen
der gesellschaftlichen Integration zu, - unabhängig davon, ob es sich um einen deutschen
Staatsbürger oder eine Person mit Migrationshintergrund handelt.
Sprachförderung ist ersichtlich also auch Entwicklungsförderung, und neben der Familie
und den Kindertagesstätten, die ebenfalls eine bedeutende Rolle spielen, da das günstige
„Zeitfenster“ für das Erlernen einer Sprache bereits weit vor der Einschulung liegt, fällt der
Schule auch in diesem Bereich eine gewichtige Verantwortung zu.
Jedoch hat sich auch durch die PISA- Studie aus dem Jahr 2000 bestätigt, dass gerade
dieser bedeutsame Sektor in Deutschland mit einigen Defiziten zu kämpfen hat.
Die mangelhaften Ergebnisse der Studie verleiteten einige besorgte Eltern und Bürger zu
der Annahme, dass das schlechte Abschneiden Deutschlands auf den hohen
Ausländeranteil in deutschen Klassenzimmern zurückzuführen ist. Schnell kochten hitzige
Diskussionen zu Themen wie Quote Bussing und Sprachtests auf, deren Nichtbestehen
unzureichende Kenntnisse der deutschen Sprache attestieren und eventuell Rückstellungen
zur Folge haben könnten. (...)
Im Fokus dieser Arbeit steht der Primärbereich des Bildungssystems und gleichzeitig eine
der wichtigsten Plattformen für die Sprachförderung - die Grundschule.
Zunächst soll untersucht werden, warum die Sprachförderung sich in Deutschland als
momentan so unzulänglich darstellt und welche Möglichkeiten es gibt, die
Rahmenbedingungen zu verbessern. Anschließend werden allgemein laufende Konzepte an
Grundschulen und die dazu gehörenden Methoden vorgestellt und zum Abschluss wird an
den konkreten Beispielen einiger Schulen in Deutschland erörtert, ob nicht doch auch
bereits effiziente Modelle an Grundschulen existieren, in denen die Sprachförderung
repräsentabel gehandhabt wird
Inhaltsverzeichnis
- Sprachförderung als Schlüssel für die Zukunft
- Rahmenbedingungen für eine funktionierende Sprachförderung in der Grundschule
- Methoden der Sprachförderung in der Grundschule
- Möglichkeiten der Sprachförderung neben dem Unterricht
- Positive Beispiele an Schulen
- Abschliessende Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen und Möglichkeiten der Sprachförderung in deutschen Grundschulen, insbesondere für Kinder mit Migrationshintergrund. Sie analysiert die bestehenden Rahmenbedingungen, gängige Methoden und präsentiert positive Beispiele. Das Ziel ist es, ein umfassenderes Verständnis der Problematik zu schaffen und Lösungsansätze aufzuzeigen.
- Sprachförderung als Schlüssel für Bildungserfolg und gesellschaftliche Teilhabe
- Defizite im deutschen Bildungssystem bezüglich Sprachförderung
- Rahmenbedingungen für effektive Sprachförderung in der Grundschule
- Methoden und Konzepte der Sprachförderung
- Beispiele erfolgreicher Sprachförderung an deutschen Schulen
Zusammenfassung der Kapitel
Sprachförderung als Schlüssel für die Zukunft: Dieses Kapitel betont die entscheidende Rolle von Sprachkompetenz für den Schulerfolg, berufliche Chancen und gesellschaftliche Teilhabe. Es verweist auf die Ergebnisse der PISA-Studie, die Defizite im deutschen Bildungssystem aufzeigt und die Diskussionen um Sprachtests und deren Auswirkungen beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Dringlichkeit frühzeitiger und effizienter Sprachförderung, insbesondere für Kinder aus sozial schwachen Familien und mit Migrationshintergrund. Die Ergebnisse der Berliner Sprachstandserhebung „Bärenstark“ unterstreichen die Notwendigkeit dringenden Handelns.
Rahmenbedingungen für eine funktionierende Sprachförderung in der Grundschule: Dieses Kapitel analysiert die Mängel im deutschen Bildungssystem, die Kinder mit Migrationshintergrund benachteiligen, trotz des Anspruchs auf Chancengleichheit. Es unterstreicht die Notwendigkeit, zwischen „Förderung“ und „Selektion“ zu unterscheiden und warnt vor der Einführung einer „Sonderpädagogik“ für Migrantenkinder. Die Arbeit betont die Bedeutung des interkulturellen Aspekts im Bildungssystem und plädiert für eine Reform des Kindergartenkonzepts, um spielerisches Lernen mit sprachlicher Förderung zu verbinden. Die Problematik der vorzeitigen Zuweisung von Migrantenkindern zu Förderklassen wird ebenfalls thematisiert und die Notwendigkeit flexibler Modelle für die Schuleingangsphase hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Sprachförderung, Grundschule, Migrationshintergrund, PISA-Studie, Bildungssystem, Chancengleichheit, Sprachkompetenz, Methoden der Sprachförderung, Interkulturelle Bildung, soziale Herkunft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sprachförderung in der Grundschule
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen und Möglichkeiten der Sprachförderung in deutschen Grundschulen, insbesondere für Kinder mit Migrationshintergrund. Sie analysiert die bestehenden Rahmenbedingungen, gängigen Methoden und präsentiert positive Beispiele. Das Ziel ist ein umfassenderes Verständnis der Problematik und die Aufzeigen von Lösungsansätzen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Sprachförderung als Schlüssel zum Bildungserfolg und gesellschaftlicher Teilhabe; Defizite im deutschen Bildungssystem bezüglich Sprachförderung; Rahmenbedingungen für effektive Sprachförderung in der Grundschule; Methoden und Konzepte der Sprachförderung; Beispiele erfolgreicher Sprachförderung an deutschen Schulen; die Rolle von Sprachkompetenz für Schulerfolg, berufliche Chancen und gesellschaftliche Teilhabe im Kontext von PISA-Studien und der Berliner Sprachstandserhebung „Bärenstark“; Mängel im deutschen Bildungssystem, die Kinder mit Migrationshintergrund benachteiligen; den Unterschied zwischen „Förderung“ und „Selektion“; den interkulturellen Aspekt im Bildungssystem; Reform des Kindergartenkonzepts; vorzeitige Zuweisung von Migrantenkindern zu Förderklassen und die Notwendigkeit flexibler Modelle für die Schuleingangsphase.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu: Sprachförderung als Schlüssel für die Zukunft; Rahmenbedingungen für eine funktionierende Sprachförderung in der Grundschule; Methoden der Sprachförderung in der Grundschule; Möglichkeiten der Sprachförderung neben dem Unterricht; Positive Beispiele an Schulen; Abschließende Zusammenfassung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sprachförderung, Grundschule, Migrationshintergrund, PISA-Studie, Bildungssystem, Chancengleichheit, Sprachkompetenz, Methoden der Sprachförderung, Interkulturelle Bildung, soziale Herkunft.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassenderes Verständnis der Herausforderungen der Sprachförderung in deutschen Grundschulen zu schaffen und Lösungsansätze aufzuzeigen. Besonderes Augenmerk liegt auf Kindern mit Migrationshintergrund.
Welche konkreten Beispiele werden genannt?
Die Arbeit nennt positive Beispiele erfolgreicher Sprachförderung an deutschen Schulen, jedoch ohne diese im Detail zu benennen. Die Ergebnisse der PISA-Studie und der Berliner Sprachstandserhebung „Bärenstark“ dienen als Belege für die Notwendigkeit von Sprachförderung.
Wer sollte diese Arbeit lesen?
Diese Arbeit richtet sich an alle, die sich mit dem Thema Sprachförderung in der Grundschule auseinandersetzen, insbesondere Pädagogen, Lehrkräfte, Bildungspolitiker und Wissenschaftler.
- Arbeit zitieren
- Isabella Wlossek (Autor:in), 2006, Sprachförderung in der Grundschule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84429