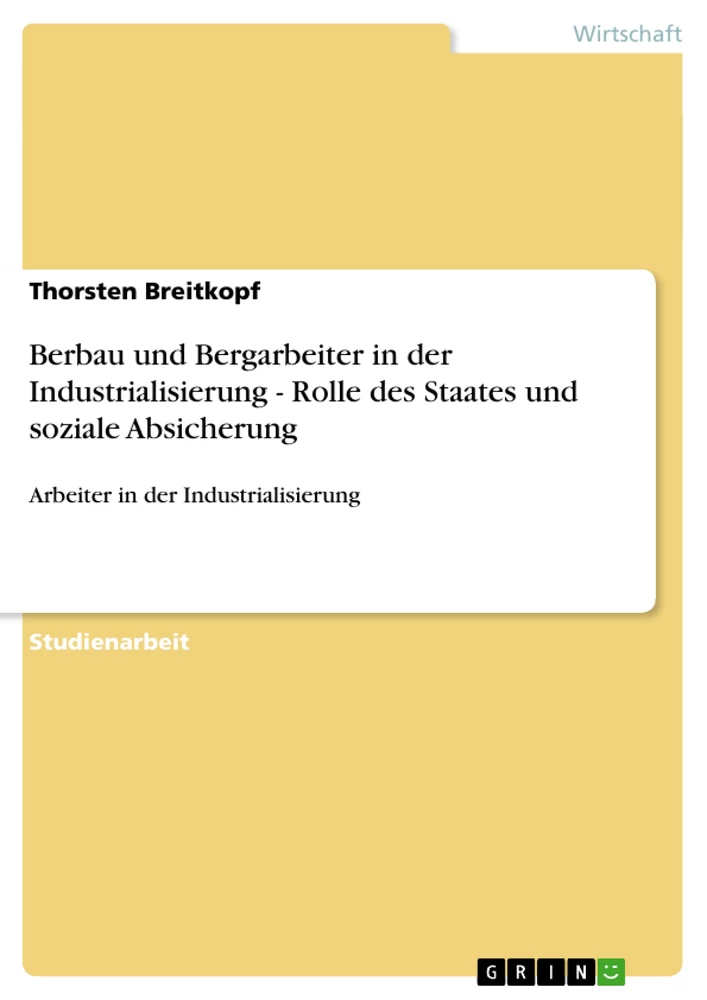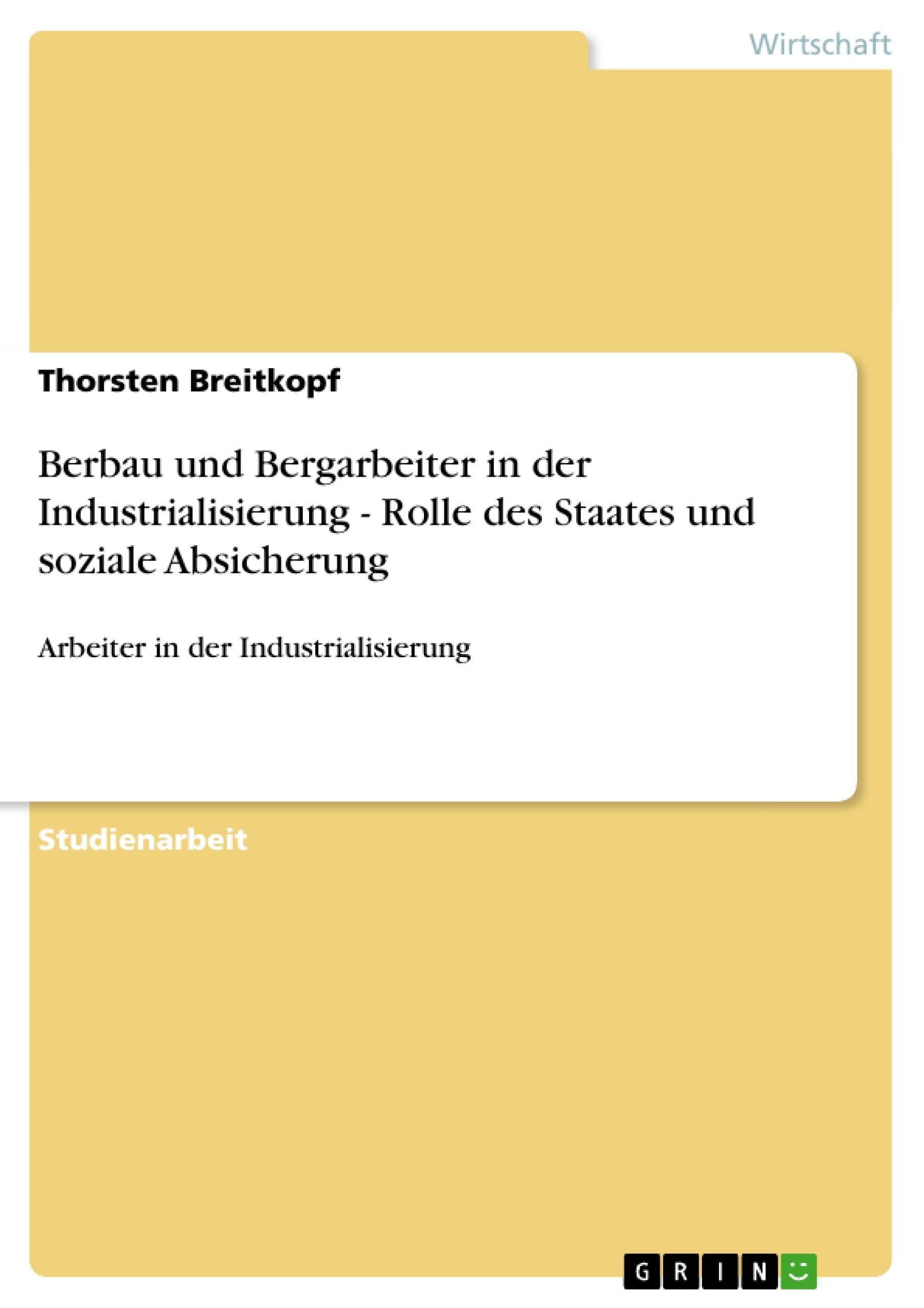1. Einleitung
1.1 Problemstellung und Stand der Forschung
Die deutsche Arbeiterschaft in der Industrialisierung ist seit Mitte der 1970er Jahre verstärkt Untersuchungsgegenstand der sog. Bielefelder Schule. Maßgeblich widmeten sich Hans- Ulrich Wehler und Jürgen Kocka der Untersuchung der Industriearbeiterschaft unter einem neuen Blickwinkel. Ihr Ansatz betrachtet vor allem die Sozial- und Mentalitätsgeschichte der Arbeiterschicht. Diese Gegenbewegung zum Historismus verzichtet weitgehend auf eine Geschichtsbetrachtung politischer Ereignisse und betont stattdessen die Bedeutung sozialstruktureller Phänomene. Ihre Vertreter lehnen die tragende Rolle von Einzelpersonen weitgehend ab oder definieren sie als gesellschaftlich bedingt. Für die Vertreter dieser Schule ist die Bergarbeiterschaft aber nur eine Gruppe unter vielen.
Herausragender Forscher auf dem Gebiet der Bergarbeiterschaft ist Klaus Tenfelde. Mit zahlreichen Publikationen zum Thema Bergarbeiter ist er tiefer als andere Historiker auf Herkunft, Lebenswandel, Mentalität und Selbstverständnis der Bergleute, insbesondere an der Ruhr, eingegangen. Bei Tenfelde ist zu beachten, dass er selbst Bergmann war, bevor er Historiker wurde. Das lässt zwar einerseits vermuten, dass er hohen bergmännischen Sachverstand besitzt und Selbstverständnis und Mentalität der Bergleute durch eigene Erfahrung nachvollziehen kann. Andererseits sind seine Äußerungen zu Unternehmern und Arbeitern, möglicherweise durch eine hohe Verbundenheit zur Bergarbeiterschaft, oft tendenziös. Bei Kocka ist durch die häufige Nennung von wertenden Begriffen wie „Kapitalismus“, „Bourgeoisie“, „liberalkapitalistische Phase des Bergbaus“ und der Verurteilung von Militarismus und Wirtschaftsliberalismus auch eine eher ablehnende Haltung gegenüber der Unternehmerschicht zu vermuten. Andere hier zitierte Werke, wie „Lohn der Mühen“1 und „Hibernia-Affäre“2, sind in ihrer Aussagekraft ebenfalls kritisch zu hinterfragen, da beide Schriften im Auftrag der IG Bergbau Chemie verfasst wurden, und somit für die organisierte Arbeitnehmerschaft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Stand der Forschung
- Überblick: Bergbau im Deutschland des 19. Jahrhunderts
- Vorabend der Industrialisierung – 1800 bis 1850
- „Take-off-Phase des Bergbaus – 1850 bis 1875
- Wandel des Bergbaus und Veränderung der Rolle des Staates
- Das Direktionsprinzip
- Bergrechtsreform und Inspektionsprinzip
- Soziale Absicherung der Bergarbeiter – die Knappschaften
- Die Knappschaften in vorindustrieller Zeit
- Verstaatlichung der Knappschaften unter dem Direktionsprinzip
- Knappschaften auf dem Weg zur gesetzlichen Sozialversicherung – Reform ab 1854
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Entwicklung des Bergbaus und der sozialen Absicherung der Bergarbeiter in der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts in Deutschland. Sie analysiert insbesondere die Rolle des Staates, die Veränderungen in der Organisation des Bergbaus und die Rolle der Knappschaften bei der Sozialversicherung der Bergarbeiter.
- Die Rolle des Staates im Bergbau und seine Veränderungen im 19. Jahrhundert
- Die Entwicklung der Knappschaften als Sozialversicherungssystem für Bergarbeiter
- Die soziale Lage der Bergarbeiter in der Industrialisierung
- Die Bedeutung des Steinkohlenbergbaus für die deutsche Industrialisierung
- Der Vergleich der Entwicklung des Bergbaus in verschiedenen Regionen Deutschlands
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und den Stand der Forschung zum Thema Bergbau und Bergarbeiter in der Industrialisierung dar. Sie erläutert die wichtigsten Forschungsansätze und die spezifischen Beiträge dieser Arbeit.
Das Kapitel „Überblick: Bergbau im Deutschland des 19. Jahrhunderts“ gibt einen Überblick über die Entwicklung des Bergbaus im 19. Jahrhundert, insbesondere im Ruhrgebiet. Es beleuchtet die Vorgeschichte des Bergbaus und die Bedeutung des Steinkohlenbergbaus für die Industrialisierung.
Das Kapitel „Wandel des Bergbaus und Veränderung der Rolle des Staates“ untersucht die Veränderungen im Bergbau und die sich wandelnde Rolle des Staates. Es analysiert das Direktionsprinzip und die Bergrechtsreform sowie das Inspektionsprinzip.
Das Kapitel „Soziale Absicherung der Bergarbeiter – die Knappschaften“ beleuchtet die Entwicklung und Organisation der Knappschaften als soziales Sicherungssystem für Bergarbeiter. Es betrachtet die Knappschaften in vorindustrieller Zeit, ihre Verstaatlichung unter dem Direktionsprinzip und den Übergang zur gesetzlichen Sozialversicherung ab 1854.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die folgenden Schlüsselthemen und -konzepte: Industrialisierung, Bergbau, Bergarbeiter, Knappschaften, soziale Absicherung, Rolle des Staates, Direktionsprinzip, Inspektionsprinzip, Ruhrgebiet, Sozialgeschichte.
- Quote paper
- Thorsten Breitkopf (Author), 2006, Berbau und Bergarbeiter in der Industrialisierung - Rolle des Staates und soziale Absicherung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84420