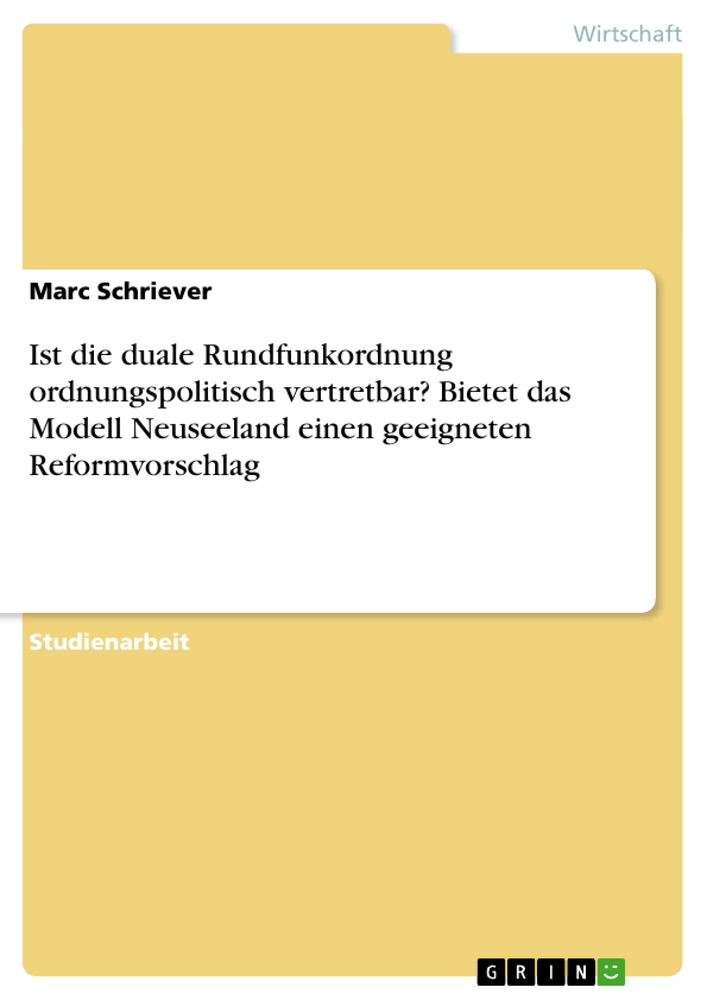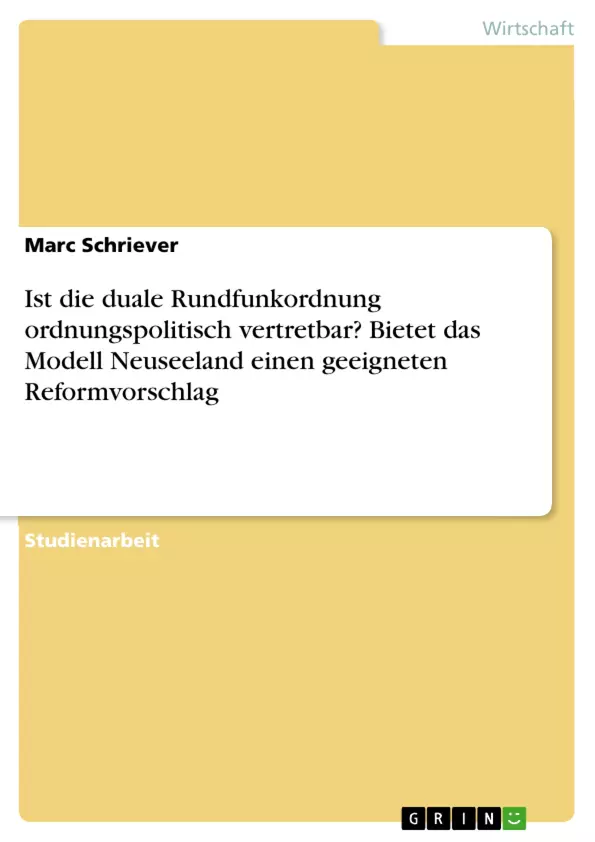Ordnungspolitik ist gekennzeichnet durch wirtschaftspolitische Regeln und staatliche Maßnahmen, welche die längerfristigen Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsprozess innerhalb einer Wirtschaftsordnung setzen. Die Ausgestaltung der Ordnungspolitik wird durch das jeweilige vorherrschende wirtschaftsordnungspolitische Leitbild beeinflusst.
Die wirtschaftspolitischen Ziele werden dabei mit Hilfe von wirtschaftspolitischen Instrumenten erreicht. Der Einsatz dieser Instrumente sollte sich im Rahmen der bestehenden Wirtschaftsordnung bewegen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit zu prüfen, ob die gewählten Instrumente mit der Ordnung übereinstimmen.
Im Rahmen der Medienpolitik ist die Rundfunkordnung ein Regelgeflecht, das als wirtschaftspolitisches Instrument bestimmte wirtschaftspolitische und gesellschaftliche Ziele erreichen soll.
Medien sind aber kein Wirtschaftsgut wie jedes andere. Die Logik des Marktes wird der politischen und gesellschaftlichen Bedeutung der Medien nicht gerecht. Von dieser Überzeugung ist die geltende Medienordnung geprägt.
Im Zuge der von technischen Neuerungen vorangetriebenen Marktdynamik auf dem Rundfunkmarkt werden tradierte institutionelle Arrangements obsolet, womit neue ordnungspolitische Herausforderungen entstehen.
Auf Grund der großen Bedeutung der Medien für unsere Gesellschaft ist die ordnungspolitische Herausforderung besonders groß und bedarf wissenschaftlicher Reflexion.
Diese Arbeit zielt somit auf eine kritische ordnungspolitische Überprüfung der bestehenden Rundfunkordnung ab. Sie zieht zudem ein alternatives Ordnungsmodell für den deutschen Rundfunkmarkt als Reformvorschlag mit in die Analyse ein.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist Ordnungspolitik, was soll in dieser Arbeit geleistet werden?
- Theoretische Basis
- Das wettbewerbspolitische Konzept der Wettbewerbsfreiheit als ordnungspolitisches Referenzbild
- Theoretische Grundlagen des Konzeptes
- Die Freiheit des Wettbewerbs
- Die ökonomische Vorteilhaftigkeit
- Die Identitätsthese
- Konsequenzen für die Wettbewerbspolitik
- Orientierungspunkt wettbewerbspolitischer Maßnahmen
- Diagnoseinstrumente von Beschränkungen der Wettbewerbsfreiheit
- Problemfeld und Lösungsansätze
- Warum Rundfunkordnung?
- Rundfunkordnung als Instrument der Medienpolitik
- Ziele und Instrumente der Rundfunkordnung
- Rundunkordnung als Ergebnis einer Sonderstellung des Rundfunkmarktes
- Öffentlich rechtlicher Rundfunk
- Privatrechtlicher Rundfunk
- Die duale Rundfunkordnung im Wandel: Vorstellung verschiedener Ordnungspolitischer Extrempositionen
- Verstaatlichung des Rundfunks
- Pay TV als Gestaltung des Fernsehmarktes
- Die jetzige duale Rundfunkordnung in der Kritik
- Der Regulierungsrahmen
- Marktversagen im Rundfunk
- Binnenpluralismus als Garant von Staats und Gruppenferne sowie publizistischer Vielfalt
- Wettbewerbsverzerrungen durch die Rundfunkgebühr
- Das Modell Neuseeland als Lösungsvorschlag
- Vorstellung des Modells
- Ordnungspolitische Bewertung
- Übertragbarkeit
- Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, die bestehende duale Rundfunkordnung in Deutschland aus ordnungspolitischer Sicht zu analysieren und zu bewerten. Dabei werden die theoretischen Grundlagen der Wettbewerbsfreiheit als ordnungspolitisches Leitbild beleuchtet und die spezifischen Herausforderungen des Rundfunkmarktes im Kontext von Medienpolitik und gesellschaftlicher Bedeutung untersucht.
- Wettbewerbsfreiheit als ordnungspolitisches Leitbild
- Herausforderungen der Rundfunkordnung im Wandel
- Kritik an der dualen Rundfunkordnung
- Das Modell Neuseeland als Reformvorschlag
- Ordnungspolitische Bewertung des Modells Neuseeland
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Dieses Kapitel erläutert den Begriff der Ordnungspolitik und stellt die Zielsetzung der Arbeit dar. Es wird betont, dass die Rundfunkordnung ein wirtschaftspolitisches Instrument ist, das bestimmte Ziele in der Medienpolitik erreichen soll.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen der Wettbewerbsfreiheit als ordnungspolitisches Referenzbild. Es werden die theoretischen Grundlagen des Konzeptes, die Freiheit des Wettbewerbs, die ökonomische Vorteilhaftigkeit und die Identitätsthese erläutert.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel analysiert das Problemfeld der Rundfunkordnung und stellt verschiedene Lösungsansätze vor. Es beleuchtet die Gründe für die Einführung einer Rundfunkordnung, die Ziele und Instrumente der Medienpolitik, die Sonderstellung des Rundfunkmarktes und die verschiedenen Modelle von öffentlich-rechtlichem und privat-rechtlichem Rundfunk.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel stellt das Modell Neuseeland als Lösungsvorschlag für die Reform der deutschen Rundfunkordnung vor. Es erläutert die wichtigsten Elemente des Modells und bewertet es aus ordnungspolitischer Sicht. Die Übertragbarkeit auf den deutschen Markt wird ebenfalls betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Ordnungspolitik im Bereich des Rundfunks, insbesondere mit der dualen Rundfunkordnung, der Wettbewerbsfreiheit und dem Modell Neuseeland. Weitere wichtige Begriffe sind Medienpolitik, Marktversagen, Binnenpluralismus, Rundfunkgebühr und Regulierungsrahmen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das ordnungspolitische Leitbild der deutschen Rundfunkordnung?
Das Leitbild ist die Wettbewerbsfreiheit, wobei die Besonderheit besteht, dass Medien aufgrund ihrer gesellschaftlichen Bedeutung nicht als rein wirtschaftliche Güter betrachtet werden.
Was versteht man unter der dualen Rundfunkordnung?
Das Nebeneinander von öffentlich-rechtlichem Rundfunk (finanziert durch Gebühren) und privatrechtlichem Rundfunk (finanziert durch Werbung oder Abonnements).
Welche Kritikpunkte gibt es an der aktuellen Rundfunkordnung?
Kritisiert werden unter anderem Wettbewerbsverzerrungen durch die Rundfunkgebühr, Marktversagen und die Frage, ob der Binnenpluralismus die Staatsferne wirklich garantiert.
Was ist das „Modell Neuseeland“ im Kontext der Rundfunkreform?
Es ist ein alternatives Ordnungsmodell, das in der Arbeit als Reformvorschlag für den deutschen Markt auf seine Übertragbarkeit und ökonomische Vorteilhaftigkeit geprüft wird.
Warum gelten für den Rundfunkmarkt Sonderregeln?
Weil Medien eine zentrale Rolle für die Meinungsbildung und Demokratie spielen, was eine rein marktlogische Steuerung als unzureichend erscheinen lässt.
- Quote paper
- Marc Schriever (Author), 2002, Ist die duale Rundfunkordnung ordnungspolitisch vertretbar? Bietet das Modell Neuseeland einen geeigneten Reformvorschlag, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8431