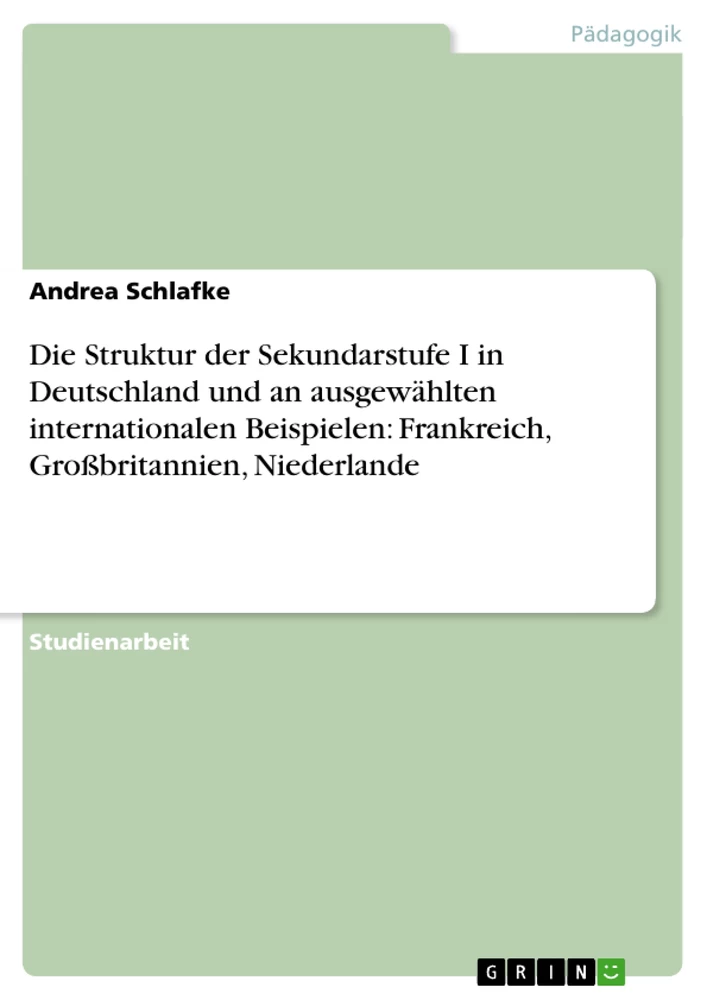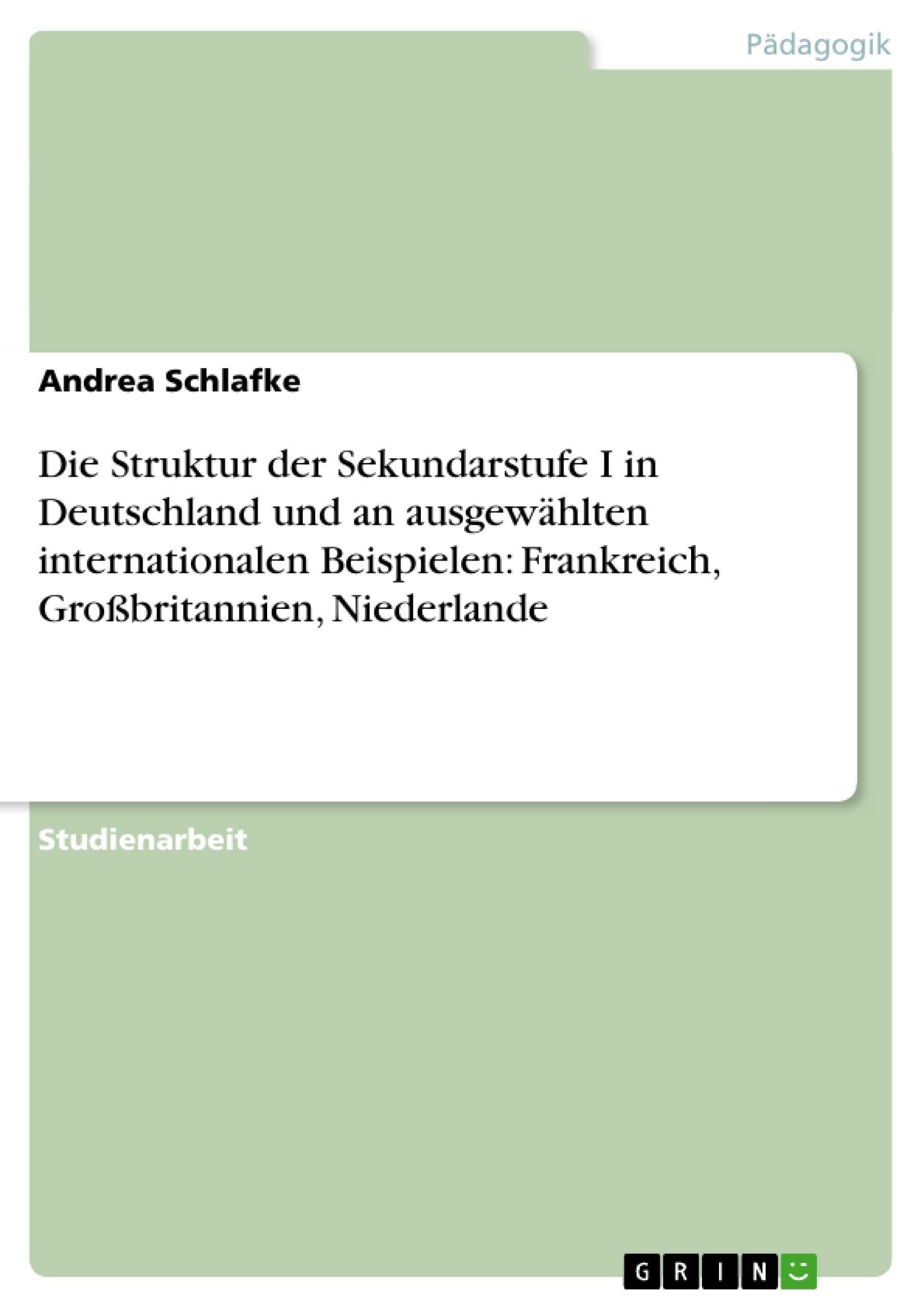„Übergänge am Anfang und am Ende der Grundschule“ – so die Bezeichnung des Hauptseminars im Wintersemester 2005 / 2006. Dieser Titel klingt recht harmlos, verbirgt aber unheimlich viele Probleme und Krisen für alle am Bildungsprozess Beteiligten. Eltern wünschen sich für ihre Kinder meist eine möglichst hohe Bildungschance, Kinder entscheiden lieber nach Freundschaften, Lehrer sehen sich rechtlichen Klagen ob ihrer Notenvergabe und den damit verbundenen Berechtigungen gegenüber ... Vielleicht mag dieses Bild ein bisschen düster gezeichnet sein, denn sicherlich gibt es genügend Fälle, in denen der Übergang vom Primar- in den Sekundarbereich I durchaus ohne
Probleme und Krisen verläuft. Aber was tut man, wenn sich angesichts des anstehenden Übergangs eine ganze Klasse – über Jahre hinweg mit gutem Sozialgefüge und dicken Freundschaften sowie einem sehr erfahrenen Lehrer ausgestattet – komplett verstreitet, und Kinder nicht mehr miteinander spielen wollen, da sie sich schon vor dem tatsächlichen Übergang in harte Gymnasium-, Realschul- und Hauptschulfronten aufgeteilt haben? Und dies stellt keinesfalls ein trübes Zukunfts- oder Medienbild dar, sondern dies wurde von einer Referentin genau so in einer kleinen, unscheinbaren Dorfschule mitten auf dem mittelfränkischen Jura erlebt - einer Schule, von der man durchaus sagen würde: „Hier ist die Welt noch in Ordnung!“ Im Folgenden möchte diese Arbeit also den Übergang zwischen Primar- und Sekundarbereich I genauer beleuchten. Dies soll zum einen auf nationaler Ebene geschehen, um sich der allgemeinen Gegebenheiten und der daraus resultierenden, sprichwörtlichen Qual der Wahl der Übergangsentscheidung gewahr zu werden. Zum anderen soll in einem zweiten großen Block der Blick auf das internationale Tableau gelenkt werden, um sowohl mögliche Übergänge wie auch die entsprechenden Strukturen auf der Ebene der Sekundarstufe unserer Nachbarländer Frankreich, Großbritannien und Niederlande zu betrachten. Dieser bildungspolitische Blick soll v.a. für Großbritannien und Frankreich durch eigene Erfahrungsberichte und -einschätzungen der jeweiligen Verfasserinnen ergänzt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Gedanken
- 1 Struktur der Sekundarstufe I in Deutschland
- 1.1 Die deutsche Sekundarstufe I – gibt es die überhaupt?
- 1.2 Historische Begründungen für fehlende Einheitlichkeit
- 1.3 Gemeinsamkeiten im deutschen Bildungssystem und auf Ebene der Sekundarstufe I
- 1.4 Unterschiede im deutschen Bildungssystem auf Ebene der Sekundarstufe II
- 1.4.1 Schulen mit einem Bildungsgang
- 1.4.1.1 Hauptschule
- 1.4.1.2 Realschule
- 1.4.1.3 Gymnasium
- 1.4.2 Schulen mit mehreren Bildungsgängen
- 1.4.2.1 Gesamtschule
- 1.4.2.2 Mittelschule
- 1.4.2.3 Sekundarschule
- 1.4.2.4 Regelschule
- 1.4.3 Freie Schulen
- 1.4.1 Schulen mit einem Bildungsgang
- 1.5 Abschließende Übersicht über die Übergangsmöglichkeiten vom Primar- zum Sekundarbereich
- 2 Struktur der Sekundarstufe I im internationalen Vergleich
- 2.1 Allgemeines
- 2.2 Ausgewählte Bildungssysteme
- 2.2.1 Frankreich
- 2.2.1.1 Struktur des Bildungssystems
- 2.2.1.2 Eigene Erfahrungen und Ergänzungen
- 2.2.2 Großbritannien
- 2.2.2.1 Struktur des Bildungssystems
- 2.2.2.2 Eigene Erfahrungen und Ergänzungen
- 2.2.3 Niederlande
- 2.2.3.1 Struktur des Bildungssystems
- 2.2.3.2 Eigene Ergänzungen
- 2.2.1 Frankreich
- 3 Die Seminarsitzung – Gedanken, Anregungen und Überlegungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beleuchtet den Übergang zwischen Primar- und Sekundarbereich I, zuerst auf nationaler Ebene, um die Gegebenheiten und die Komplexität der Übergangsentscheidung zu verdeutlichen. Ein zweiter Teil betrachtet internationale Beispiele (Frankreich, Großbritannien, Niederlande), um verschiedene Übergangsmodelle und Strukturen zu analysieren. Der letzte Abschnitt fasst die Seminardiskussion zusammen und integriert eigene Überlegungen.
- Struktur der Sekundarstufe I in Deutschland und ihre Diversität
- Historische und aktuelle Gründe für die fehlende Einheitlichkeit des deutschen Bildungssystems
- Vergleich der deutschen Sekundarstufe I mit ausgewählten internationalen Beispielen
- Übergangsprobleme und Herausforderungen im deutschen Bildungssystem
- Potentiale und Herausforderungen verschiedener Schulmodelle
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitende Gedanken: Der Text thematisiert die Herausforderungen des Übergangs zwischen Primar- und Sekundarstufe I, beschreibt ihn als krisenreich für alle Beteiligten und führt ein Beispiel für eine Klassenteilung aufgrund unterschiedlicher Schulwahl an. Die Arbeit wird die nationale und internationale Perspektive beleuchten.
1 Struktur der Sekundarstufe I in Deutschland: Dieses Kapitel untersucht die fehlende Einheitlichkeit der Sekundarstufe I in Deutschland. Es erläutert die historischen Gründe, die in der Kleinstaaterei Deutschlands und der unterschiedlichen Bildungspolitik der Besatzungszonen nach dem Zweiten Weltkrieg liegen. Trotz der föderalen Struktur werden Gemeinsamkeiten wie die Gliederung in Elementar-, Primar-, Sekundar- und tertiären Bereich und das Prinzip der vierjährigen Grundschulzeit mit anschließendem Übergang in verschiedene Sekundarschulformen genannt. Die Unterschiede werden an den verschiedenen Schulformen (Hauptschule, Realschule, Gymnasium und Schulformen mit mehreren Bildungsgängen) und deren unterschiedlichen Abschlüssen aufgezeigt.
2 Struktur der Sekundarstufe I im internationalen Vergleich: Dieses Kapitel vergleicht das deutsche System mit dem Frankreichs, Großbritanniens und der Niederlande. Es werden drei Modelle der Strukturierung der Sekundarstufe I identifiziert: ein einheitlicher Bildungsgang, die Gliederung in verschiedene Bildungszweige und ein gemeinsames Kerncurriculum. Es werden Gemeinsamkeiten wie die breit angelegte Grundbildung und ähnliche Eintrittsalter in den Sekundarbereich hervorgehoben. Die Unterschiede werden anhand detaillierter Beschreibungen der jeweiligen Bildungssysteme der drei ausgewählten Länder und durch persönliche Erfahrungen der Verfasserinnen verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Sekundarstufe I, Bildungssystem, Deutschland, Internationaler Vergleich, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, Übergang, Schulwahl, Bildungsgang, Föderalismus, Differenzierung, Integration, Chancengleichheit, Frankreich, Großbritannien, Niederlande.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Struktur der Sekundarstufe I in Deutschland und im internationalen Vergleich
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Struktur der Sekundarstufe I in Deutschland und vergleicht sie mit ausgewählten internationalen Bildungssystemen (Frankreich, Großbritannien, Niederlande). Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Übergangsmodalitäten zwischen Primar- und Sekundarstufe I und den damit verbundenen Herausforderungen.
Welche Aspekte des deutschen Bildungssystems werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die fehlende Einheitlichkeit der Sekundarstufe I in Deutschland, die historischen Gründe hierfür (Kleinstaaterei, Nachkriegszeit), die verschiedenen Schulformen (Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule etc.) und die unterschiedlichen Bildungsgänge. Sie beschreibt auch die Gemeinsamkeiten innerhalb des föderalen Systems und die Übergangsmöglichkeiten vom Primar- zum Sekundarbereich.
Welche internationalen Bildungssysteme werden im Vergleich herangezogen?
Die Arbeit vergleicht das deutsche System mit denen Frankreichs, Großbritanniens und der Niederlande. Der Vergleich konzentriert sich auf die Struktur der Sekundarstufe I und die verschiedenen Modelle des Übergangs zwischen Primar- und Sekundarstufe.
Welche Modelle der Strukturierung der Sekundarstufe I werden identifiziert?
Die Arbeit identifiziert drei Hauptmodelle: einen einheitlichen Bildungsgang, die Gliederung in verschiedene Bildungszweige und ein gemeinsames Kerncurriculum. Die jeweiligen Vor- und Nachteile werden im Kontext der untersuchten Länder diskutiert.
Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den untersuchten Bildungssystemen werden aufgezeigt?
Gemeinsamkeiten umfassen eine breit angelegte Grundbildung und ähnliche Eintrittsalter in den Sekundarbereich. Unterschiede betreffen die Organisation der Schulformen, die Differenzierung der Bildungsgänge und die Übergangsmodalitäten. Die Arbeit verdeutlicht diese Unterschiede anhand detaillierter Beschreibungen der jeweiligen Bildungssysteme und persönlicher Erfahrungen der Verfasserinnen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Sekundarstufe I, Bildungssystem, Deutschland, Internationaler Vergleich, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, Übergang, Schulwahl, Bildungsgang, Föderalismus, Differenzierung, Integration, Chancengleichheit, Frankreich, Großbritannien, Niederlande.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptkapitel: Einleitende Gedanken, Struktur der Sekundarstufe I in Deutschland und Struktur der Sekundarstufe I im internationalen Vergleich. Ein abschließendes Kapitel fasst die Seminardiskussion zusammen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Übergang zwischen Primar- und Sekundarstufe I in Deutschland zu beleuchten, seine Komplexität zu verdeutlichen und ihn anhand internationaler Beispiele zu analysieren. Sie will die verschiedenen Übergangsmodelle und Strukturen aufzeigen und die Herausforderungen und Potentiale verschiedener Schulmodelle diskutieren.
- Citar trabajo
- Andrea Schlafke (Autor), 2006, Die Struktur der Sekundarstufe I in Deutschland und an ausgewählten internationalen Beispielen: Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84277