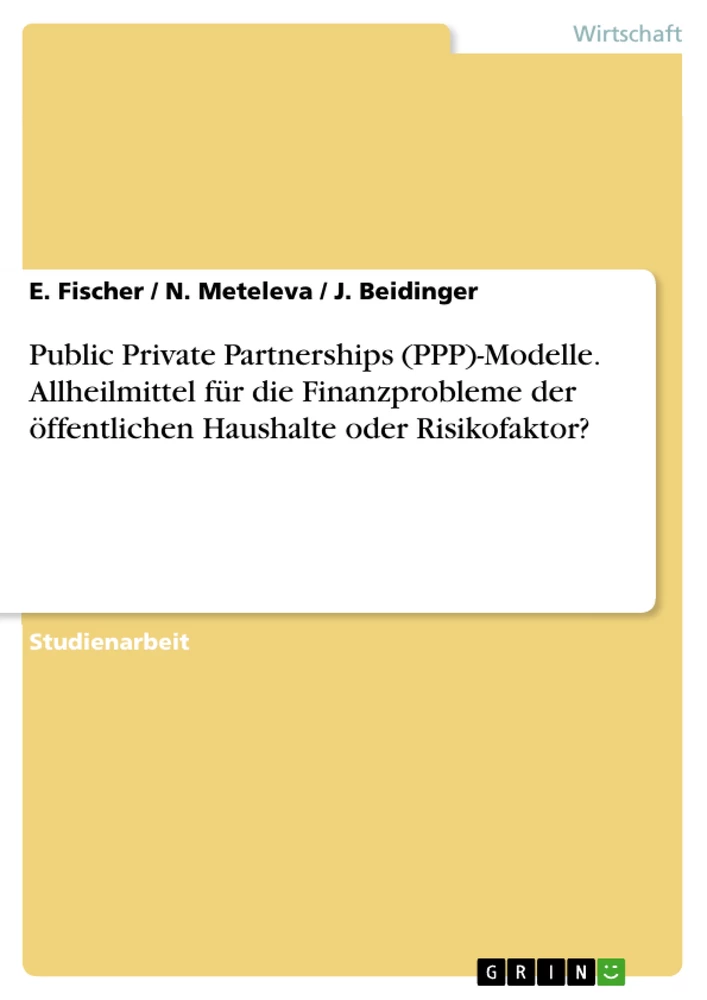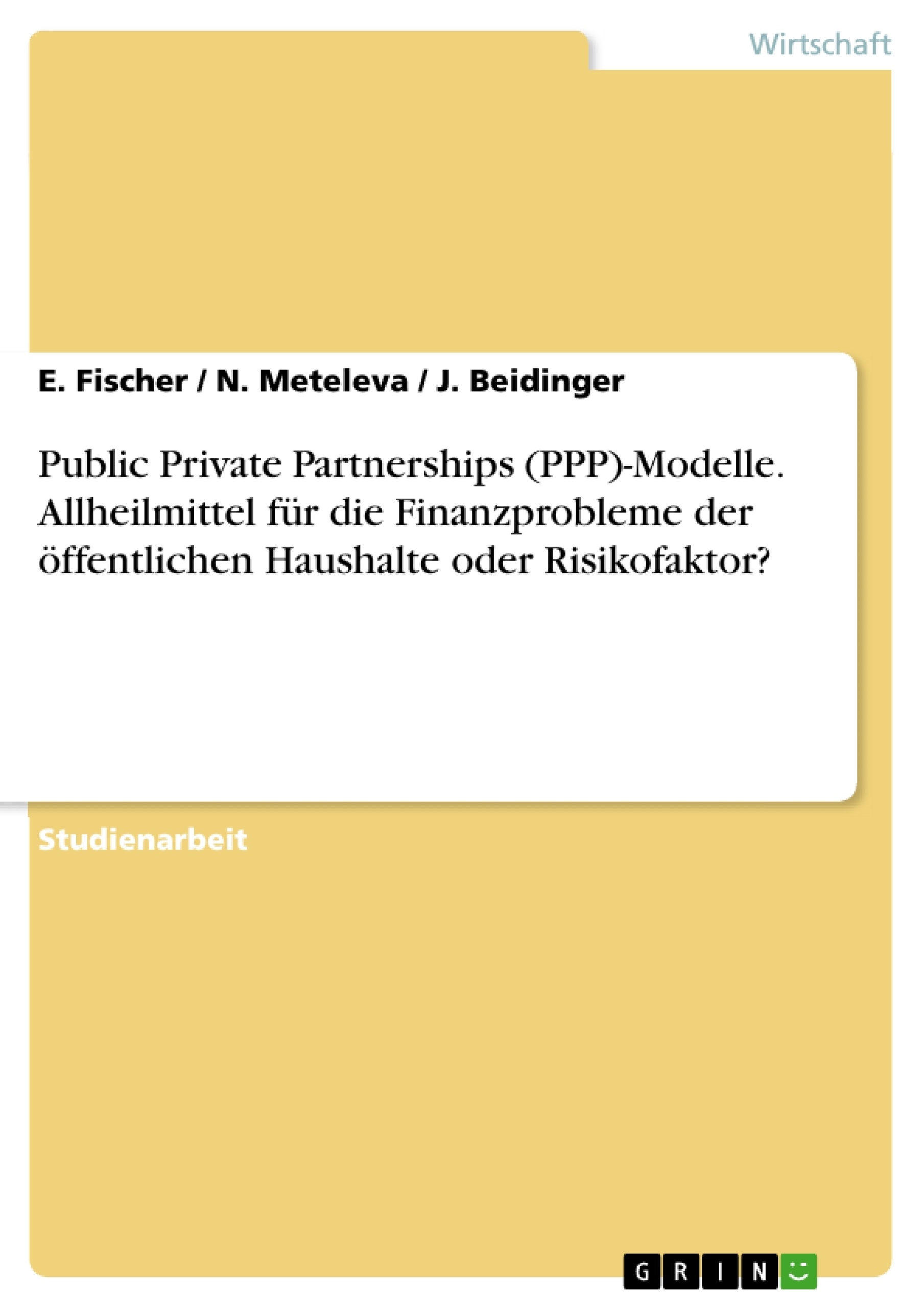Angesichts der zugespitzten Finanzlage der öffentlichen Haushalte auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene wird zunehmend diskutiert wie eine hohe Qualität der Verkehrsinfrastruktur und Daseinsvorsorge in Deutschland langfristig gesichert werden kann. Die hierzu erforderlichen Investitionen belaufen sich allen für die Kommunen in den nächsten Jahren auf mehrere hundert Milliarden Euro.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob und inwiefern durch die Einbindung privater Unternehmen Vorhaben nachhaltig wirtschaftlicher realisiert werden können. Ein Instrument zur Erreichung dieses Ziels ist PPP, das sich weltweit in vielen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge und bei der Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur bewährt hat.
Im Rahmen dieser Arbeit wird die Anwendung von PPP als Instrumentarium zur Bereitstellung öffentlicher Infrastrukturmaßnahmen –insbesondere im Hochbau und Verkehrsinfrastruktur– aufgezeigt und diskutiert.
Zu diesem Zweck wird zunächst ein Überblick über die Entstehung von PPP gegeben, eine begriffliche Abgrenzung vorgenommen und dargelegt, dass PPP eine Alternative zur konventionellen Beschaffungsform darstellt. Danach wird auf die Gründe für PPP aus der Sicht der öffentlichen Hand sowie die des privaten Sektors eingegangen. Bevor im Rahmen einer Bestandsaufnahme die im öffentlichen Hochbau und Verkehrsinfrastruktur angewandten PPP-Modelle vorgestellt werden, wird auf die wesentlichen Phasen des PPP-Beschaffungsprozesses eingegangen. Als nächstes werden möglichen Finanzierungsinstrumenten für Public Private Partnerships dargestellt. Schließlich wird die Anwendung von PPP in Deutschland Anhand von drei Beispielen aus der Praxis dargestellt. Abschließend wird eine kurze Zusammenfassung gegeben, bevor ein Ausblick die Arbeit beendet.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Begriffsverständnis
- 2.1 Entstehungen der PPP
- 2.2 Definitionssätze und Abgrenzung
- 2.3 Anwendungsfelder von PPP
- 2.4 Die Vielfalt der PPP-Projekte
- III. Gründe für PPP
- 3.1 Gründe für PPP aus der Sicht des öffentlichen Sektors
- 3.2 Gründe für PPP aus der Sicht des privaten Sektors
- IV. Der PPP- Beschaffungsprozess
- 4.1 Phase I - Voruntersuchung und Vorplanung
- 4.2 Phasen II - Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
- 4.3 Phase III Ausschreibung und Vergabe
- V. PPP-Modelle, ihre Strukturen und Anwendungsbereiche
- 5.1 PPP-Modelle für den Bereich Hochbau in Deutschland
- 5.1.1 Erwerbsmodell
- 5.1.2 Leasingmodell
- 5.1.3 Vermietungsmodell
- 5.1.4 Inhabermodell
- 5.1.5 Contractingmodell
- 5.1.6 Konzessionsmodell
- 5.1.7 Gesellschaftsmodell
- 5.2 PPP-Modelle in Bereich Verkehrsinfrastruktur
- 5.3 Zusammenfassender Überblick der verschiedenen Modelle
- 5.1 PPP-Modelle für den Bereich Hochbau in Deutschland
- VI. Kapitalquellen für PPP-Projekten
- 6.1 Finanzierungen von Projekten durch Eigenkapital
- 6.1.1 Einlage von Stammkapital
- 6.1.2 Nachrangige Gesellschafterdarlehen
- 6.1.3 Beteiligungen nach dem Investmentgesetz
- 6.1.4 Mezzanine – Kapital
- 6.2 Finanzierungen von Projekten durch Fremdkapital
- 6.2.1 Darlehensfinanzierung
- 6.2.2 Forfaitierung
- 6.2.3 Projekt-Anleihen
- 6.1 Finanzierungen von Projekten durch Eigenkapital
- VII. Beispiele aus der Praxis
- 7.1 PPP-Modell für Offenbacher Schulen
- 7.2. PPP-Modelle in Norddeutschland
- 7.2.1 Warnowtunnel in der Hansestadt Rostock
- 7.2.2 Herrentunnel in der Hansestadt Lübeck
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Public Private Partnerships (PPP) als Instrument zur Finanzierung und Realisierung öffentlicher Infrastrukturprojekte, insbesondere im Hochbau und der Verkehrsinfrastruktur. Die Arbeit analysiert die Entstehung und Definition von PPP, die Gründe für deren Anwendung aus der Sicht des öffentlichen und privaten Sektors, sowie die verschiedenen PPP-Modelle und deren Anwendung in der Praxis. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Finanzierungsmöglichkeiten solcher Projekte.
- Entstehung und Definition von Public Private Partnerships (PPP)
- Vorteile und Nachteile von PPP aus öffentlicher und privater Sicht
- Unterschiede und Anwendung verschiedener PPP-Modelle
- Finanzierungsmöglichkeiten von PPP-Projekten
- Praxisbeispiele für PPP in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der angespannten Finanzlage öffentlicher Haushalte und der Notwendigkeit, die Qualität der Infrastruktur langfristig zu sichern, ein. Sie stellt die Frage nach der Wirtschaftlichkeit der Einbindung privater Unternehmen und präsentiert PPP als mögliches Instrument. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und die zu behandelnden Punkte, beginnend mit der Entstehung von PPP und ihren Definitionen, über die Gründe für deren Anwendung, den Beschaffungsprozess und verschiedene Modelle bis hin zu praktischen Beispielen und einem Fazit.
II. Begriffsverständnis: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des PPP-Konzepts, beginnend in den USA mit der Entwicklung in Pittsburgh und der späteren Popularisierung durch Jimmy Carter. Es werden europäische Entwicklungen und der spätere Einzug des Begriffs in die deutsche Debatte um kommunale Probleme erörtert. Das Kapitel betont den Mangel an einer einheitlichen Definition und die Notwendigkeit einer Abgrenzung zu anderen Kooperationsformen zwischen öffentlichem und privatem Sektor. Die Einordnung des PPP-Konzepts in den historischen Kontext und die Herausarbeitung der unterschiedlichen Interpretationen bilden den Kern dieses Kapitels.
III. Gründe für PPP: Dieses Kapitel untersucht die Motive für die Anwendung von PPP sowohl aus der Perspektive des öffentlichen Sektors als auch des privaten Sektors. Es wird dargelegt, welche Vorteile für die öffentliche Hand (z.B. Risikoteilung, effizientere Nutzung von Ressourcen) und für private Unternehmen (z.B. lukrative Projekte, neue Geschäftsfelder) mit der Zusammenarbeit verbunden sind. Die Gegenüberstellung beider Perspektiven zeigt die komplexen und vielschichtigen Gründe auf, die zur Nutzung von PPP-Modellen führen. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf den jeweiligen Interessenlagen und wie diese durch eine PPP befriedigt werden können.
IV. Der PPP-Beschaffungsprozess: Dieser Abschnitt beschreibt die Phasen des Beschaffungsprozesses für PPP-Projekte. Er gliedert den Prozess in Voruntersuchung und Vorplanung, Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Ausschreibung und Vergabe. Die einzelnen Phasen werden detailliert dargestellt, wobei der Fokus auf den methodischen Aspekten und den zu beachtenden Schritten liegt. Der Prozess wird als ein iterativer und komplexer Ablauf präsentiert, bei dem verschiedene Akteure eng zusammenarbeiten müssen, um ein erfolgreiches PPP-Projekt zu realisieren.
V. PPP-Modelle, ihre Strukturen und Anwendungsbereiche: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über verschiedene PPP-Modelle, insbesondere im Bereich Hochbau und Verkehrsinfrastruktur. Es werden diverse Modelltypen detailliert erläutert (Erwerbsmodell, Leasingmodell, etc.) und ihre jeweiligen Strukturen und Anwendungsmöglichkeiten beschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf den Unterschieden zwischen den Modellen, ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen und wie sie an unterschiedliche Projektkontexte angepasst werden können. Der zusammenfassende Überblick am Ende des Kapitels vergleicht die verschiedenen Modelle und zeigt ihre jeweiligen Stärken und Schwächen auf.
VI. Kapitalquellen für PPP-Projekten: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Finanzierungsquellen für PPP-Projekte. Es unterscheidet zwischen Eigenkapitalfinanzierung (Stammkapital, Gesellschafterdarlehen, etc.) und Fremdkapitalfinanzierung (Darlehensfinanzierung, Projekt-Anleihen etc.). Das Kapitel erläutert die verschiedenen Finanzierungsinstrumente, deren Vor- und Nachteile und wie sie in der Praxis eingesetzt werden können. Die Komplexität der Finanzierung von PPP-Projekten und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung der Finanzierungsstrategie werden hervorgehoben.
VII. Beispiele aus der Praxis: Dieses Kapitel präsentiert praktische Beispiele für PPP-Projekte in Deutschland, darunter ein PPP-Modell für Offenbacher Schulen und PPP-Modelle in Norddeutschland (Warnowtunnel und Herrentunnel). Es wird jeweils der konkrete Projektablauf, die beteiligten Akteure und die gewählte PPP-Struktur erläutert, um die Anwendung der vorgestellten Konzepte in der Praxis zu veranschaulichen und die Vielfältigkeit der PPP-Modelle zu zeigen.
Schlüsselwörter
Public Private Partnership (PPP), Infrastrukturfinanzierung, öffentlicher Sektor, privater Sektor, Risikoteilung, Wirtschaftlichkeit, Beschaffungsprozess, PPP-Modelle, Hochbau, Verkehrsinfrastruktur, Finanzierungsinstrumente, Eigenkapital, Fremdkapital, Praxisbeispiele, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Public Private Partnerships (PPP)
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über Public Private Partnerships (PPP) als Finanzierungs- und Realisierungsinstrument für öffentliche Infrastrukturprojekte. Sie behandelt die Entstehung und Definition von PPP, die Gründe für deren Anwendung aus öffentlicher und privater Sicht, verschiedene PPP-Modelle und deren praktische Anwendung in Deutschland, sowie die Finanzierungsmöglichkeiten solcher Projekte. Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen.
Was sind die wichtigsten Themenschwerpunkte der Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich auf folgende Schwerpunkte: die Entstehung und Definition von PPP; die Vorteile und Nachteile von PPP aus öffentlicher und privater Sicht; die Unterschiede und Anwendung verschiedener PPP-Modelle; die Finanzierungsmöglichkeiten von PPP-Projekten; und Praxisbeispiele für PPP in Deutschland.
Wie wird der Begriff PPP definiert und wo liegt seine Entstehung?
Die Arbeit betont den Mangel an einer einheitlichen Definition von PPP. Sie beleuchtet die Entstehung des Konzepts in den USA (Pittsburgh, Jimmy Carter) und dessen europäische Entwicklung, sowie den Einzug des Begriffs in die deutsche Debatte um kommunale Probleme. Die Arbeit unterstreicht die Notwendigkeit einer Abgrenzung zu anderen Kooperationsformen.
Welche Gründe sprechen aus öffentlicher und privater Sicht für PPP?
Aus öffentlicher Sicht werden Vorteile wie Risikoteilung und effizientere Ressourcennutzung genannt. Aus privater Sicht locken lukrative Projekte und neue Geschäftsfelder. Die Arbeit stellt die jeweiligen Interessenlagen gegenüber und zeigt, wie diese durch PPP befriedigt werden können.
Wie sieht der Beschaffungsprozess für PPP-Projekte aus?
Der Prozess wird in drei Phasen gegliedert: Voruntersuchung und Vorplanung, Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Ausschreibung und Vergabe. Die Arbeit beschreibt die einzelnen Phasen detailliert und betont den iterativen und komplexen Ablauf sowie die Zusammenarbeit verschiedener Akteure.
Welche PPP-Modelle werden vorgestellt und wo liegen ihre Unterschiede?
Die Arbeit beschreibt verschiedene PPP-Modelle, insbesondere im Hochbau und der Verkehrsinfrastruktur (Erwerbsmodell, Leasingmodell, Vermietungsmodell, Inhabermodell, Contractingmodell, Konzessionsmodell, Gesellschaftsmodell). Der Fokus liegt auf den Unterschieden, Vor- und Nachteilen und der Anpassung an unterschiedliche Projektkontexte.
Welche Kapitalquellen stehen für die Finanzierung von PPP-Projekten zur Verfügung?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Eigenkapitalfinanzierung (Stammkapital, Gesellschafterdarlehen, Beteiligungen nach dem Investmentgesetz, Mezzanine-Kapital) und Fremdkapitalfinanzierung (Darlehensfinanzierung, Forfaitierung, Projekt-Anleihen). Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Instrumente werden erläutert.
Welche Praxisbeispiele werden in der Arbeit genannt?
Die Arbeit präsentiert Beispiele wie ein PPP-Modell für Offenbacher Schulen und PPP-Modelle in Norddeutschland (Warnowtunnel Rostock, Herrentunnel Lübeck). Der Projektablauf, beteiligte Akteure und die gewählte PPP-Struktur werden erläutert.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Zusammenhang mit PPP relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Public Private Partnership (PPP), Infrastrukturfinanzierung, öffentlicher Sektor, privater Sektor, Risikoteilung, Wirtschaftlichkeit, Beschaffungsprozess, PPP-Modelle, Hochbau, Verkehrsinfrastruktur, Finanzierungsinstrumente, Eigenkapital, Fremdkapital, Praxisbeispiele, Deutschland.
- Quote paper
- E. Fischer (Author), N. Meteleva (Author), J. Beidinger (Author), 2007, Public Private Partnerships (PPP)-Modelle. Allheilmittel für die Finanzprobleme der öffentlichen Haushalte oder Risikofaktor?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83960