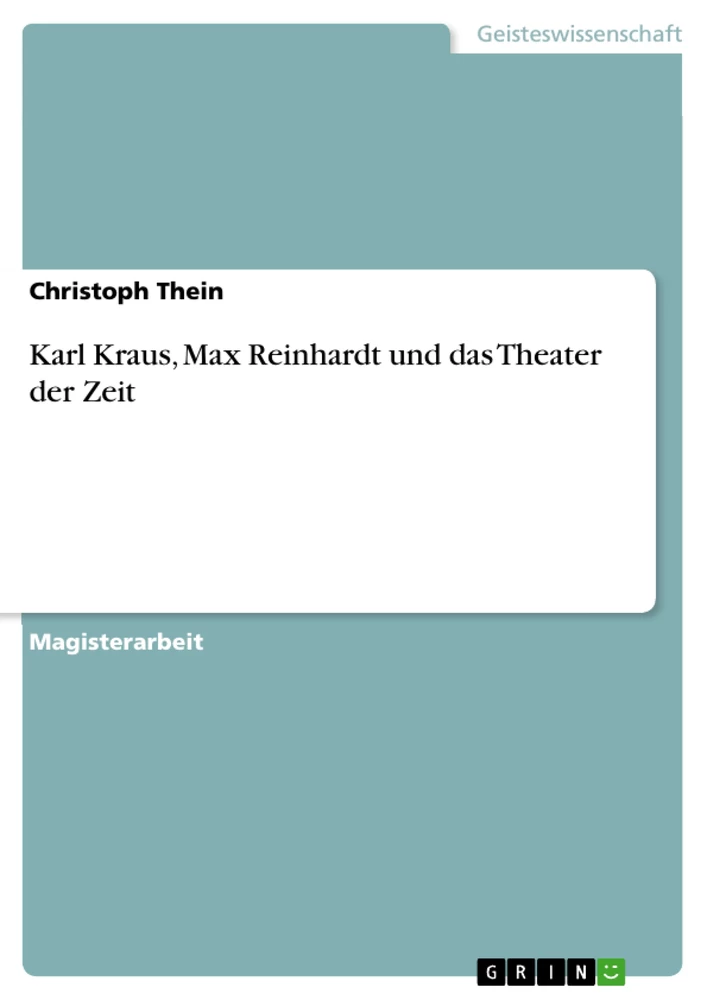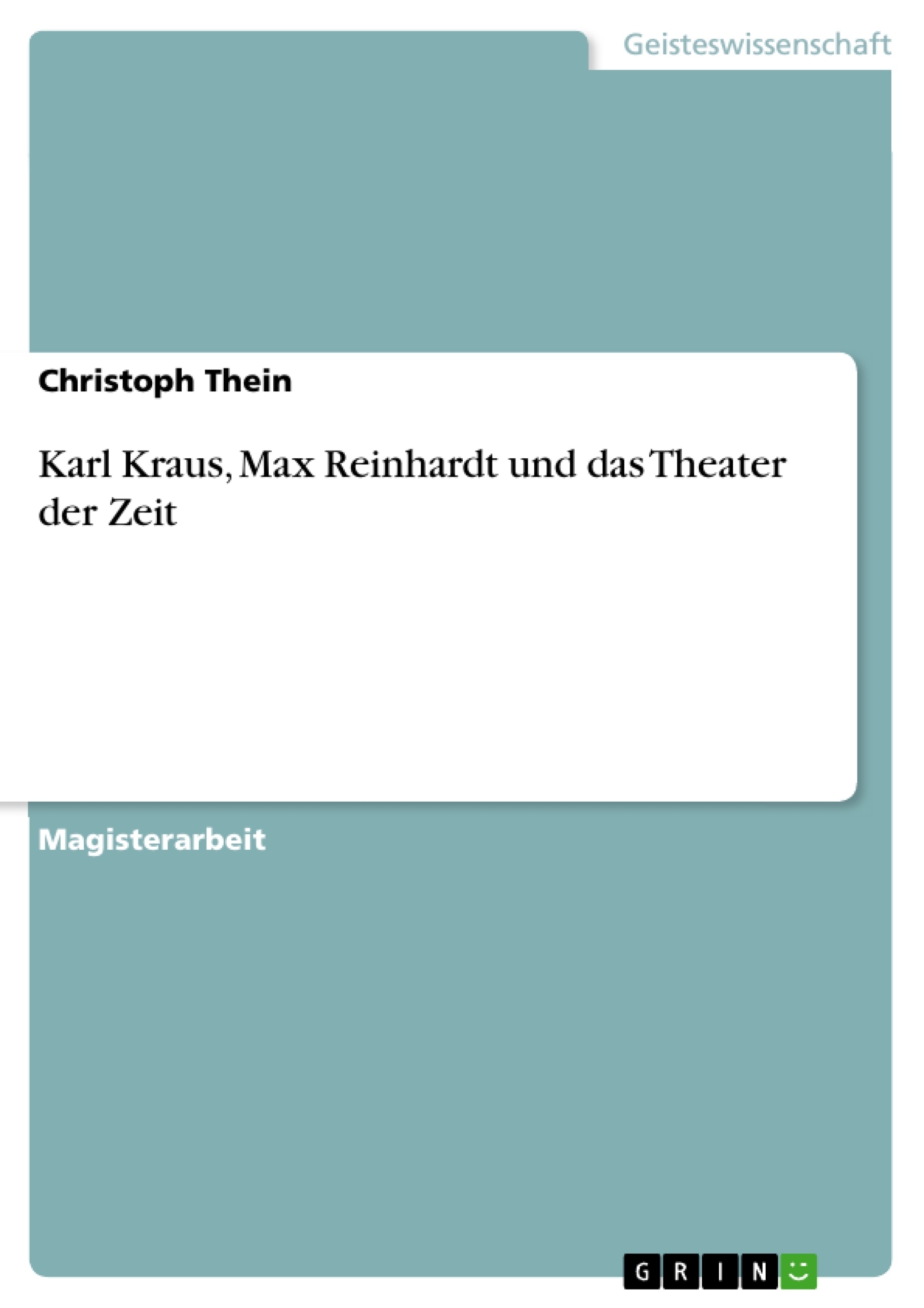Karl Kraus und Max Reinhardt, jene zwei Antipoden, über deren parallele Lebensentwicklungen und unterschiedlichen Theaterentwürfe in der theaterwissenschaftlichen Forschung bislang erstaunlich wenig gearbeitet wurde, prägten das deutsch-österreichische Theatergeschehen im frühen 20. Jahrhundert. Karl Kraus, dem von Zeitgenossen ebenso geliebten wie als „Fackelkraus“ geschmähten ‚Alleinredakteur’ der Zeitschrift „Die Fackel“ (erschienen von 1899 bis 1936) werden Verdienste vor allem im Bereich der Zeitsatire zugebilligt, ebenso in Bezug auf sein „Marstheater“-Stück „Die letzten Tage der Menschheit“. Es zeichnet sich durch eine annähernde Unaufführbarkeit aus und steht doch für eben jene Theaterästhetik, die Karl Kraus kühn und von großer Überzeugung getragen den großen Theaterentwürfen zwischen Naturalismus, Expressionismus und Regietheater entgegenstellte, dem „Theater der Dichtung“. Kraus’ Theaterentwurf, jeder ‚Magie’ der Bilder, wie sie Max Reinhardt verstand, abhold, zeugt von einem gänzlich anderen Theater- und Sprachverständnis.
Die sehr unterschiedlichen Auffassungen zweier Menschen, die fast gleichaltrig, aus einem ähnlichen Kulturkreis stammend, einst einmal sogar auf der selben Wiener Vorstadtbühne Theater spielten, werden einer Untersuchung unterzogen. Karl Kraus beschäftigte sich dezidiert mit Kulturentwicklungen seiner Zeit, legte sehr klar seine Positionen dar und grenzte sich nicht selten polemisch gegenüber anderen ästhetischen und ethischen Strömungen ab. In weit über 200 Belegstellen geht Kraus in seinen Schriften auf Max Reinhardt – als Privatmann, Unternehmer und Künstler – ein. Anhand dieses Materials läßt sich sehr genau eine fortschreitende Distanzierung über viele Jahre nachvollziehen. Die Aussagen Karl Kraus’ zu Reinhardt in der „Fackel“ werden erörtert und analysiert, die grundlegenden inhaltlichen Differenzen und Übereinstimmungen beider Positionen in der Theaterästhetik der Zeit herausgearbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Karl Kraus
- Max Reinhardt
- Das Theater der Zeit (1899-1936)
- Die Theaterauffassung Karl Kraus’
- Prägung durch das „alte Burgtheater“
- Pathos, Wort und Sprache
- Darstellerpersönlichkeiten
- Literatur und Theatertexte
- „Theater der Dichtung“
- Max Reinhardts Theatervisionen
- Stilsuche und ‚Vielheit’ der Inszenierungsstile
- Technik
- Kunst und Ökonomie
- Kraus’ Positionen zu Reinhardt im Licht der Fackel
- Frühe Nähe
- Nachvollziehen der Distanzierung
- „Defektspielerei“
- Der „schlaue Theaterkassier“
- Theaterkaufhaus Reinhardt
- Gastspiele, Expansion, Vermarktung
- Fressen „coram musis“
- Geschäftsbeziehungen
- Wien-Berliner Kulturniedergang
- „Sprechkunst“ und „Sprachkunst“
- Berlin-Wiener Gastspiele
- Reinhardt und der Weltuntergang
- Regietheater
- Kirche, Kommerz und Theater
- „Mirakel“-Proben
- Das „Mirakel-Geschäft“
- „Vom großen Welttheaterschwindel“
- „Preßburgtheater“
- Reinhardt „in Sachen Kerr“
- „Bunte Begebenheiten“
- „Goethe und Reinhardt“
- Reinhardt und Offenbach
- „Offenbach-Renaissance“
- „Offenbach-Schändungen“
- Ein „erschütternder Kontrast“ zu Reinhardt
- Offenbach im Rundfunk
- Sommernachtstraum
- Die Wirkung des „Magiers“
- Reinhardt in der Gesellschaftspresse
- Ehren und Titel
- „Was sich tut, wenn er probiert“
- Reinhardt-Notizen am Rande
- Zwei späte Reinhardt-Aufsätze
- „Die Handschrift des Magiers“
- „Der ganz große Humbug“
- Das Verhältnis von Karl Kraus zu Max Reinhardt im Kontext der Zeit
- Die Theaterästhetik Karl Kraus’ und ihre Abgrenzung zum Regietheater
- Max Reinhardts Vision von einem zeitgemäßen Schauspieltheater
- Die Polemiken Karl Kraus’ in der Fackel und ihre Bedeutung für die Theaterdebatte
- Die Rolle der Presse und der Ökonomie im Kontext des Theaterbetriebs
- Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt die beiden zentralen Figuren, Karl Kraus und Max Reinhardt, sowie ihre jeweiligen Positionen im Theatergeschehen des frühen 20. Jahrhunderts vor. Die Fackel als zentrales Dokument wird vorgestellt und die Besonderheit des Materials erläutert.
- Das zweite Kapitel beleuchtet die Theaterauffassung Karl Kraus’, indem es auf seine prägenden Einflüsse, seine Auffassung von Pathos und Sprache sowie seine Kritik an der Schauspielkunst seiner Zeit eingeht. Schließlich wird sein Konzept des „Theaters der Dichtung“ vorgestellt.
- Im dritten Kapitel werden die Theatervisionen Max Reinhardts in ihren unterschiedlichen Ausprägungen untersucht. Dabei wird auf seine Stilsuche und die „Vielheit“ seiner Inszenierungsstile, seinen Umgang mit Technik und die Verbindung von Kunst und Ökonomie eingegangen.
- Das vierte Kapitel widmet sich den vielfältigen Äußerungen Karl Kraus’ zu Max Reinhardt in der Fackel. Anhand einer chronologischen Aufarbeitung einschlägiger Belegstellen, Glossen und Aufsätze wird die Entwicklung von Kraus’ Positionen zu Reinhardt nachvollzogen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Karl Kraus und Max Reinhardt, zwei bedeutenden Persönlichkeiten des deutsch-österreichischen Theaters im frühen 20. Jahrhundert. Ziel ist es, die unterschiedlichen Theaterauffassungen der beiden Antipoden zu analysieren und anhand des umfangreichen Materials der Fackel die Entwicklung der Meinung Kraus’ über Reinhardt nachzuvollziehen.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Auseinandersetzung zwischen den beiden Theaterästhetiken, die im Kontext der Zeit durch eine starke Prägung durch die Presse und die Ökonomie gekennzeichnet war. Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen wie „Theater der Dichtung“, „Defektspielerei“, „Sprechkunst“, „Regietheater“ sowie dem „Preßburgtheater“ als Symbol für den Verfall der Kunst.
- Quote paper
- Christoph Thein (Author), 2006, Karl Kraus, Max Reinhardt und das Theater der Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83941