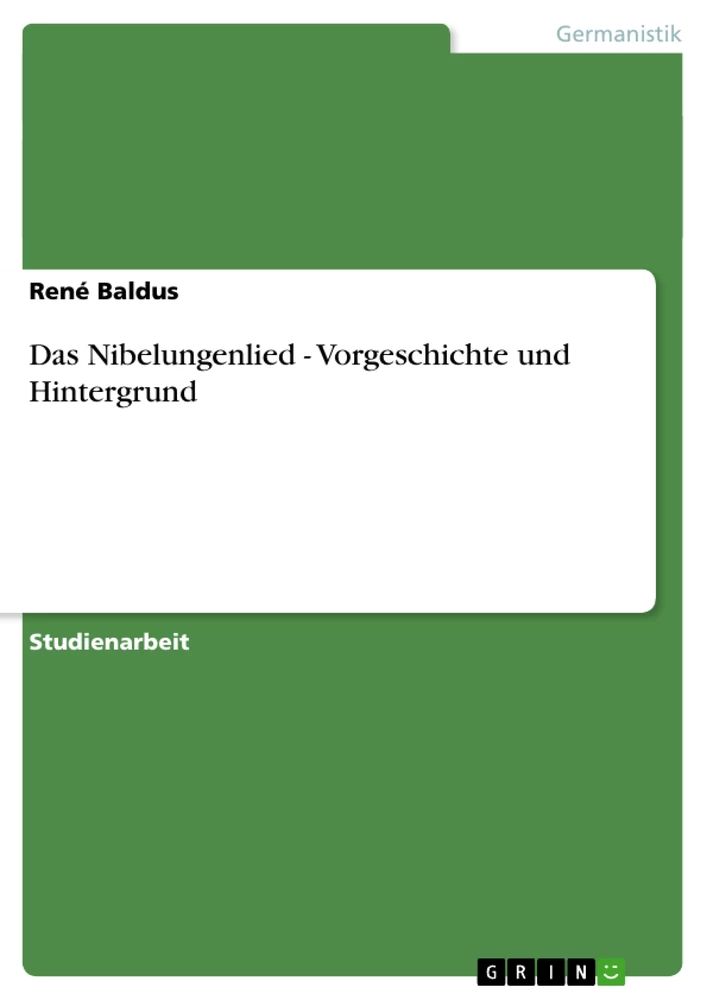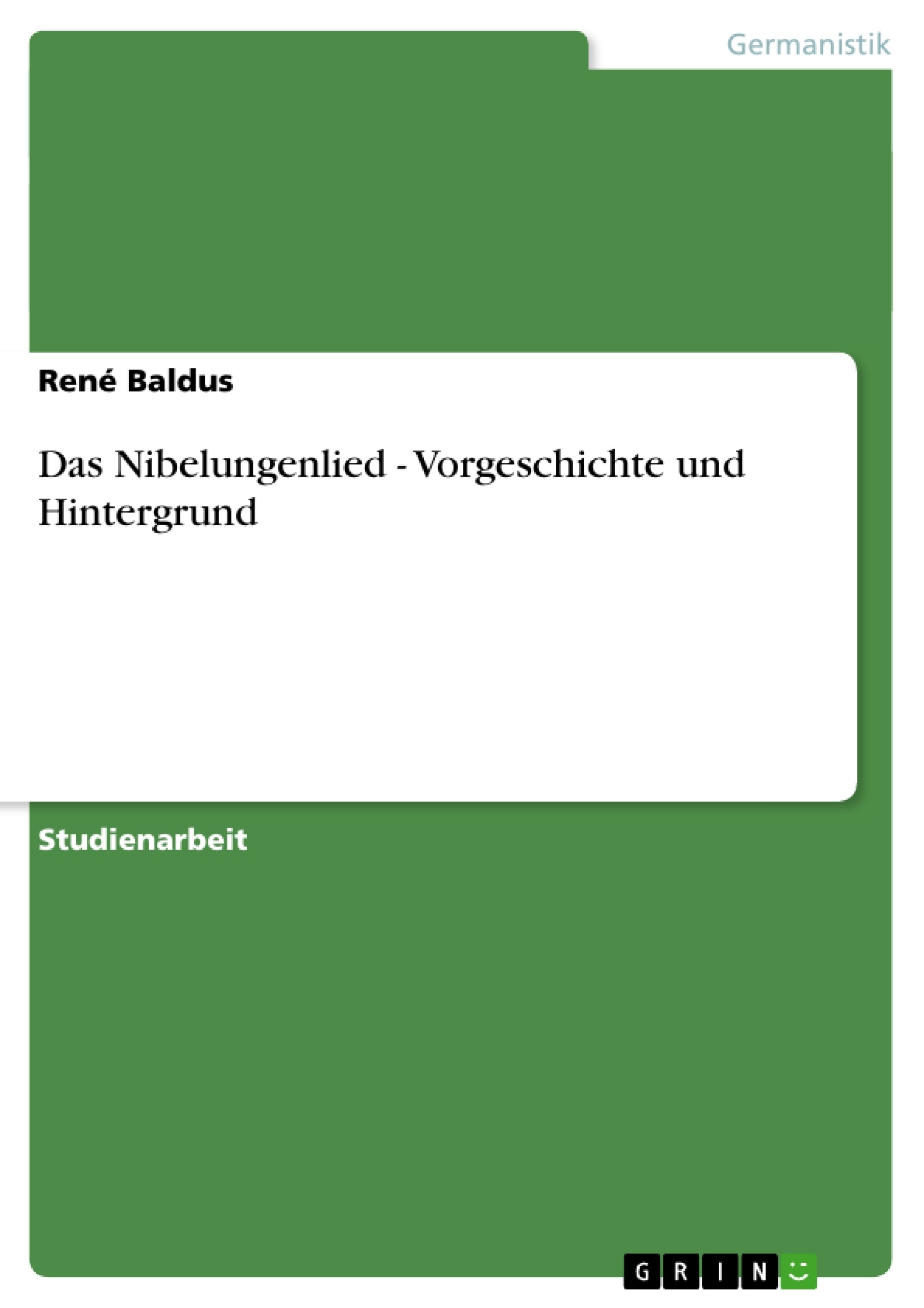Umfangreiche Arbeit, welche alle bedeutsamen Inhalte des Themas Nibelungenlied (NL) anspricht.
Es geht um Entstehungsort und -zeit (Quellen und Handschriften) sowie insbesondere um die historischen Hintergründe (u.a. Siegfiedsaga, Merowinger, Burgunder). Bezüge zu Parzival werden hergestellt und der Stammbaum des NL aufgezeigt. Die entscheidenden Akteure des NL werden skizziert. Ebenso wird die umstrittene Frage nach dem Autor angerissen. Diese Hausarbeit ermöglicht es, den Überblick für ein umfangreiches Thema zu gewinnen und ist für Laien und Fachkundige gleichermaßen gedacht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1.1 »Nibelungen«
- Die Quellen
- 2.1 Die Handschriften
- 2.2 Die Entstehung: Thesen zu Zeit und Ort
- 2.2.1 »Parzival«
- 2.2.2 Eine historische Hochzeit
- 2.2.3 Passau
- Die historischen Hintergründe
- 4.1 Teil I
- 4.2 Teil II
- Die „ewige“ Frage nach dem Autor
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Vorgeschichte und den Hintergrund des Nibelungenliedes. Ziel ist es, einen Überblick über die Entstehungsgeschichte, die Quellen und die historischen Hintergründe des Epos zu geben. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Theorien zur Entstehung und den Einfluss historischer Ereignisse.
- Die Entstehung des Nibelungenliedes: Zeit, Ort und mögliche Quellen
- Die verschiedenen Handschriften und ihre Bedeutung für die Textkritik
- Die historischen Hintergründe des Epos und ihre Interpretation
- Der Begriff "Nibelungen" und seine Bedeutung in der deutschen Sage
- Die "ewige" Frage nach dem Autor des Nibelungenliedes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Nibelungenliedes ein. Es wird die Entstehungszeit um 1200 im Donauraum (möglicherweise Passau) genannt und das Epos als mittelalterliches Heldenepos eines unbekannten Dichters beschrieben. Die Arbeit hebt die Zweiteilung des Werkes hervor: der erste Teil handelt von Siegfrieds Werbung, Heirat und Mord, der zweite von Kriemhilds Rache. Es wird auf die lange Stoffgeschichte bis in die Völkerwanderungszeit und die zahlreichen Bearbeitungen des Stoffes seit dem 18. Jahrhundert hingewiesen.
1.1 »Nibelungen«: Dieser Abschnitt beleuchtet die Bedeutung des Begriffs "Nibelungen" in der deutschen Sage. Er beschreibt die Nibelungen als ein von einem bösen Geist besessenes, elbisches Zwergengeschlecht, das einen mit Fluch behafteten Schatz, den Nibelungenhort, besaß. Der Abschnitt schildert Siegfrieds Überwindung von Alberich und die Aneignung des Namens "Nibelungen" durch Siegfried und seine Gefolgschaft, bevor der Begriff später auf die Burgunderkönige überging. Die etymologische Ableitung des Namens von "Nebel" und "Sohn des Dunkels" wird angedeutet.
2 Die Quellen: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Quellen des Nibelungenliedes. Es beschreibt die Anzahl der erhaltenen Handschriften und ihre geografische Verteilung, hauptsächlich in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz. Besondere Aufmerksamkeit wird den drei wichtigsten Handschriften (A, B und C nach Lachmanns Einteilung) gewidmet, deren Unterschiede und die damit verbundenen Debatten um die Ursprungsversion des Epos werden angesprochen.
2.1 Die Handschriften: Hier wird detailliert auf die drei Haupt-Handschriften A (Hohenemser Handschrift), B (Sankt Galler Handschrift) und C (Hohenems-Lassbergische Handschrift) eingegangen. Ihre jeweiligen Merkmale, Entstehungszeit und der Grad ihrer Abweichungen voneinander werden erläutert. Die Diskussion um die Frage nach der ursprünglichsten Handschrift und die verschiedenen Theorien von Lachmann, Holtzmann und Zarncke werden kurz dargestellt.
2.2 Die Entstehung: Thesen zu Zeit und Ort: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Theorien zur Entstehung des Nibelungenliedes, insbesondere die von Karl Bartsch. Die Thesen zur Entstehungszeit (um 1140/50) und den Bearbeitungen (1170/80) werden erörtert. Die unterschiedlichen Interpretationen und die jeweilige Einordnung der Handschriften A, B und C in diese Theorien werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Nibelungenlied, mittelalterliches Heldenepos, Handschriften, Textkritik, Entstehungsgeschichte, historische Hintergründe, Quellen, Siegfried, Kriemhild, Sage, Mythos, Völkerwanderungszeit.
Nibelungenlied: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Inhalt dieser Arbeit zum Nibelungenlied?
Diese Arbeit bietet eine umfassende Übersicht über das Nibelungenlied, inklusive Einleitung, Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselbegriffen. Sie befasst sich eingehend mit der Entstehungsgeschichte, den Quellen, den verschiedenen Handschriften und den historischen Hintergründen des Epos.
Welche Themen werden im Nibelungenlied behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie die Entstehung des Nibelungenliedes (Zeit, Ort, mögliche Quellen), die Bedeutung der verschiedenen Handschriften (A, B, C) für die Textkritik, die historischen Hintergründe des Epos und deren Interpretation, den Begriff "Nibelungen" in der deutschen Sage und die Frage nach dem Autor des Nibelungenliedes.
Wann und wo entstand das Nibelungenlied?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Theorien zur Entstehung des Nibelungenliedes, einschliesslich der von Karl Bartsch. Die Entstehungszeit wird um 1200 im Donauraum (möglicherweise Passau) vermutet. Die Arbeit diskutiert unterschiedliche Thesen zur Entstehungszeit (um 1140/50) und zu Bearbeitungen (1170/80) und die Einordnung der Handschriften A, B und C in diese Theorien.
Welche Quellen werden für das Nibelungenlied diskutiert?
Die Arbeit beschreibt die Anzahl der erhaltenen Handschriften und ihre geografische Verteilung. Besondere Aufmerksamkeit wird den drei wichtigsten Handschriften (A, B und C nach Lachmanns Einteilung) gewidmet. Ihre Unterschiede und die damit verbundenen Debatten um die Ursprungsversion des Epos werden angesprochen. Die Arbeit geht detailliert auf die Merkmale, Entstehungszeit und Abweichungen der Handschriften A (Hohenemser Handschrift), B (Sankt Galler Handschrift) und C (Hohenems-Lassbergische Handschrift) ein und diskutiert Theorien von Lachmann, Holtzmann und Zarncke.
Welche Bedeutung hat der Begriff "Nibelungen"?
Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung des Begriffs "Nibelungen" in der deutschen Sage. Es wird beschrieben, dass die Nibelungen ein von einem bösen Geist besessenes, elbisches Zwergengeschlecht waren, das einen mit Fluch behafteten Schatz, den Nibelungenhort, besaß. Siegfrieds Überwindung von Alberich und die Aneignung des Namens "Nibelungen" durch Siegfried und seine Gefolgschaft, bevor der Begriff später auf die Burgunderkönige überging, wird geschildert. Die etymologische Ableitung wird angedeutet.
Wer ist der Autor des Nibelungenliedes?
Die Arbeit spricht die "ewige" Frage nach dem Autor des Nibelungenliedes an. Es wird darauf hingewiesen, dass das Epos von einem unbekannten Dichter verfasst wurde.
Wie ist das Nibelungenlied strukturiert?
Die Arbeit hebt die Zweiteilung des Werkes hervor: der erste Teil handelt von Siegfrieds Werbung, Heirat und Mord, der zweite von Kriemhilds Rache. Es wird auf die lange Stoffgeschichte bis in die Völkerwanderungszeit und die zahlreichen Bearbeitungen des Stoffes seit dem 18. Jahrhundert hingewiesen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren das Nibelungenlied?
Schlüsselwörter sind: Nibelungenlied, mittelalterliches Heldenepos, Handschriften, Textkritik, Entstehungsgeschichte, historische Hintergründe, Quellen, Siegfried, Kriemhild, Sage, Mythos, Völkerwanderungszeit.
- Quote paper
- René Baldus (Author), 2001, Das Nibelungenlied - Vorgeschichte und Hintergrund, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8386