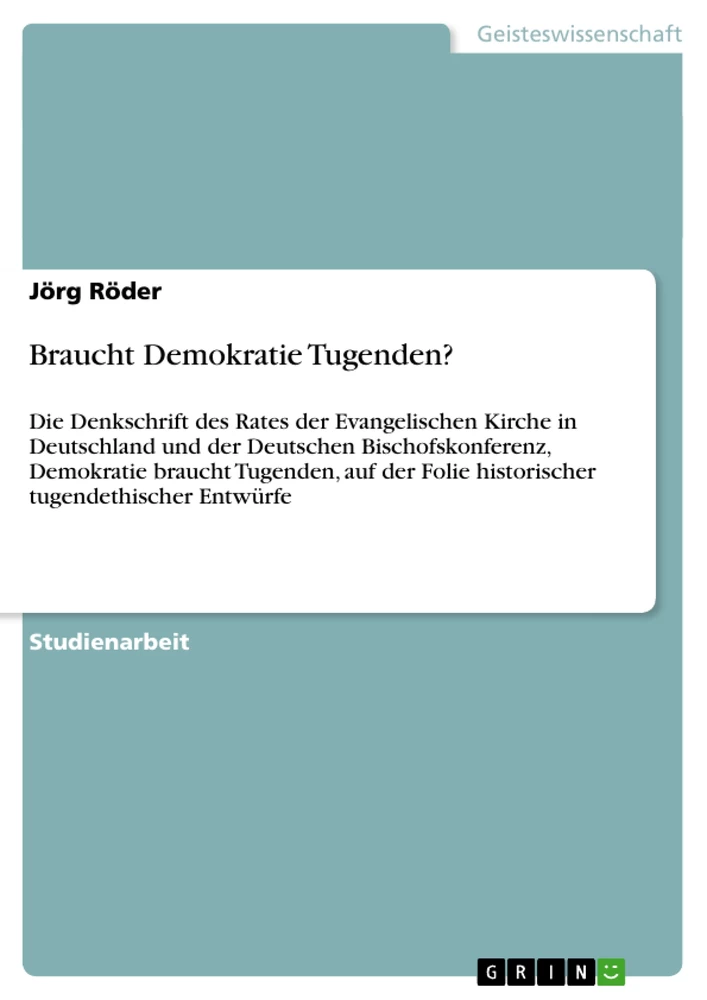Die Arbeit beschäftigt sich mit tugendethischen Ansätzen. Es werden Platon, Aristoteles und Thomas von Aquin näher beleuchtet. Im Zentrum steht die Denkschrift der evangelischen und katholischen Kirche in Deutschland "Demokratie braucht Tugenden", die kritisch diskutiert wird.
Inhaltsverzeichnis
- Tugend-,,Ein alter Hut“?
- Historische Entwürfe...
- Platon.....
- Aristoteles.......
- Thomas von Aquin
- Demokratie braucht Tugenden
- Grundkonzeption .......
- Tugenden des Bürgers und des Wählers im Besonderen
- Vorbemerkung….......
- Umsichtigkeit
- Vernunft
- Selbstverantwortung und Eigenhilfe
- Redlichkeit
- Zivilcourage
- Vertrauen und Kritikfähigkeit.
- Klugheit..
- Tugenden des Politikers
- Gewissenhaftigkeit.
- Gerechtigkeit - Gemeinwohlorientierung.
- Wahrhaftigkeit..
- Tugenden der Journalistinnen und Journalisten.
- Journalistische Wissbegier und Klugheit.
- Standfestigkeit und Mut.
- Besonnenheit.
- Tugenden der Lobbyisten: Gemeinwohlorientierung trotz Partikularinteressen
- Kritische Würdigung.
- Literaturverzeichnis.
- Quellen.
- Sekundärliteratur.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Demokratie Tugenden benötigt. Sie analysiert die Denkschrift "Demokratie braucht Tugenden" des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz vor dem Hintergrund historischer tugendethischer Entwürfe. Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung von Tugenden für eine funktionierende Demokratie zu beleuchten und Gemeinsamkeiten zwischen historischen und modernen Ansätzen zu identifizieren.
- Die historische Entwicklung des Tugendbegriffs
- Die Bedeutung von Tugenden für die Demokratie
- Die Analyse der Denkschrift "Demokratie braucht Tugenden"
- Der Vergleich zwischen historischen und modernen Konzepten von Tugenden
- Die Frage nach der aktuellen Notwendigkeit von Tugenden im demokratischen Gemeinwesen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Tugend-,,Ein alter Hut“?: Dieses Kapitel stellt die These der Denkschrift "Demokratie braucht Tugenden" vor, die einen Mangel an Tugenden im heutigen demokratischen Gemeinwesen konstatiert. Es wird erläutert, dass der Begriff Tugend eine komplexe Bedeutung hat und nicht einfach mit einem einzigen Begriff übersetzt werden kann.
- Kapitel 2: Historische Entwürfe: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Tugendbegriffs in der Antike. Es werden die Ansätze von Platon, Aristoteles und Thomas von Aquin untersucht, die als herausragende tugendethische Entwürfe bis heute gelten.
- Kapitel 3: Demokratie braucht Tugenden: Dieses Kapitel behandelt die Denkschrift "Demokratie braucht Tugenden" und untersucht, wie sie den Tugendbegriff in der Moderne weiterentwickelt. Es werden verschiedene Tugenden des Bürgers, des Wählers und des Politikers analysiert, sowie die Rolle von Journalisten und Lobbyisten in der Demokratie.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themenbereiche Tugendethik, Demokratie, Gemeinwohlorientierung, historische Entwürfe, platonisch-aristotelische Tugendlehre, Thomas von Aquin, Denkschrift "Demokratie braucht Tugenden", Bürgertugenden, Politikethik, Journalismus, Lobbyismus, und die aktuelle Notwendigkeit von Tugenden im demokratischen Gemeinwesen.
Häufig gestellte Fragen
Benötigt eine moderne Demokratie Tugenden?
Ja, die Denkschrift "Demokratie braucht Tugenden" argumentiert, dass Gesetze allein nicht ausreichen; eine Demokratie ist auf die innere Haltung und Tugendhaftigkeit ihrer Bürger angewiesen.
Welche Bürgertugenden sind für Wähler besonders wichtig?
Dazu zählen Umsichtigkeit, Vernunft, Selbstverantwortung, Redlichkeit, Zivilcourage sowie Vertrauen und Kritikfähigkeit gegenüber politischen Institutionen.
Was sind die spezifischen Tugenden eines Politikers?
Im Vordergrund stehen Gewissenhaftigkeit, Wahrhaftigkeit und eine konsequente Gemeinwohlorientierung, die über Partikularinteressen hinausgeht.
Wie unterscheiden sich historische Tugendkonzepte (Platon/Aristoteles) von modernen?
Antike Ansätze wie die von Platon oder Aristoteles fokussierten oft auf die individuelle Vollkommenheit, während moderne Konzepte die Tugend als notwendige Basis für das soziale Miteinander in einer freien Gesellschaft sehen.
Welche Rolle spielen Journalisten und Lobbyisten im Tugenddiskurs?
Journalisten benötigen Wissbegier und Standfestigkeit zur Wahrheitsfindung, während Lobbyisten trotz ihrer Interessenvertretung dem Gemeinwohl verpflichtet bleiben sollten.
- Quote paper
- Jörg Röder (Author), 2007, Braucht Demokratie Tugenden? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83664