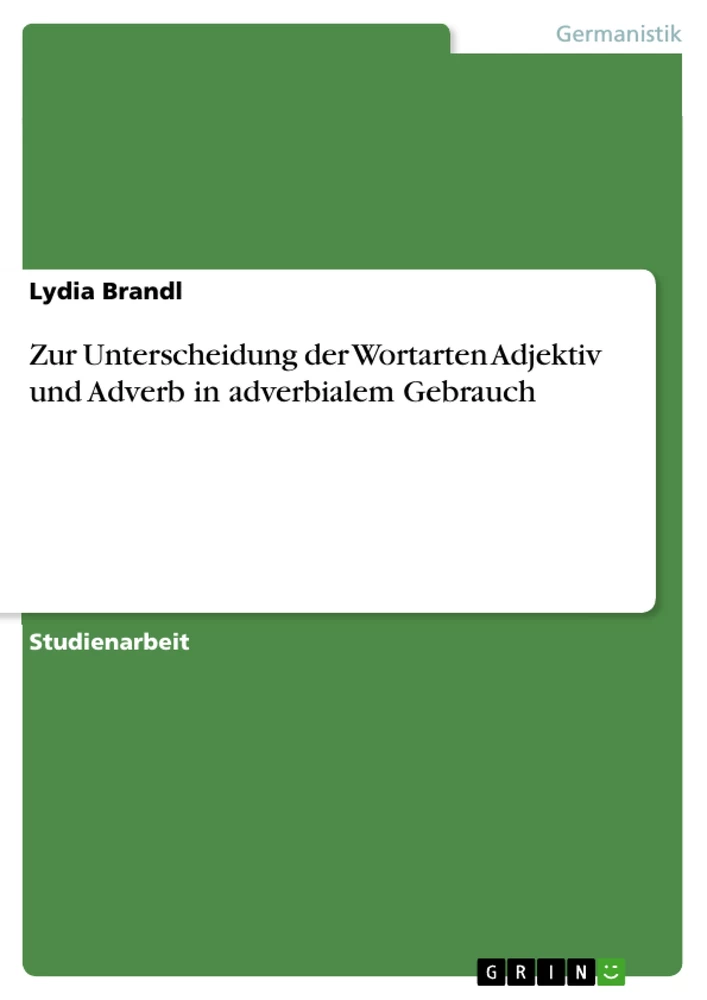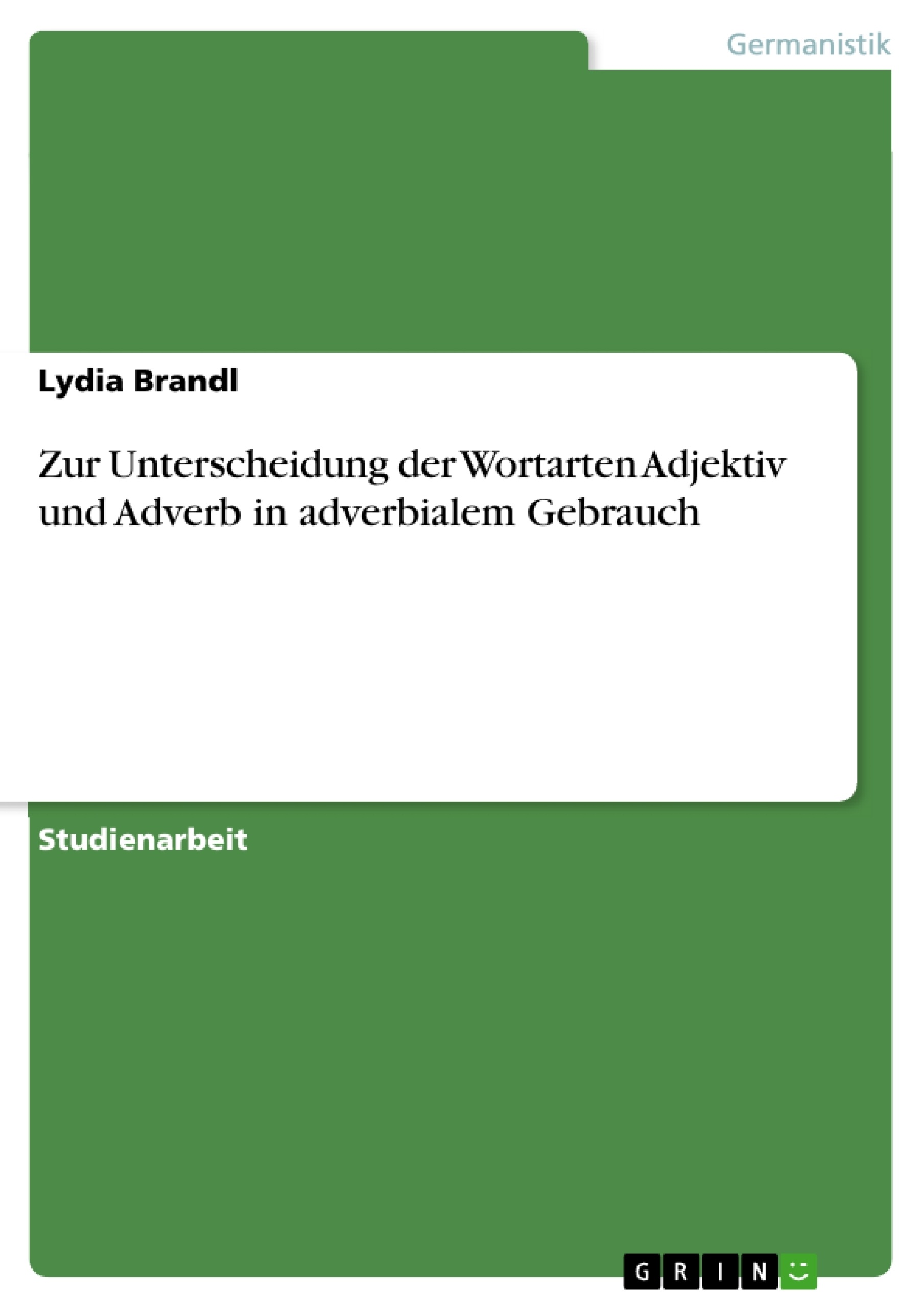Bei der näheren Beschäftigung mit der Thematik „Adverb“ stößt man auf ein Problem, das sich innerhalb der linguistischen Diskussion rund um den Gebrauch der Wortart Adverb und ihrer Abgrenzung zur Wortart Adjektiv ergibt. Alle Grammatiken sind sich darin einig, daß das Wort schnell in der Nominalphrase 'der schnelle Mann' ein Adjektiv in attributivem Gebrauch ist. Untersucht man die Einordnung des Wortes schnell im obigen Beispielsatz 'Er rennt schnell.' näher, stellt man allerdings fest, daß es ganz unterschiedliche Ansichten darüber gibt, ob es sich um ein Adverb, ein Adjektivadverb oder ein Adjektiv handelt.
Dieser Problematik wird im Folgenden nachgegangen. Um einige der Ansätze der Diskussion verstehen zu können, ist es notwendig, die historische Entwicklung des sogenannten Adjektivadverbs darzustellen. Außerdem soll ein kurzer Blick in andere Sprachen erfolgen, der weitere Fragen beantworten bzw. auch aufwerfen kann. Dann werden verschiedene Ansätze aus gebräuchlichen Grammatiken untersucht und dargestellt.
Zum besseren Verständnis wird der Begriff ‚Adjektivadverb’ im historischen Zusammenhang, in dem er begründet ist, gebraucht. Im weiteren Verlauf soll er, insofern er nicht von den einzelnen Linguisten gebraucht wird, vermieden werden. Da viele Grammatiker unterschiedliche Bezeichnungen für ein und dieselbe Sache haben, meint ‚adverbiale Stellung’ das, was der Duden darunter versteht: die Verwendung eines (der äußeren Form nach) Adjektivs an der Stelle, an der ein ‚prototypisches’ Adverb zu finden sein kann (Er rennt schnell. – Er rennt heute. – Er rennt leider. usw.).
Der Duden ist nach wie vor das Standard-Nachschlagewerk an den Schulen. Deshalb wird seine Grammatik hier besonders beleuchtet. Weiterhin kommt die Grammatik von Eisenberg zur Bearbeitung, da es sich hierbei um eine in der Linguistik empfohlene und für die Lehrerausbildung benutzte Grammatik handelt. Admoni als Vertreter der funktionalen Grammatik soll ebenfalls Beachtung finden. Da sich Eisenberg in seiner Kritik direkt auf Admoni bezieht, ist diese Betrachtung besonders interessant. Die Grammatik von Helbig/ Buscha steht ebenfalls in der Reihe der „traditionellen“ Grammatik, hat aber die Besonderheit, „ein Handbuch für den Ausländerunterricht“ (so der Untertitel) zu sein.
Natürlich hätten auch andere Grammatiken gewählt werden können. Aufgrund des eingeschränkten Umfangs der vorliegenden Arbeit muß relativ willkürlich eine Einschränkung vorgenommen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Historische Entwicklung der Adjektivadverbien im Deutschen
- 2.1 Althochdeutsch
- 2.2 Mittelhochdeutsch und Neuhochdeutsch
- 3 Adverbendungen in anderen Sprachen
- 4 Zur Darstellung der Adverb-/ Adjektivproblematik in der deutschen Grammatik
- 4.1 Duden
- 4.2 Admoni Der deutsche Sprachbau
- 4.3 Eisenberg - Grundriß der deutschen Grammatik
- 4.4 Helbig/Buscha - Deutsche Grammatik
- 5 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Problematik der Abgrenzung zwischen Adjektiven und Adverbien im adverbialen Gebrauch im Deutschen. Es wird die historische Entwicklung der sogenannten Adjektivadverbien beleuchtet und die unterschiedlichen Ansätze verschiedener deutscher Grammatiken verglichen und analysiert.
- Historische Entwicklung von Adjektivadverbien im Deutschen (Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Neuhochdeutsch)
- Vergleichende Betrachtung der Adverb- und Adjektiv-Einordnung in verschiedenen Grammatiken (Duden, Admoni, Eisenberg, Helbig/Buscha)
- Analyse der morphologischen und semantischen Aspekte adverbial gebrauchter Adjektive
- Untersuchung der Rolle von Reduktion und Apokope in der Entwicklung der Adjektivadverbien
- Einordnung des Begriffs „Adjektivadverb“ im linguistischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Problematik der Unterscheidung zwischen Adjektiv und Adverb im adverbialen Gebrauch ein. Sie verweist auf die in der linguistischen Diskussion bestehenden unterschiedlichen Ansichten zur Einordnung von Wörtern wie „schnell“ und kündigt die methodische Vorgehensweise der Arbeit an: die Untersuchung der historischen Entwicklung, den Vergleich verschiedener Grammatiken und die Analyse unterschiedlicher Ansätze zur Klassifizierung. Die Einleitung legt den Fokus auf die Notwendigkeit einer präzisen sprachwissenschaftlichen Betrachtung, da gängige Definitionen in der Praxis zu Unsicherheiten führen.
2 Historische Entwicklung der Adjektivadverbien im Deutschen: Dieses Kapitel befasst sich mit der historischen Entwicklung der Adjektivadverbien, insbesondere mit den Prozessen der Reduktion und Apokope, die zu morphologischen Veränderungen führten und die Schwierigkeiten bei der kategorialen Einordnung verursachten. Es stützt sich auf die Arbeit von Paraschkewoff, die die Adverbien in drei Gruppen unterteilt: qualitative Adjektivadverbien, erstarrte Kasusformen und zusammengesetzte Adverbien. Diese Einteilung bietet einen Rahmen zum Verständnis der komplexen Entwicklung und der Herausforderungen bei der eindeutigen Klassifizierung dieser Wortformen. Der Fokus liegt auf der Erklärung, wie morphologische Veränderungen zu den aktuellen Schwierigkeiten bei der Kategorisierung führen.
Schlüsselwörter
Adjektivadverbien, Adjektiv, Adverb, adverbialer Gebrauch, deutsche Grammatik, historische Entwicklung, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Neuhochdeutsch, Wortarten, Morphologie, Semantik, Reduktion, Apokope, Grammatikvergleich, Duden, Admoni, Eisenberg, Helbig/Buscha.
Häufig gestellte Fragen zur Abgrenzung von Adjektiven und Adverbien im Deutschen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Problematik der Abgrenzung zwischen Adjektiven und Adverbien im adverbialen Gebrauch im Deutschen. Der Fokus liegt auf den sogenannten „Adjektivadverbien“ und ihrer historischen Entwicklung sowie der unterschiedlichen Behandlung in verschiedenen deutschen Grammatiken.
Welche Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung von Adjektivadverbien vom Althochdeutschen über das Mittelhochdeutsch bis zum Neuhochdeutsch. Sie vergleicht die Ansätze verschiedener Grammatiken (Duden, Admoni, Eisenberg, Helbig/Buscha) zur Einordnung dieser Wortformen. Morphologische und semantische Aspekte adverbial gebrauchter Adjektive, die Rolle von Reduktion und Apokope, sowie die Einordnung des Begriffs „Adjektivadverb“ im linguistischen Kontext werden ebenfalls analysiert.
Welche Grammatiken werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Darstellung der Adjektiv-/Adverb-Problematik in folgenden Grammatiken: Duden, Admoni (Der deutsche Sprachbau), Eisenberg (Grundriß der deutschen Grammatik) und Helbig/Buscha (Deutsche Grammatik).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur historischen Entwicklung der Adjektivadverbien, ein Kapitel zum Vergleich der Darstellung in verschiedenen Grammatiken und eine Zusammenfassung. Die Einleitung führt in die Problematik ein und beschreibt die methodische Vorgehensweise. Das Kapitel zur historischen Entwicklung beleuchtet die Prozesse der Reduktion und Apokope. Das Kapitel zum Grammatikvergleich analysiert die unterschiedlichen Ansätze zur Klassifizierung. Die Zusammenfassung fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Rolle spielen Reduktion und Apokope?
Reduktion und Apokope sind morphologische Prozesse, die zu Veränderungen bei Adjektivadverbien führten und die Schwierigkeiten bei deren kategorialer Einordnung verursachten. Die Arbeit untersucht deren Einfluss auf die historische Entwicklung dieser Wortformen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Adjektivadverbien, Adjektiv, Adverb, adverbialer Gebrauch, deutsche Grammatik, historische Entwicklung, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Neuhochdeutsch, Wortarten, Morphologie, Semantik, Reduktion, Apokope, Grammatikvergleich, Duden, Admoni, Eisenberg, Helbig/Buscha.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine kombinierte Methodik: Sie untersucht die historische Entwicklung der Adjektivadverbien, vergleicht verschiedene grammatikalische Ansätze und analysiert morphologische und semantische Aspekte adverbial gebrauchter Adjektive.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Problematik der Abgrenzung zwischen Adjektiven und Adverbien im adverbialen Gebrauch zu untersuchen und die unterschiedlichen Ansätze verschiedener deutscher Grammatiken zu vergleichen und zu analysieren.
- Quote paper
- Lydia Brandl (Author), 2007, Zur Unterscheidung der Wortarten Adjektiv und Adverb in adverbialem Gebrauch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83449