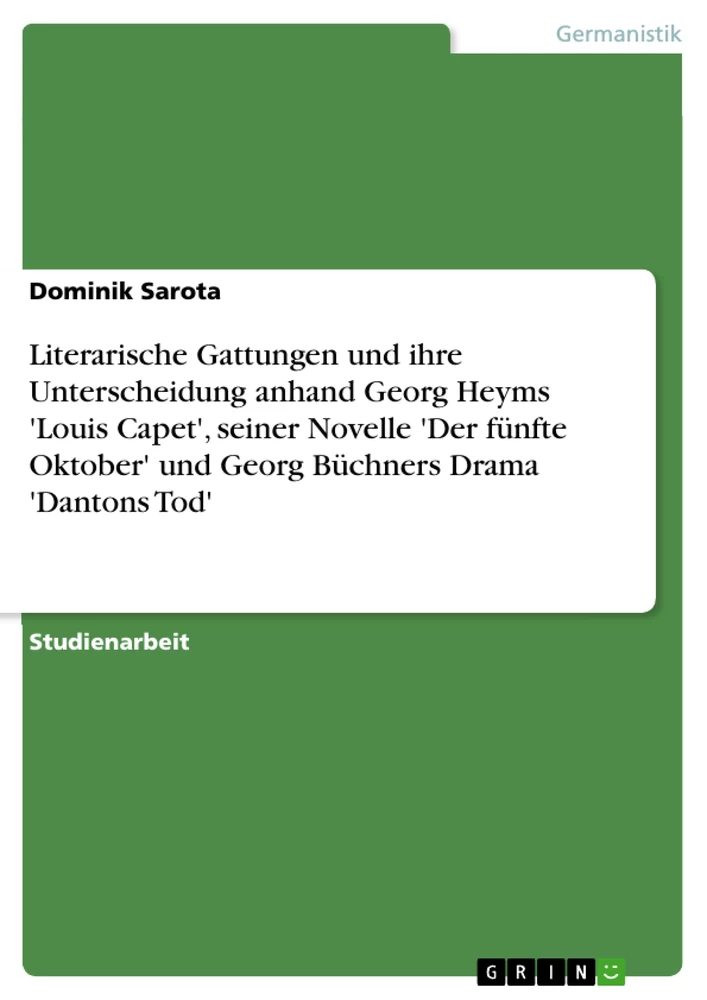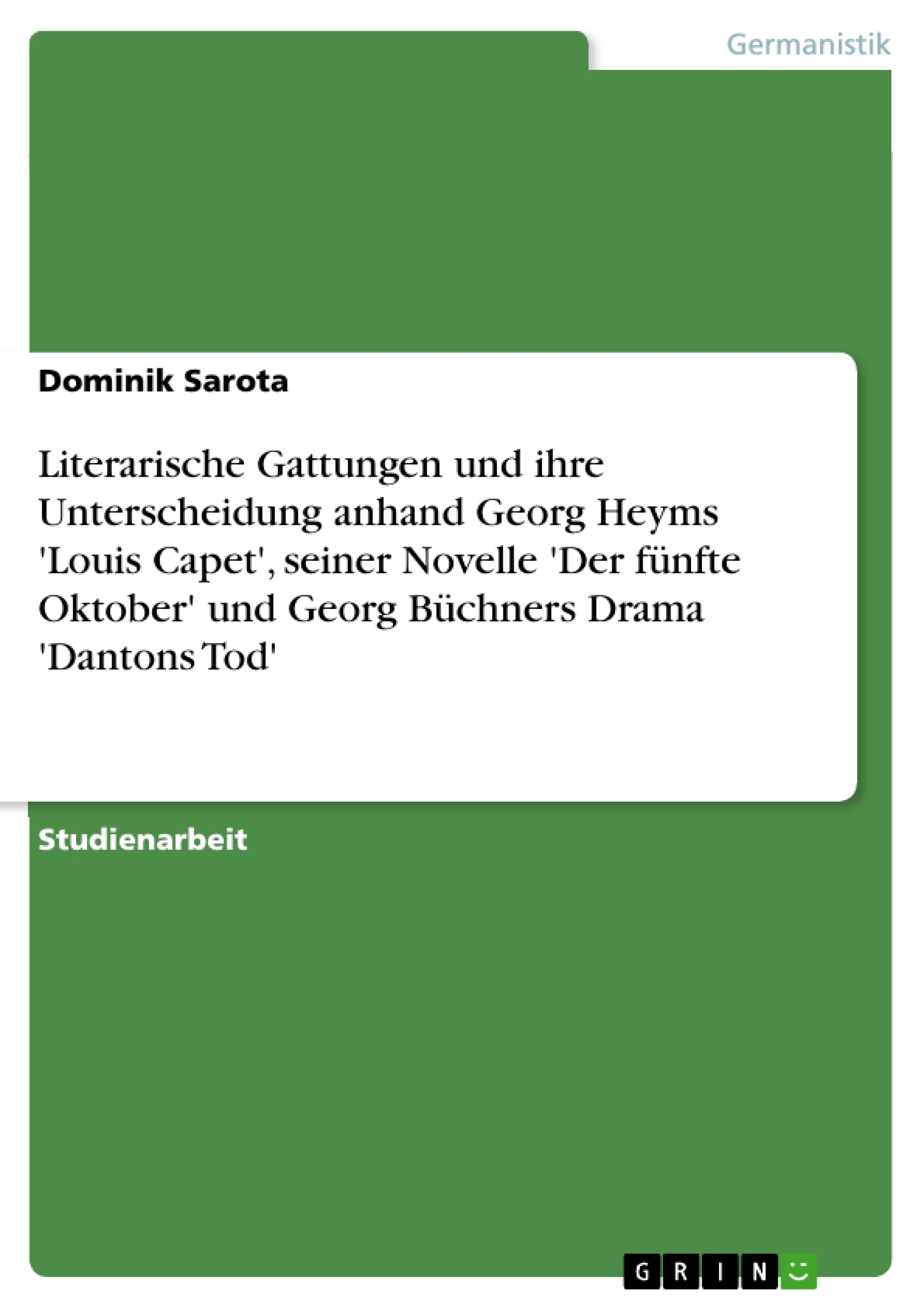Anhand von verschiedenen Textbeispielen von Georg Heym und Georg Büchner werden die Gattungsbegriffe auf anschauliche Weise explizit dargestellt und ihre Merkmale aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Intuitive Einteilung nach Gattungen
- 1.1 Intuitive Einteilung nach Gattungen
- 1.2 Beispieltext
- 1.3 Beispieltext
- 1.4 Auswertung
- 2. Literarische Gattungen
- 2.1 Was ist eine literarische Gattung?
- 2.2 Gattungstheorien
- 2.3 Geschichte der Gattungen
- 2.4 Die Goetheschen „Naturformen der Dichtung“
- 2.5 Bühlers Organon-Modell
- 3. Lyrik
- 3.1 Merkmale der Lyrik
- 3.1.1 Anwendung: „Louis Capet” von Georg Heym
- 3.2 Merkmale der Epik
- 3.2.1 Anwendung: Prosa - „Der fünfte Oktober” von Georg Heym
- 3.3 Merkmale der Dramatik
- 3.3.1 Anwendung: „Dantons Tod” von Georg Büchner
- 4. Wobei hilft die Einteilung in Gattungen? Neue Ansätze zur Gattungstheorie
- 5. Bewertung und Selbsteinschätzung des Problems
- 6. Literatur
- 7. Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel dieser Arbeit ist die Beantwortung der Frage nach der Existenz und den Unterscheidungsmerkmalen literarischer Gattungen. Die Arbeit untersucht, ob ein intuitives Verständnis für Gattungen existiert und wie dieses Verständnis in ein wissenschaftliches erweitert werden kann. Zusätzlich wird die These geprüft, ob Gattungen ein geschlossenes System bilden, welches die gesamte Literatur abdeckt.
- Intuitive und wissenschaftliche Gattungserkennung
- Unterscheidungskriterien literarischer Gattungen (Epik, Lyrik, Dramatik)
- Analyse von Gattungstheorien
- Die Frage nach einem geschlossenen System der Gattungen
- Anwendung der Gattungstheorie an Beispieltexten
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung führt die zentrale Fragestellung der Arbeit ein: die Existenz und die Unterscheidungsmerkmale literarischer Gattungen. Sie formuliert das Ziel, sowohl die grundsätzliche Frage nach dem Vorhandensein von Gattungen zu beantworten, als auch anhand von Beispielen deren Unterschiede aufzuzeigen. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und betont die Bedeutung des intuitiven Gattungswissens als Ausgangspunkt der wissenschaftlichen Untersuchung.
1. Intuitive Einteilung nach Gattungen: Dieses Kapitel demonstriert die intuitive Zuordnung von Textbeispielen zu den Gattungen Epik, Lyrik und Dramatik. Es zeigt, dass auch ohne explizite Kenntnisse der Gattungstheorie eine Zuordnung möglich ist. Der Leser wird durch die Beispiele dazu angeregt, seine eigenen intuitiven Kategorien zu reflektieren und diese mit den wissenschaftlichen Konzepten zu vergleichen. Die Ausführungen von András Horn zum intuitiven Gattungswissen untermauern die These einer vorwissenschaftlichen, erfahrungsbasierten Gattungserkennung.
2. Literarische Gattungen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs „literarische Gattung“ und verschiedenen Gattungstheorien. Es beleuchtet die historische Entwicklung des Gattungskonzepts sowie die Modelle von Goethe und Bühler. Es dient als theoretischer Hintergrund für die Analyse der Beispieltexte und die Beantwortung der zentralen Forschungsfrage. Dieser Abschnitt bildet die Brücke zwischen der intuitiven und der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema.
3. Lyrik, Epik, Dramatik: Dieses Kapitel analysiert die Merkmale der einzelnen Gattungen Lyrik, Epik und Dramatik anhand von Beispieltexten. Es wird gezeigt, wie sich diese Gattungen durch spezifische Merkmale wie Reim, Metrum (Lyrik), Erzählperspektive (Epik) und Dialogstruktur (Dramatik) unterscheiden. Die Anwendung der Theorie auf die ausgewählten Beispiele von Georg Heym und Georg Büchner verdeutlicht die praktische Anwendung der vorgestellten theoretischen Konzepte.
4. Wobei hilft die Einteilung in Gattungen? Neue Ansätze zur Gattungstheorie: Dieses Kapitel setzt sich kritisch mit der Einteilung in Gattungen auseinander und diskutiert neue Ansätze der Gattungstheorie. Es hinterfragt das Konzept des geschlossenen Systems und diskutiert potenzielle Grenzen und Erweiterungsmöglichkeiten der traditionellen Gattungskategorien.
Schlüsselwörter
Literarische Gattungen, Epik, Lyrik, Dramatik, Gattungstheorien, Goethe, Bühler, Georg Heym, Georg Büchner, intuitive Gattungserkennung, wissenschaftliche Gattungsanalyse, Textanalyse, Literaturwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Analyse Literarischer Gattungen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Existenz und Unterscheidungsmerkmale literarischer Gattungen. Sie befasst sich mit der Frage, ob ein intuitives Verständnis für Gattungen existiert und wie dieses in ein wissenschaftliches Verständnis erweitert werden kann. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage, ob Gattungen ein geschlossenes System bilden, welches die gesamte Literatur abdeckt.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist die Beantwortung der Frage nach der Existenz und den Unterscheidungsmerkmalen literarischer Gattungen. Die Arbeit untersucht sowohl die intuitive als auch die wissenschaftliche Gattungserkennung und analysiert verschiedene Gattungstheorien. Sie wendet diese Theorien auf konkrete Beispieltexte an.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: intuitives und wissenschaftliches Gattungswissen, Unterscheidungskriterien literarischer Gattungen (Epik, Lyrik, Dramatik), Analyse von Gattungstheorien (Goethe, Bühler), die Frage nach einem geschlossenen System der Gattungen und die Anwendung der Gattungstheorie an Beispieltexten.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Intuitive Einteilung nach Gattungen, Literarische Gattungen, Lyrik, Epik, Dramatik (mit Beispieltextanalysen von Georg Heym und Georg Büchner), Wobei hilft die Einteilung in Gattungen? Neue Ansätze zur Gattungstheorie, Bewertung und Selbsteinschätzung des Problems, Literaturverzeichnis und Bibliographie.
Welche Beispieltexte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert „Louis Capet” von Georg Heym (Lyrik), „Der fünfte Oktober” von Georg Heym (Prosa/Epik) und „Dantons Tod” von Georg Büchner (Dramatik), um die Merkmale der jeweiligen Gattungen zu veranschaulichen.
Welche Gattungstheorien werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die „Goetheschen „Naturformen der Dichtung“ und Bühlers Organon-Modell als wichtige theoretische Ansätze zur Klassifizierung literarischer Gattungen.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Literarische Gattungen, Epik, Lyrik, Dramatik, Gattungstheorien, Goethe, Bühler, Georg Heym, Georg Büchner, intuitive Gattungserkennung, wissenschaftliche Gattungsanalyse, Textanalyse, Literaturwissenschaft.
Was ist das Ergebnis der intuitiven Gattungserkennung im ersten Kapitel?
Das erste Kapitel zeigt, dass selbst ohne explizite Kenntnisse der Gattungstheorie eine intuitive Zuordnung von Textbeispielen zu den Gattungen Epik, Lyrik und Dramatik möglich ist. Dies wird durch die Analyse von Beispieltexten und die Bezugnahme auf die Forschung von András Horn belegt.
Wie werden die Gattungen Lyrik, Epik und Dramatik unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet die Gattungen anhand spezifischer Merkmale: Lyrik durch Reim, Metrum etc., Epik durch Erzählperspektive etc., und Dramatik durch Dialogstruktur etc. Diese Merkmale werden an den Beispieltexten erläutert.
Wie wird das Konzept eines geschlossenen Systems von Gattungen behandelt?
Die Arbeit hinterfragt kritisch das Konzept eines geschlossenen Systems von Gattungen und diskutiert neue Ansätze in der Gattungstheorie, die über die traditionellen Kategorien hinausgehen.
- Quote paper
- Dominik Sarota (Author), 2000, Literarische Gattungen und ihre Unterscheidung anhand Georg Heyms 'Louis Capet', seiner Novelle 'Der fünfte Oktober' und Georg Büchners Drama 'Dantons Tod', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83342