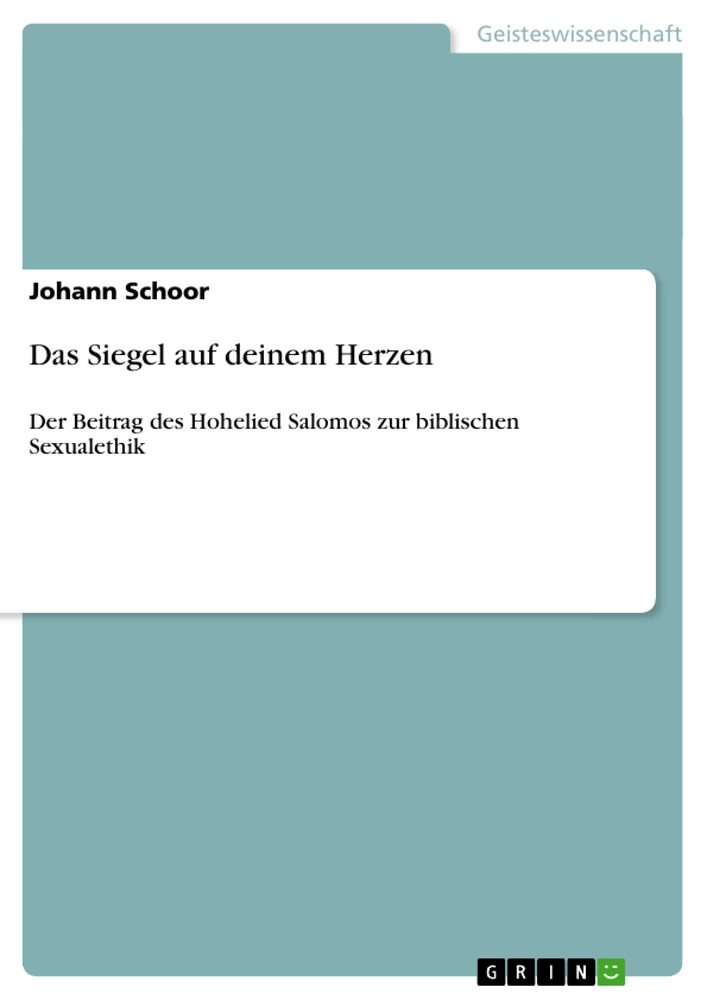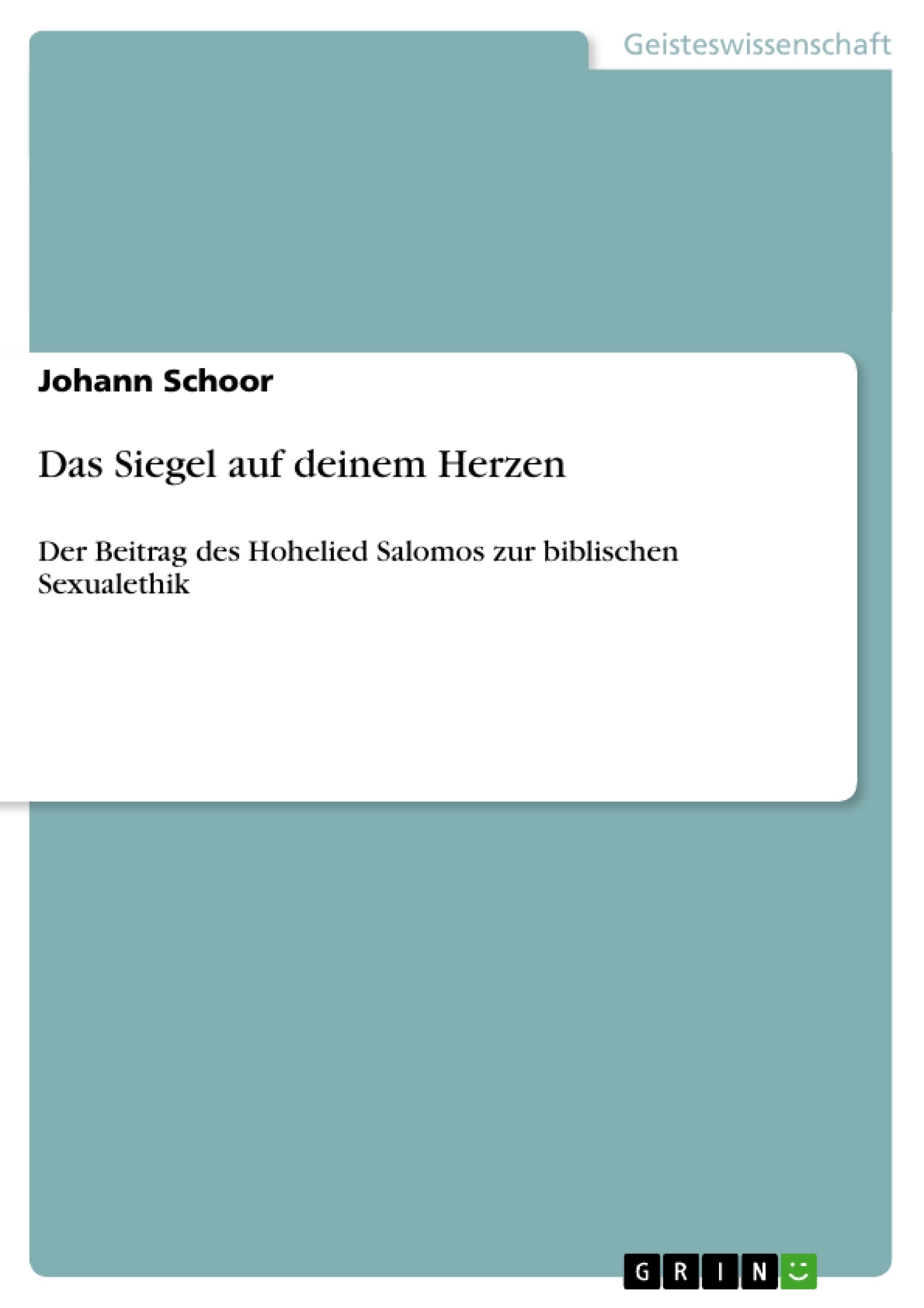Das Hohelied der Liebe im Alten Testament, von König Salomon, ist eines der rätselhaftesten Texte in der Bibel.
Der Autor geht von der sogenannten Hirtentheorie aus, welche besagt, dass es sich im Text des Hoheliedes um 3 Personen handelt: 1. Um den König Salomo, 2. um das Mädchen Sulamith und 3. um einen namentlich unbekannten Freund dieses Mädchens, einen Hirten. Es ist in der Form eines Liebesliedes geschrieben, das die Handlung der Lovestory in sich verbirgt, weil sie den Menschen damals ohnehin bekannt gewesen sein dürfte.
Im Vorfeld wird auch darauf eingegangen, was für diese These spricht und warum es in der christlichen Tradition oft nicht verstanden wurde. Eine wichtige Rolle spielte dabei Augustinus und der Einfluss der griechischer Philosophien in de Patristik. Die Allegorische Deutung des Hoheliedes griff allerdings auch im Judentum um sich und führte hier zu einer Anwendung auf das Verhältnis des Jahwes zu seinem Gottesvolkes.
Die Rekonstruktion der eigentlichen Geschichte, die hinter dem Liebes- oder Hochzeitslied steht, schafft wieder einen freien Blick auf die Sexualethik der Zeit des König Salomos, die durchaus ambivalent war. Während der König sich Polygam zeigte, war im Volk die dauerhafte Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen verankert. Dieses Ideal ehrt der König in seinem Lied in einer einzigartig lyrischen Weise. Auch sonst finden wir in Salomos Schriften (Sprüche, Kohelet) die Monogamie als favorisierte Form der Lebensgemeinschaft, die er selber jedoch nicht pflegen konnte oder wollte.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
I. Konig Salomos Hohelied der Liebe
II. Die Personen und die Handlung
III. Biblische Sexualethik im Kontext der Zeiten
IV Nachwort
Einleitung
Das Konigreich in dem die Geschichte spielte war noch keine 100 Jahre alt. Der Beginn dieses Reiches war, wie bei entstehenden Konig- reichen ublich, blutig. Innere und aufiere Feinde bedrangten es, ver- scharft wurde die Situation dadurch, dass sich der erste Konig durch sein reHgioses Fehlverhalten disqualifizierte. Er wurde von demselben Priester abgesetzt, der ihn im Namen Gottes zum Herrscher gesalbt hatte. Da er aber nicht Ireiwillig auf den Thron verzichtete, folgte eine lange Zeit der inneren Auseinandersetzung mit seinem Nachfolger. Dessen Besonnenheit war es zu verdanken, dass die Situation nicht in einen Burgerkrieg eskalierte. Eine Anderung der Verhaltnisse trat erst ein, als der Konig bei einer Schlacht, wahrend eines Krieges mit dem Erzfeind des Landes, urns Leben kam. Der Nachfolger wurde vom Volk schnell akzeptiert, hatte er sich doch bereits wahrend seiner Zeit auf der Flucht und im Exil sehr beliebt gemacht. Die neugewonnene Einigkeit machte das Land und seinen Herrscher stark. Obwohl eine Zeit langer Kriege mit den verschiedensten Nachbarlandem folgte, wurde das Reich dennoch gefestigt und erlebte sowohl politisch als auch wirtschaftlich einen ungeheuren Aufschwung.
Als der zweite Konig starb, trat sein Sohn die Nachfolge an. Er musste nur mehr selten zum Schwert greifen. In seiner Zeit entfal- tete das Land einen weltweit noch nicht dagewesenen kulturellen Reichtum, gegrundet auf die uberlieferte Religion des Landes, dessen Mittelpunkt der neu errichtete Tempel fur den einzigen wahren Gott, den Schopfer Himmels und der Erde war.
Dieser dritte Konig des Landes, dessen Reichtum ebenso weltweit geruhmt wurde, wie seine sprichwortliche Weisheit, war nun ein Herrscher, der sich sehr fur schone Frauen interessierte. Er schaffte sich einen Harem an, in dem die schonsten Madchen aus aller Her- ren Lander zu finden waren. Weit uber 1000 Frauen standen ihm schliefilich zur Verfugung, und als er alt war, wurde ihm dies auch zum Verhangnis. Er konnte diese Frauen nicht fur die Religion seines Landes gewinnen und gab ihnen schliefilich nach, indem er seinen Frauen eigene Kultstatten baute, damit sie die religiosen Brauche ihrer Herkunftslander pflegen konnten. So versundigte er sich gegen seinen eigenen Gott.
Was fur ein Mensch musste dieser Konig gewesen sein, der sich eine solche Menge Frauen um Ihrer Schonheit willen hielt? Er konnte doch keine echte Beziehung zu jeder Einzelnen gehabt haben. Konnte es sein, dass er im Grande seines Herzens ein einsamer Mann war, dem echte Liebe und Partnerschaft versagt geblieben ist? In seinen Schrif- ten gibt es mancherlei Andeutungen in diese Richtung. Aber eine davon, das sogenannte »Hohelied Salomos«, lasst einen besonders tiefen Einblick zu in das Herz dieses armen reichen Mannes. Diesem poetischen Buch liegt eine romantische Geschichte zugrunde, die ein Teil der Geschichte des Konig Salomos war, und die vieles, scheinbar so widerspruchliches im Leben des Sohnes Davids, des Konig von Jerusalem verstandlich machen kann.
Gleichzeitig gibt uns aber dieser Teil der Bibel einige wichtige Aussagen uber die Ethik der Heiligen Schrift, die auch ein klares Be- kenntnis zur Sexualitat des Menschen enthalt und im Gegensatz zur Lehre mancher christlichen Kirchen, die erotische Erlebnisfahigkeit von Mann und Frau voll bejaht. Besonders um dieser Lehren willen war es mir ein Anliegen, mich mit diesem, vielleicht am meisten ver- nachlassigtem Buch der Bibel, naher zu beschaftigen. Die Story, die ich dabei hinter dieser eigenartigen literarischen Schreibweise des Lie- des entdeckte, faszinierte mich so sehr, dass ich diese Auslegung des
Hoheliedes in Verbindung mit zeitkritischen Gedanken in dieser Form weitergeben mochte und hoffe, das sie vielen zu einer Neuorientierung oder zu einer Festigung im Glauben und in der Liebe werden.
Das Buch stellt keine exegetische Auslegung des Hoheliedes dar, denn es ist nicht in erster Linie fur Theologen geschrieben. Dennoch habe ich versucht, wichtige hermeneutische Prinzipien nicht zu verlet- zen. Es war mir ein Anliegen, die Metaphem und gleichnishaften Bil- der, die ein so poetisches Buch naturlich reichlich enthalt, immer am Gesamttext orientiert zu deuten und das Grundthema, die erotische Liebe zwischen Mann und Frau, in keinem Abschnitt zu verleugnen. Eine kritische Auseinandersetzung mit den wichtigsten Auslegungen des Hoheliedes erschien mir unausweichlich, wenngleich sie vielen Lesem nicht wichtig und uninteressant erscheinen wird. Diese Leser mochte ich bitten, nicht aus diesem Grand mit dem Lesen aufzuho- ren, sondern einfach das erste Kapitel zu uberspringen. Es wird das Verstandnis des Buches nicht beeintrachtigen.
I. Konig Salomos Hohelied der Liebe
Vieles in den Heiligen Schriften, wie wir die Bibel nennen ist fur einen Einsteiger der sie noch nicht gut kennt schwer zu verstehen. Zu wenig Kenntnis der Zusammenhange und der historischen Hin- tergrunde der biblischen Bucher in ihrer Entstehung machen es nicht eben einfach, fur ein junges Glaubensleben auch nur die Milch zu ent- nehmen, die man zum uberleben braucht, geschweige denn die feste Speise. Wenn man in einer guten christlichen Gemeinde zu Hause ist, erhalt man zwar was man braucht, durch die Lehre der Gemeinde in den verschiedenen Versammlungen, zudem haben wir im deutschen Sprachraum das Vorrecht, zu den meisten Buchem eine Auswahl von Kommentaren und Lexika befragen zu konnen, aber wenn es um das Hohelied geht, wird man feststellen mussen, dass sich Ausleger und Bibellehrer mit kaum einem anderen Buch der Bibel so schwer tun wie mit diesem. Lange war ich mir nicht klar daruber, was ich von diesem Buch zu halten habe. Die angebotenen Erklarungsversuche waren zu unbefriedigend. Die ublichen allegorischen Deutungen ver- leugneten zumeist das eigentliche Thema, um das es in diesem Buch doch offensichtlich geht, namlich um die Liebe eines Menschen als erotische Zuneigung zu einem Menschen des anderen Geschlechts. Gerade dieses Thema aber war und ist hochaktuell in einer Zeit, die eine sogenannte „sexuelle Revolution” hinter sich hat, in der ziemlich alles auf den Kopf gestellte wurde, was im christlichen Abendland jahrhundertelang Sitte und Anstand war. Dieser Zerbruch alter Werte und die einsetzende Desorientierung meiner und der nachfolgenden Generationen hatte neben statistischen Folgen (Fast die Halfte aller Ehen wird wieder geschieden), auch personliche, fur mich selbst und viele meine Freunde und Bekannte. Darum interessierte es mich zu sehr, was die Schrift zur Sexualitat des Menschen zu sagen hat, als dass ich mich mit den angebotenen traditionellen Auslegungen des Hoheliedes zufrieden geben konnte. Denn ganz offensichtlich geht es in diesem Buch urn das Thema Erotik, in dem Sinn, wie wir den Be- griff heute verstehenG Man konnte fast sagen es beschreibt die innere Dynamik erotischen Empfindens. Kann man also heute als glaubiger Christ noch akzeptieren, dass so wichtige Aussagen der Schrift uber Sexualitat einfach vergeistigt werden und damit die eigentlichen Er- kenntnisse, die dieser Text vermitteln will, verloren gehen? Ich denke, wir brauchen die Aussagen der Schrift zu diesem Thema heute mehr denn je unverkurzt und unverfalscht.
In den allegorisch orientierten historischen Auslegungen dominier- ten immer wieder 3 Anschauungen:
1. Der Vergleich mit lahwe als dem Freund oder Brautigam und dem Volk Israel als der Braut. Diese Auslegung stellt naturgemafi die judische/rabbinische Anschauung dar, moglicherweise bereits seit dem l.Jhdt.
2. Der Brautigam Christus steht seiner Braut, der Kirche, gegen- uber. Dies stellt den Standpunkt vieler christlicher Kirchen dar, die damit sich selbst meinen.
3. Die Braut ist nicht eine Kirche, sondem die Universalgemeinde, bzw. ist damit die Gesamtheit aller echten Glaubigen (gleich welcher Kirche) in ihrer Beziehung zu Christus gemeint. Diese Deutung liegt eher in der evangelikalen protestantischen Tradition.
Die allegorischen Auslegungen mancher Bibellehrer sind weitge- hend konform mit anderen Aussagen der Heiligen Schrift, das heifit, sie sagen an sich nichts Falsches, sie verwenden nur den falschen Text und dies ist bedenklich, weil dadurch die tatsachliche Aussage des Bibeltextes verlorengeht. Dazu Beispiele:
H.J.Ouweneel folgt in seinem Buch einer Kombination zwischen der ersten und der zweiten erwahnten Auslegung, Die Braut ist bei ihm wie in der judischen Deutung Israel. Der Brautigam ist hingegen nicht Jahwe, sondern Christus. So schriebt er in seinem Buch »Das Lied derLieder« auf Seite 31: „Wie wunderbar beginnt dieses Buch hier, wo derHlg. Geist anfangt zu sprechen: Die Braut sagt: »Er kusse mich mit den Kussen seines Mundes« (Hoh.1.2) Es ist die Braut, die das Lied beginnt, nicht der Brautigam. Es ist auch die Braut, die das letzte Wort des Buches ausspricht. Es ist nicht der Herr Jesus, der zuerst zur Braut sprechen wird, er wartet auf ihre Stimme. Der Herrjesus sagte, als er nachjerusalem ging: »Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich dich sammeln wie eine Henne ihre Kuken unter ihre Flugeln, aber du hast nicht gewollt. Seht, euer Haus soil euch wust gelassen werden. Aber ich sage euch: Ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, in der ihr sagen werdet, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn!» Sie werden also als erster sprechen mussen, der Herr Jesus wird zuerst in ihren Herzen Gefuhle sehen wollen, die sie ihm entgegenbringen, und erst danach wird er sich ihnen zu erkennen geben.”
In diesem Abschnitt legt Ouweneel die grundsatzliche Lime seiner Auslegung fest, die denjenigen nicht uberrascht, der weifi, dass das Volk Israel das Lieblingsthema des Autors ist. Mit der Verquickung des ersten Verses des Hoheliedes mit der Stelle aus dem Evangelium, in der Jesus uber die Annahme des Messias durch Israel spricht (Math. 23.37), erweckt er den Eindruck, dass dies das Thema des Buches sei. Dies ist aber eine Irrefuhrung. Denn das Thema dieses Textes ist nicht Israel und die Gemeinde, sondern die Liebe zweier Menschen zueinander. Zwar stimmt es, dass Israel nach dem prophetischen Wort der Schrift eines Tages Jesus als den Messias anerkennen wird, aber dafur ist die Matthausstelle, die sich auch im Lukasevangelium wiederholt, Anhaltspunkt genug. Es gabe also eine Menge anderer Texte in der Bibel, auch im AT, die von der Wiederannahme des Vol- kes Israel berichten. Man fragt sich wirklich nach dem Zweck eines solchen Unterfangens, eine Lehre in einen Text zu zwangen, in der sie wirklich keinen Platz hat.
Zwei weitere Beispiele: In Hohel. 1.2 heifit es: „Dein Name ist wie eine ausgeschuttete Salbe, darum lieben dich die Madchen.” Diesen Vers kommentiert ein Ausleger mit den Worten: Dieses Kompli- ment gilt dem Namen Jesus, der uber alle Namen steht. Er tragt die Duftnote des Ewigen, um dich zu erfrischen(Charles Reichenbach, Das Hohelied Salomos, Verlag H.Rathmann, Marburg) Gott sei dank, wissen wir aus Apg 4.12 und anderen Stellen, dass der Name uber alle Namen tatsachlich Jesus heifit, sonst mussten wir eine solche Ausle- gung als Irrlehre bezeichnen. Was aber den Autor dazu bewegt hat, gerade diese Stelle als Beleg dafur anzufuhren, ist ebensowenig klar wie im nachsten Fall. Bezogen auf Hohel. 3.3 wird gesagt: „Die Braut stoft auf die Wachter, die in der Stadt umhergehen. Die Wachter? — wer sind sie? - Das sind wir, die Botschafter an Christi statt.” (Fr. W Krummacher, Salomo und Sulamith, Karl Fix Verlag, 1964) Diese Auslegung wird besonders peinlich, wenn in Kap 5.7 die Wachter das umherirrende Madchen wundschlagen.
Wir wollen uns in dieser Betrachtung des „Liedes der Lieder”, wie das Hohelied Salomos im hebraischen genannt wird, von solchen AUegorismen, die versuchen, Personen und Ereignisse die mit der Handlung nichts zu tun haben, in den Text hinein zu interpretieren, vollig Ireihalten, auch wenn wir zugeben mussen, dass es durchaus Parallelen zwischen der Beziehung von Mann und Frau und Christus und seiner Gemeinde gibt. Aber auch zu diesem Thema gibt es ein- schlagige Bibelstellen, wie zum Beispiel Epheser 5.31-32. Diese sind jedoch nicht Gegenstand dieses Buches.
Ebenfalls ist es nicht meine Absicht, eine erschopfende wis- senschaftliche Auslegung des Hoheliedes zu geben, deshalb sollen viele andere Deutungsversuche der Geschichte unbehandelt bleiben.
Hinweisen mochte ich nur noch auf die Auslegungsgeschichte des Buches, die von Gerhard Maier, in der Wuppertaler Studienbibel des Brockhaus Verlages sehr informativ und interessant abgehandelt wur- de. Ebenso auf die Auslegung von J.A.Balchin, im »Kommentar zur Bibel II« desselben Verlages, mit dessen Auffassungen ich weitgehend ubereinstimme. Gleichwohl lag aber die Motivation fur das Schreiben dieses Buches fur mich nicht darin, eine neue Auslegung zu schaffen, sondem einen Bezug des Hoheliedes zu unserem modemen Leben herzustellen.
Denn dieser Teil der Heiligen Schrift muss sich in die Auseinander- setzung der christlichen Ethik mit der „Modeme” einbeziehen lassen, da er sich ganz offensichtlich mit einem wesentlichen Thema dieser Zeit beschaftigt. Warum dies aber bis jetzt nicht, oder nur wenig der Fall war, hat, aufier dem erwahnten Grand, noch einen zweiten:
Das Christentum war uber die Jahrhunderte hinweg nicht nur bestimmt von den Aussagen der Bibel, sondem auch von den zeit- geistigen Stromungen der verschiedensten Epochen. Obwohl der Kampf gegen aufierbiblische Bestimmung der Gemeinden immer wieder aufs Neue aufgenommen wurde, so kam es doch standig vor, dass uber kurze oder lange Perioden hinweg auch Fremdes die Auslegung beeinflusste. So war eine der ersten Beeinflussungen, der schon die sogenannten Kirchenvater, die Generation nach den Apos- teln erlagen, die griechische Philosophie. So vielfaltig diese in den Tagen der werdenden Kirche auch gewesen sein mag, eine bestimm- te Richtung scheint manchen Aussagen der Hlg. Schrift besonders nahe gekommen zu sein, namlich die des Platonismus. Manches an dieser Philosophie ist auch durchaus mit der Hlg Schrift vereinbar, die Lehre Platons vom Leib - als dem ,,Grab der Seele”- aber ist es nicht. Ihre Anwendung auf die Lehre der Schrift lasst Wesentliches aufier acht. Gerade diese Lehre wurde aber von den Christen damals ubemommen und allmahlich in ihre Theologie integriert. Der Weg bis zur totalen Leibfeindlichkeit und zur Askese mag zwar noch einige
Jahrhunderte lang gewesen sein, aber dennoch war damals von den Apologeten des 2. u. 3. Jhdt. bereits diese Richtung eingeschlagen worden. Der Grand weswegen man mit den Philosophen zu argu- mentieren begann, lag wohl in einem Annaherungsversuch an die gebildete Oberschicht des romischen Reiches. Wie die Geschichte wei- terging ist allgemein bekannt. Es dauerte nicht sehr lange, bis man in der klosterlichen Abgeschiedenheit, der Wollust entsagend, dem Leib entzog, was man als Hindernis auf dem Weg ins Himmelreich ansah. Dazu gehorte unter anderem auch die Sexualitat.
So berichtete Klemens von Alexandrien von den Pytagoraem, dass sie sich der geschlechtlichen Lust enthalten und in der Ehe einzig und allein die Kinderzeugung suchen und wenn sie dieses Ziel erreicht haben, auf weitere Geschlechtlichkeit verzichten. Da wird es klar, woher der Wind weht, wenn Hieronymus schreibt: ,,Ehebruch begeht mit der eigenen Frau, wer sie zu brennend liebt.” Wie das dann mit der Bibel in Einklang gebracht wurde, sehen wir bei Origenes (ca 183 - 250): Dieser erkennt im Zusammenhang seiner Auslegung von Gen 1.27 f (»Gott schuf sie als Mann undFrau undsegnete sie, indem er sprach: Wachset und mehret euch«) auch fur den paradiesischen Zustand die korperliche Fortpflanzung an. Doch weifi er neben dem Wortsinn auch um einen allegorischen Sinn: ,,Unser innerer Mensch besteht aus Geist und Seele. Der Mann kann als Geist, die Frau als Seele verstanden werden. Wenn die beiden sich verbinden, dann wachsen und vermehren sie sich und erzeugen gute Empfindungen und nutzliche Erkenntnisse als ihre Kinder. Die Seele ist dem Geist ehelich verbunden und begeht Ehebruch, wenn sie sich auf korperliche Luste einlasst und nach den Lusten des Fleisches trachtet.” Schon damals wurde also der Bibeltext allegorisch mifibraucht, um etwas in ihn hineinzulegen, wovon Origenes zwar uberzeugt war, was aber nicht in seinem Text stand. Ubrigens auch in keinem anderen der Heiligen Schrift.
Die Bekehrungsgeschichte des Augustinus, die er in seinen Be- kenutnissen niederschrieb, hat wohl ebenfalls nachhalhg die Entwick- lung der fruhchristlichen Sexualethik bestimmt, er schrieb darin im 8. Buch bei einer genauen Schilderung seiner Bekehrung:
,,Denn so viele Lebensjahre waren mir schon dahingeflossen, wohl zwolf, seit ich, neunzehn Jahre alt, Ciceros Hortensius gelesen und dadurch zum Streben nach Weisheit erweckt war. Und immer hatte ich‘s verschoben, das Erdengluck zu verschmahen und michfur diese Aufgabefrei zu machen. Und doch war schon das Suchen nach Weisheit, geschweige denn das Finden, weit vorzuziehen dem Besitz von Schatzen und Konigreichen und alien erdenklichen,jeden Augenblick zur Verfugung stehenden leiblichen Genussen. Ich elender Jungling aber, so jammervoll schon im Beginn meines Junglingsalters, hatte von dir Keuschheit erbeten und gesagt: Gib sie mir die Keuschheit und Enthaltsamkeit, aber noch nicht gleich! Denn ich war bange, du mochtest mich rasch erhoren und rasch von derKrankheit meiner Begehrlichkeit heilen, die ich doch lieber sattigen als austilgen lassen wollte.
In dieser Erinnerung Augustins erkennen wir deutlich, dass sein Wunsch nach Keuschheit bereits wahrend seiner Beschaftigung mit den Philosophen erwachte. Er lebte damals in einer wilden Ehe und hat seine Lebensgefahrtin nach vierzehn Jahren auf Drangen seiner glaubigen Mutter verlassen, urn eine andere zu heiraten. Da diese andere aber noch zu jung war und er zwei Jahre warten musste, was er nicht aushielt, verschaffte er sich einstweilen „nicht so sehr ein Freund der Ehe als ein Sklave meiner Begierde” (Bekenntnisse 6.Buch), eine andere. Aber zu einer Ehe kam es ohnehin nicht mehr. Augustin bekehrte sich infolge eines Berichtes von zwei jungen, hohen, koniglichen Beamten, die sich dem Monchsideal zugewandt hatten. Seine Bekehrung war somit untrennbar mit seinem Verlangen nach Keuschheit verbunden. Nur in dieser Entsagung sah er sein Heil.
Er schildert sehr ausfuhrlich seinen Glaubenskampf, den er gegen seine beiden „alten Freundinnen” die Torheit und die Nichtigkeit aus- hcht. Auch die ,,reine Wurde der Keuschheit” begegnete ihm in der Vision und er kann das innere Streitgesprach in seinem Herzen zu ihrem Gunsten entscheiden. Daraufhin erhalt er ein Bibelwort: (Ro.13.13) Lasst uns anstandig wandeln wie am Tag; nicht in Schwelgerei und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit undNeid; sondern zieht den Herrn Jesus Chnstus an, und treibt nicht Vorsorgefur das Fleisch, dass Begierden wach werden. Der Wunsch nach Ehelosigkeit und totaler sexueller Enthaltsamkeit war im Pla- toniker bereits so fest verankert, dass er in dieser Schriftstelle die Bestatigung dafur sah, dass Gott ein solches Leben von ihm wollte, obwohl dies der Text exegetisch nicht vermittelt. Unzucht hat ja nichts mit Sexualitat schlechthin zu tun, sondern ist nur eine Pervertierung derselben. Aber Augustinus schreibt weiter:
,,Denn nun hattest du mich zu dir bekehrt, dass ich nach keinem Weibe noch sonst einer weltlichen Hoffnung mehr Verlangen trug. ” Mit diesem Resumee schickte sich der von sexuellen Verirrungen Gezeichnete zu einem christlichen Leben an, das ihn zum bedeu- tendsten Bibellehrer des beginnenden Mittelalters werden liefi. Von da war es nur mehr ein kleiner Schritt bis zu jener folgenschweren Be- hauptung, die Augustinus in seinen Schriften machte und von der die Kirche lange Zeit in ihrer Sexualethik bestimmt wurde: „dass sinnli- che Lust im allgemeinen, und die sexuelle im besonderen, eine Folge des Sundenfalls und daher Sunde ist.” Dieser Tatbestand fuhrte zu einer, manchmal mehr, manchmal weniger rigorosen Brandmarkung der geschlechtlichen Lust im Katholizismus bis in unsere Zeit hinein. Mit aufierst seltsamen Argumenten, wurde gelegentlich gerade noch die zwar empfundene, jedoch nicht gewollte Lust beim Zeugungsakt als sundenfrei erklart. Der Glaubige hat zwar seine eheliche Pflicht zu leisten, aber bereits ein Kuss kann ihm zum Verhangnis werden, wenn dabei sexuelle Lust mitschwingt. Zwar haben sich heute in der katholische Kirche einige Bischofskonferenzen und Synoden vom einstigen sexualethischen Bigorismus abgewendet, sogar die zumin- dest tielweise Aufhebung des Zolibates wird von einigen angedacht, eine umfassende Aufarbeitung dieses Themas, die offizielle Widerrufe einstiger Fehlmeinungen enthalt, ist vom Vatikan jedoch nicht zu erwarten. Da der Vatikan auch grundsatzlich nicht widerrufen kann ohne seinen Unfehlbarkeitsanspruch zu gefahrden, wird eine solche Aufarbeitung auch nicht moglich sein. So ist also in den Augen vieler Katholiken „sexuelle Lust um ihrer selbst widen” immer noch Sunde, wenn sie der offiziellen Lehre ihrer Kirche folgen.
Obwohl im Protestantismus der griechische Einfluss in der Schrift- auslegung weitgehend uberwunden wurde, geisterte aber auch hier gelegentlich das Gespenst der Leibfeindlichkeit durch die Theolo- gie. Es war eben nicht so leicht, eine uber 1.000 Jahre andauemde Fehlentwicklung mit einem Schlag zu uberwinden. Heute allerdings scheint sich das Pendel mehr in Richtung einer Uberbetonung der sinnlichen Lust zu bewegen. Auch die Gemeinde des 20. Jhdts kann sich den Stromungen des Zeitgeistes nicht entziehen, es gilt aufs neue, ihnen zu widerstehen.
Zusammenfassend sehen wir also, dass die Auslegung des Hohe- liedes in der Christenheit von zwei Dingen negativ beeinflusst wurde: 1. vom Hang zur allegorischen Schriftauslegung, um die Aussagen mit den eigenen Meinungen in Einklang zu bringen, und 2. von einer irrtumlich angenommenen Leibfeindlichkeit der Hlg. Schrift, die ihre Wurzeln in der griechischen Philosophie hat. Eine naturliche, dem Wortsinn des Liedes entsprechende Auslegung, hatte eben dieser Theologie widersprochen, deshalb erfolgte sie auch in der Vergan- genheit kaum und wurde dieses Buch von den Theologen meistens ignoriert.
Erganzend soil noch eines gesagt werden: Immer wieder wird behauptet, dass auch die Aussagen des Apostel Paulus leibfeindlich sind. Der Apostel Paulus zeigt zwar, besonders in Romer Kapitel 7, die Betroffenheit des Fleisches von der Sunde auf, meint aber mit dem Begriff Fleisch nicht nur den Leib, sondem die von Gott getrennte, seelisch/leibliche Wesenheit des Menschen. Daram nennt er ja auch, zum Beispiel in 1. Kor. 3.3, psychische Eigenschaften wie Zank und Eifersucht fleischlich. Andererseits betont er an anderen Stellen die grandsatzliche Freiheit des Menschen zu geniefien, was Gott geschaf- fen hat (1. Tim. 4.4). Selbst wenn wir aber bei Paulus eine Einseitig- keit entdecken konnten, was aber nicht der Fall ist, wurde dies uns noch nicht berechtigen, aus diesem Grand ein anderes Buch der Bibel umzudeuten, um es mit unserem Verstandnis zu harmonisieren. Es gilt fur einen bibelglaubigen Menschen, dass die Bibel eine Einheit ist. Die Aussagen widersprechen sich nicht, sondem erganzen sich. Diese Erganzung zu suchen ist Aufgabe der Schriftauslegung, wenn diese davon ausgeht, dass es sich dabei nm Gottes Wort handelt. 1st sie namlich Gottes Wort, dann muss die Bibel von einer Vollkommenheit sein, die moglicherweise nicht leicht zu durchschauen ist, die aber dennoch vorhanden ist und sich dem Suchenden erschliefit.
Wenn das Hohelied der Liebe richtig ausgelegt wird, dann mus- sen also auch die Aussagen des Apostel Paulus und all die anderen einschlagigen Schriftstellen in ihrem Licht erscheinen, um besser verstanden zu werden. Alle Aussagen der Hlg. Schrift zur Sexualitat des Menschen zusammengenommen konnen erst die Sexualethik der Bibel reprasentieren.
Die biblischen Bucher sind zum Teil Historie, und selbst da wo die Lehre uberwiegt, gehoren sie in einen bestimmten historischen Kontext hineingestellt, der zum Verstandnis der Aussagen beruck- sichtigt werden muss. Dies hat Gott in seiner Weisheit so bestimmt. Kein Gesetz, kein Dogmenbuch, kein vorgefertigter Katechismus liegt uns vor, sondem ein Buch, in dem man die Wahrheit suchen muss. Vielleicht entspricht dies Gottes padagogischem Konzept mit dem Menschen (Jos. 1.8): Dann wollen wir uns dem auch beugen, indem wir in der folgenden Betrachtung des Hoheliedes diesen Teil der Bibel auch in seinen Historischen Zusammenhang stellen und so zu einer Gesamtschau der Schrift uber die Liebe des Menschen zum anderen Geschlecht gelangen wollen.
Fufnote zu Kap. I
1 Der Begriff Erotik ist naturlich durch vielfachen Missbrauch einem Wan- del des Verstandnisses unterworfen. Ich beziehe mich auf gangige lexikalische Definitionen wie in Modernes Lexikon, Bertelsmann Verlag: „Erotik steht fur die geistig-seelische Seite des Liebeserlebens im Unterschied zur rein sinnlichen sexuellen Vereinigung. Gesamtheit“; oder im Duden Fremdworterbuch: „...mit sensorischer Faszination erlebte, den geistig-seelsichen Beriech einbeziehende sinnliche Liebe“. Dass das Wort heute oft mit reiner Pornografie in Zusammenhang gebracht wird, ist bedauerlich. Ich meine jedoch keinesfalls damit den pomografischen Bereich. Im Verlauf des Buches wird das Wort von mehreren Seiten beleuchtet.
II. Die Personen und die Handlung
Dass das Hohelied von konkreten Personen spricht, von denen zwei namentlich genannt werden, ist offensichtlich. Nicht so offensichtlich ist die Existent einer dritten Person im Text. Die wahren Beziehungen der Personen zueinander sind ebenfalls nicht leicht auszumachen. Viele modeme Ausleger halten das Buch fur eine Sammlung israe- lischer Liebes- oder Hochzeitslieder. Das klingt durchaus plausibel, aber warum sind dann diese Texte auf bestimmte Personen bezogen? Bei Liebesliedern, die fur den hochzeitlichen Gebrauch bestimmt sind, wurde man eine Beschrankung auf allgemeine Benennungen wie Braut/Brautigam und Freund/Freundin erwarten. Da Salomos Verhalten mit seinem Harem im Bezug auf sein Geschlechtsleben weder im Text noch in der Geschichte Israels als Vorbild erscheint, wurde man auch nicht an eine Erwahnung „zur Ehre des Konigs” denken konnen. Das „Lied der Lieder” muss also mehr sein als ein Liebesgedicht. 1st es vielleicht eine Ballade, der eine romantische Geschichte zugrunde liegt?
Es stellt sich naturlich die Frage, warum dann die in ihr enthaltene Handlung verborgen und nicht beim ersten Lesen klar erfassbar ist? Dies ist aber nur fur das alte Testament ungewohnlich, im Neuen Testament dagegen finden wir bei den apostolischen Briefen ahnliches. Auch sie enthalten manche historischen Ereignisse, die sich in ihrer Dimension oft nur vermuten lassen, uns aber nicht genau uberliefert sind. Zum Beispiel wenn Paulus uber seine Krankheit schreibt oder uber einen Ehebruch in Korinth, oder Petrus uber Irrlehrer etc. Na- turlich ist dies die Eigenart von Briefen, dass jene Leser, die nicht die eigentlichen Adressaten sind, sie schwerer verstehen, es setzt das Wis- sen urn die Hintergrunde voraus. Aber konnte nicht auch genau dies der Fall sein beim Hohelied, auch wenn es sich urn eine ganz andere literarische Gattung handelt? Es ist zwar kein Brief, aber dennoch kann mit diesem Text ursprunglich ein Publikum angesprochen ge- wesen sein, das die Geschichte kannte, die diesen Text entstehen liefi. Sozusagen ein poetischer Kommentar einer Lovestory aus den Tagen Salomos, der von alien verstanden wurde, weil das Ereignis damals allseits bekannt war. Dass Salomo in die Geschichte verwickelt war und offensichtlich nicht den Helden dabei abgibt, konnte eine wei- tere Erklarung fur die Verschlusselung der Handlung sein. Vielleicht wollte man die Wurde des Konigs schonen, ohne auf die Essenz der Botschaft zu verzichten. Ob Salomo selbst der Schreiber des Textes oder Teile davon war, spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Auch er konnte durchaus von dem Motiv beseelt gewesen sein, seine negativen Erfahrungen zum Wohl der Allgemeinheit preiszugeben, ohne sich selbst dadurch zu sehr zu entblofien. Dies ware mit dem Charakter Salomos, wie wir ihn aus der Schrift kennen, durchaus zu vereinba- ren. Von einer Verfasserschaft Salomos muss aber trotz des Verses nicht zwingend ausgegangen werden, er konnte auch lediglich der Herausgeber gewesen sein.
Wenn wir eine Handlung annehmen, dann muss diese naturlich in sich schlussig sein, das heifit, sie darf nicht im Widerspruch stehen zu Aussagen die in diesem Text gemacht werden. Die Frage, die wir uns stellen mussen ist: Was hat sich damals wirklich ereignet, das zur Abfassung dieses so beeindruckenden Textes gefuhrt hat?
Am ehesten lasst sich dies wohl beantworten, wenn wir zuerst die Personen und ihre Beziehung zueinander analysieren, soweit dies der Text zulasst. Die Uberlegungen, die wir dann anstellen, um die Lucken des Bildes zu schliefien, mussen dabei nicht nur historisch fundiert sein, sondern auch vom Glauben getragen, dass die Bibel uns in all ihren Teilen eine Lehre vermittelt, die der Gesundung des Menschen nach Leib, Seele und Geist dient, das behehlt uns unser Glaube.
Wir gehen, wie J.A.Balchin in seinem HL-Kommentar (Brockhaus, Kommentar zur Bibel II) von der sogenannten Hirtentheorie aus, welche besagt, dass es sich im Text urn 3 Personen handelt: 1. Um den Konig Salomo, 2. um das Madchen Sulamith und 3. um einen namentlich unbekannten „Freund” dieses Madchens, einen Hirten. Als Personengruppen begegnen uns aber noch die Tochter Jerusalems und die Gefahrten des Hirten, denen die Geschichte moglicherweise zur Belehrung gewidmet ist.
Versuchen wir nun, zu einer schlussigen Gesamtschau der Ereig- nisse zu kommen, die diesem Text zugrundeliegen. Dabei stofien wir auf die Schwierigkeit, dass uns nur dieser Text zur Verfugung steht und das Hohelied inhaltlich so einzigartig ist, dass uns kein anderes Buch der Bibel mit Parralelstellen helfen kann. Es ist auch nicht im- mer sofort erkeunbar ist, wer mit welchem Abschuitt gemeint ist, bzw. wer zu wem spricht. Es sei noch einmal gesagt: Wie bei den neutesta- mentlichen Briefen scheint es sich beim Hohelied um eine Schrift zu handeln, die eine Kenntnis der Ereignisse durch die damaligen Horer voraussetzte. Wenn das Lied an den Festtagen in Israel vorgetragen oder gesungen wurde, wussten die Horer sehr wohl etwas damit anzu- fangen, denn sie kannten die Geschichte. Wir werden aber sehen, dass sich dennoch auch heute eine sinnvolle Abhandlung rekonstruieren lasst. Zunachst einmal wollen wir von jeder Person herausstellen, was uns gesichert erscheint, dann lassen sich namlich auch die anderen Texte zuordnen. In Bezug auf Salomo werden uns dann doch auch andere Schriftstellen helfen, denn nicht nur sein Leben, auch seine ganze Denkweise ist uns sehr genau uberliefert. Den Texten liegt die revidierte Elberfelder Ubersetzung zugrunde.
1. Salomo
In den ersten Versen begegnet uns Salomo. Aus dem Kontext des Buches geht klar hervor, dass es sich dabei nur um den Salomo handeln kann, der von seinem Vater David das Konigtum uber Israel erhalten hat. Wir wollen uns zunachst einen Uberblick verschaffen, uber die Stellen im Hohelied, in denen er erwahnt wird:
1.1 Das Lied der Lieder, von Salomo.
Dieser Vers konnte bedeuten, dass Salomo der Verfasser ist oder dass er die Hauptrolle in diesem Stuck spielt. Um eine ehrenhafte Widmung kann es sich kaum handeln, wenn unsere Annahme der Hirtentheorie stimmt, wie wir sehen werden. Ich neige personlich dazu ihn zumindest als den Herausgeber zu betrachten.
1. 2-4 Er kusse mich mit dem Kusse seines Mundes, denn deine Liebe ist kostlicher als Wein.
An Duft gar kostlich sind deine Salben, ausgegossenes Salbol ist dein Name. Darum lieben dich die Madchen.
Zieh mich dir nach, lass uns eilen! Der Konig moge mich in seine Gemacher fuhren! Wir wollen jubeln und uns freuen an dir, wollen deine Liebe preisen mehr als den Wein. Mit Recht liebt man dich.
Diese Verse sprechen dafur, dass Salomo als eine Haupthgur gesehen werden kann, als solcher wird er als erster beschrieben. Sein hoher Bekanntheitsgrad wird angesprochen (dein Name) und dass er als Konig sehr beliebt war bei den Frauen. Der Ruhm seines sagenhaften Reichtums und seiner Weisheit erreichte einst selbst die Konigin von Saba und sie kam aus einer femen Zivilisation ange- reist, um ihn zu bewundern. Wie sehr mag er erst der Bewunderung der Madchen seines Volkes ausgesetzt gewesen sein. Wie eine ausge- schuttete Salbe verbreitete sich dieser Wohlgeruch. Er war in seiner Zeit ein Star und absolut begehrenswert. Von ihm angenommen zu werden war der Wunsch vieler. (Zieh mich dir nach, lass uns eilen! Der Konig moge mich in seine Gemacherfuhren). Auch wenn wir es nur schwer verstehen konnen, aber wir sollten davon ausgehen, dass wohl die meisten der vielen Frauen in Salomos Harem, es durchaus als eine Ehre ansahen, ihm anzugehoren (herzlich lieben wir dich). In 1. Kon. H wird uns berichtet, dass er es schliefilich auf 700 Haupt- frauen und 300 Nebenfrauen brachte, denen er es an nichts fehlen liefi. Fur die Zugehorigkeit zu diesem Konkubinat waren die Madchen bereit, alles aufzugeben. War ihnen doch optimale Sicherheit und Versorgung ebenso garantiert wie gesellschaftliche Anerkennung (Wir preisen deine Liebe mehr als den Wein). Denken wir daran, wieviele junge Madchen wohl heute fur sehr viel weniger ihre Personlichkeit preisgeben und sich in den Dienst einer sehr zweifelhaften erotischen Liebe stellen, sei es um materieller Vorteile willen oder aus Verehrung gegenuber einem Star, der sein „Groupie” danach ebenso schnell wie- der vergisst, wie Salomo viele seiner Damen moglicherweise bereits nach einer Nacht vergessen hatte. Dem Ruf des Konigs folgten viele mit Freude. In diesem Sinne liebten die Madchen Salomo, wie heute auch irgendein Teenager sein Idol lieben und verehren kann.
Wir gehen also davon aus, dass wir es in diesen ersten Versen mit einer Charakterisierung Salomos zu tun haben, dessen Beliebtheit in der damaligen Frauenwelt hervorgehoben wird. Weiteren Aufschluss uber die damaligen gesellschaftlichen Verhaltnisse rund um Salomo gibt uns auch der folgende Abschnitt:
3. 7-tt Siehe da, die Sanfte Salomos! SechzigHelden sindrings um sie her von den Helden Israels.
Sie alle sind Schwerttrager, geubt im Kampf Jeder hat sein Schwert an seiner Hufte gegen den Schrecken zur Nacht- zeit.
[...]
- Citar trabajo
- Johann Schoor (Autor), 2007, Das Siegel auf deinem Herzen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83341