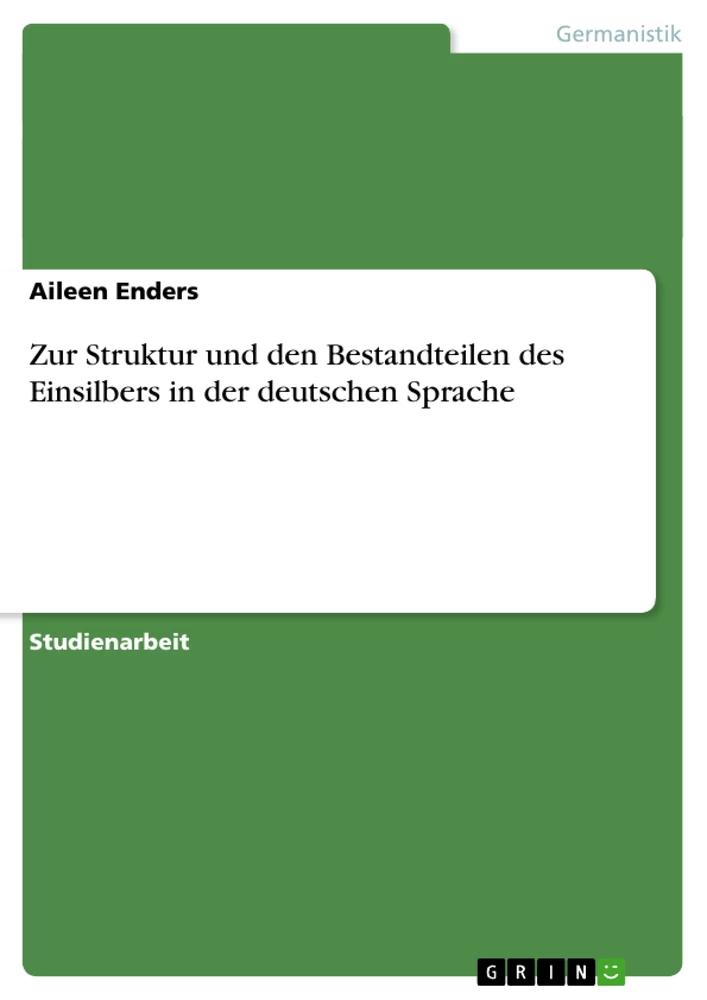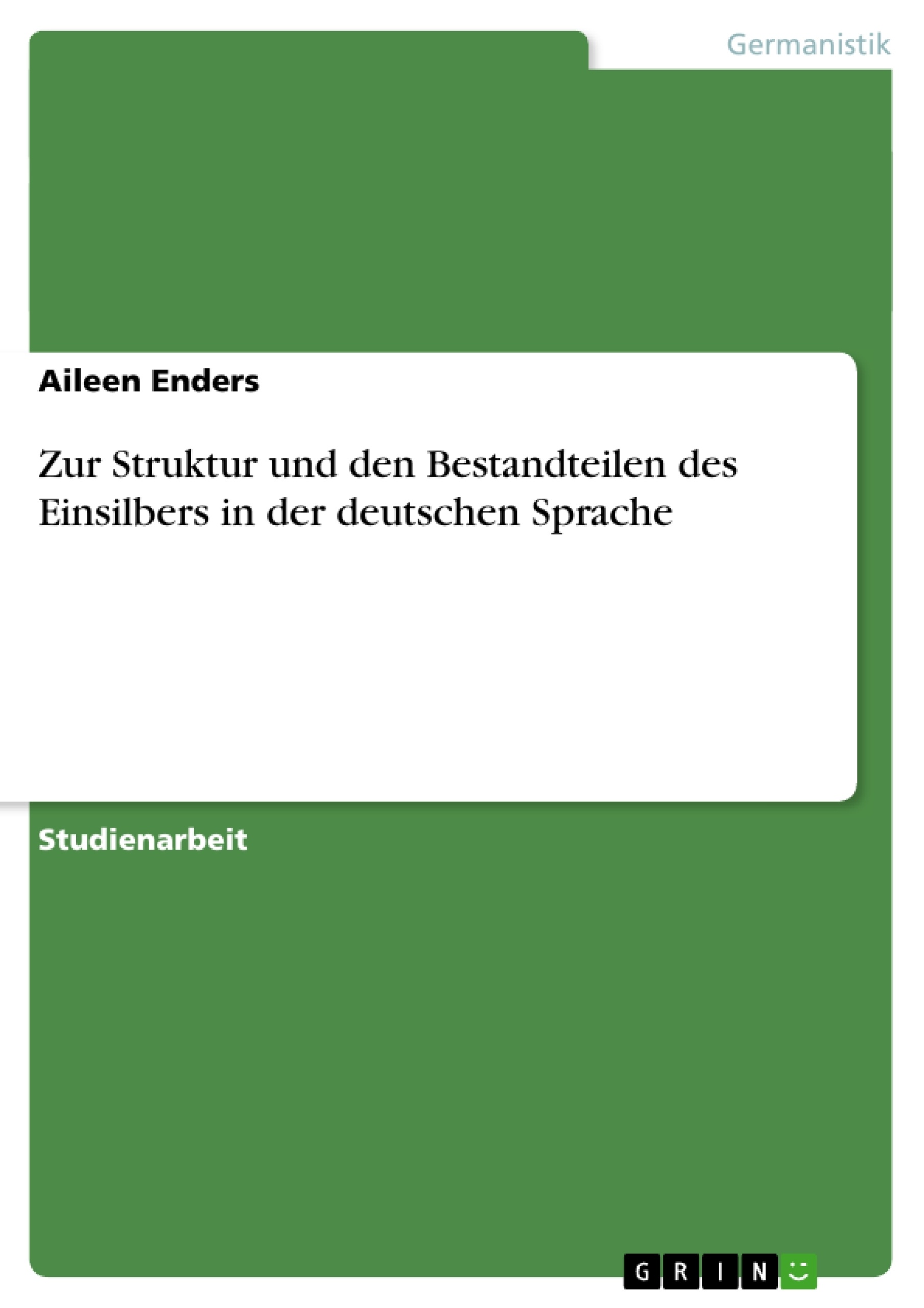„Most phonologists, to the extent that they have accepted it, attempt to deal with the syllable as a phonological unit” (Hyman 1975, 188). Dabei ist die Grundannahme bezüglich der Silbe, dass es eine Beziehung zwischen der Struktur des Wortes, und der Struktur der Silbe gibt (Hyman 1975, 189). Denn grundsätzlich gilt, dass durch die Silben die Laute, die im zusammenhängenden Sprechen als kontinuierliche Folge produziert werden, zu strukturierten Gruppen zusammengefasst werden, was die Silbe somit zu einem fundamentalen Begriff der Phonetik macht (Lindner 1981, 286). Aber die Wichtigkeit dieser Konstituente lässt sich auch damit begründen, dass es viele Phänomene gibt, die sich nun einmal ausschließlich innerhalb einer Silbe finden lassen, wie beispielsweise die Auslautverhärtung, die Allophonie oder den dorsalen Frikativ, auf welche ich im Verlauf dieser Arbeit noch kommen werde (Féry 2000, 144).
Doch wie lassen sich Silben erfassen und definieren, wie kann man eine Silbe strukturell darstellen? Lässt sich mehr sagen, als dass es sich dabei um Einheiten handelt, die phonologische Abfolgen von Segmenten strukturieren (Féry 2000, 144)? Wie kann man eine phonetische Silbe in ihre lautlichen Bestandteile aufgliedern (Kohler 1977, 79)?
Anhand der Fragen, die ich in dieser Arbeit klären möchte, beziehungsweise über die ich einen Überblick verschaffen möchte, ist bereits erkennbar, dass die Silbe als Kategorie im Mittelpunkt stehen wird. Schließlich unterscheiden sich Sprachen nicht nur durch unterschiedliches Phoneminventar, sondern auch grundlegend in der Art, wie diese Phoneme zu größeren Einheiten, also unter anderem eben zu Silben, kombiniert werden können (Willi 2001, 429). Dabei werde ich im Folgenden den Silbenbegriff und mit der Silbe verbundene Begrifflichkeiten klären, weiter werde ich das allgemeine Silbenbaugesetz näher erläutern und schließlich auf die Bestandteile der Silbe näher eingehen. Diese Untersuchungen werde ich alle anhand der deutschen Sprache mit Beispielen belegen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Silbenbegriff und Terminologie
- 3. Das allgemeine Silbenbaugesetz
- 3.1. Das Schema einer Silbe
- 3.2. Die Sonoritätshierarchie
- 4. Zu den Bestandteilen der Silbe
- 4.1. Der Anfangsrand der Silbe
- 4.1.1. Einfacher Anfangsrand
- 4.1.2. Komplexer Anfangsrand
- 4.2. Der Silbenkern
- 4.3. Der Endrand der Silbe
- 4.3.1. Der dorsale Frikativ
- 4.3.2. Die Nasale
- 4.3.3. Die Auslautverhärtung
- 4.1. Der Anfangsrand der Silbe
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Struktur und den Bestandteilen der Silbe in der deutschen Sprache. Ziel ist es, den Silbenbegriff zu klären, das allgemeine Silbenbaugesetz zu erläutern und die verschiedenen Bestandteile der Silbe (Anfangsrand, Silbenkern, Endrand) detailliert zu untersuchen. Die Arbeit soll einen Überblick über die verschiedenen theoretischen Ansätze und Beschreibungsmodelle der Silbenstruktur liefern.
- Definition und Abgrenzung des Silbenbegriffs
- Das allgemeine Silbenbaugesetz und die Sonoritätshierarchie
- Die Bestandteile der Silbe: Anfangsrand, Silbenkern und Endrand
- Unterschiede in der Beschreibung und Strukturierung von Silben
- Beispiele aus der deutschen Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Silbenstruktur in der deutschen Sprache ein und benennt zentrale Forschungsfragen. Sie betont die Bedeutung der Silbe als phonologische Einheit und weist auf relevante Phänomene hin, die sich innerhalb einer Silbe abspielen, wie die Auslautverhärtung. Die Arbeit kündigt die folgenden Kapitel an, die den Silbenbegriff klären, das allgemeine Silbenbaugesetz erläutern und die Bestandteile der Silbe detailliert untersuchen werden.
2. Silbenbegriff und Terminologie: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Abgrenzung des Silbenbegriffs. Es werden unterschiedliche Auffassungen zur Struktur der Silbe vorgestellt, insbesondere die Gliederung in Silbenkern (Nukleus), Anfangsrand (Onset) und Endrand (Koda). Die Diskussion der verschiedenen Perspektiven von Linguisten wie Hyman, Ramers und Ternes verdeutlicht die Komplexität der Silbenbeschreibung und die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen in der Forschung. Es werden auch verschiedene Silbentypen (einfach, komplex, offen, geschlossen) eingeführt und erklärt.
3. Das allgemeine Silbenbaugesetz: Kapitel 3 beschreibt das allgemeine Silbenbaugesetz. Es wird dabei auf das Schema einer Silbe eingegangen und die Rolle der Sonoritätshierarchie in der Silbenbildung erläutert. Die detaillierte Darstellung dieser Prinzipien soll ein besseres Verständnis der Silbenstruktur ermöglichen und die Beziehungen zwischen den einzelnen Bestandteilen der Silbe verdeutlichen.
4. Zu den Bestandteilen der Silbe: Dieses Kapitel analysiert die einzelnen Bestandteile der Silbe im Detail. Es behandelt den Anfangsrand (mit einfachen und komplexen Varianten), den Silbenkern und den Endrand (inkl. dorsaler Frikativ, Nasale und Auslautverhärtung). Für jeden Bestandteil werden verschiedene Aspekte erläutert, und die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Elementen werden aufgezeigt. Die Diskussion der Auslautverhärtung, ein typisches Phänomen im Deutschen, unterstreicht die praktische Relevanz der untersuchten Konzepte.
Schlüsselwörter
Silbe, Silbenstruktur, Silbenbaugesetz, Sonoritätshierarchie, Anfangsrand, Silbenkern, Endrand, Koda, Onset, Nukleus, Auslautverhärtung, deutsche Sprache, Phonologie, Phonetik.
Häufig gestellte Fragen zur Silbenstruktur der deutschen Sprache
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet einen umfassenden Überblick über die Silbenstruktur in der deutschen Sprache. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Text behandelt den Silbenbegriff, das allgemeine Silbenbaugesetz, die Sonoritätshierarchie und die detaillierte Analyse der Silbenbestandteile (Anfangsrand, Silbenkern, Endrand) mit Beispielen aus der deutschen Sprache.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung; 2. Silbenbegriff und Terminologie; 3. Das allgemeine Silbenbaugesetz; 4. Zu den Bestandteilen der Silbe; 5. Zusammenfassung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Silbenstruktur, beginnend mit der Definition des Silbenbegriffs und der Terminologie bis hin zur detaillierten Analyse der einzelnen Silbenbestandteile und ihrer Interaktionen.
Was ist das allgemeine Silbenbaugesetz?
Das allgemeine Silbenbaugesetz beschreibt die Prinzipien der Silbenbildung. Der Text erläutert das Schema einer Silbe und die Rolle der Sonoritätshierarchie dabei. Die Sonoritätshierarchie ordnet die Laute nach ihrer Sonorität (Klangfülle), wobei der sonorste Laut den Silbenkern bildet. Die Erklärung des Gesetzes soll ein besseres Verständnis der Silbenstruktur und der Beziehungen zwischen den einzelnen Bestandteilen ermöglichen.
Welche Bestandteile hat eine Silbe?
Der Text unterscheidet drei Hauptbestandteile einer Silbe: den Anfangsrand (Onset), den Silbenkern (Nukleus) und den Endrand (Koda). Der Anfangsrand umfasst die Konsonanten vor dem Silbenkern, der Silbenkern den sonorantesten Laut der Silbe, und der Endrand die Konsonanten nach dem Silbenkern. Der Text analysiert jeden Bestandteil detailliert, inklusive Variationen wie einfache und komplexe Anfangsrandstrukturen und Phänomene wie die Auslautverhärtung im Endrand.
Was ist die Sonoritätshierarchie?
Die Sonoritätshierarchie ist ein wichtiges Prinzip im allgemeinen Silbenbaugesetz. Sie ordnet die Laute nach ihrer Sonorität, also ihrer Klangfülle. Laute mit hoher Sonorität (z.B. Vokale) bilden den Kern der Silbe, während weniger sonore Laute (z.B. Konsonanten) eher am Rand stehen. Diese Hierarchie bestimmt die mögliche Anordnung von Lauten innerhalb einer Silbe und trägt zum Verständnis der Silbenstruktur bei.
Was ist die Auslautverhärtung?
Die Auslautverhärtung ist ein typisch deutsches Phänomen, das im Kapitel über die Bestandteile der Silbe behandelt wird. Dabei werden stimmhafte Konsonanten am Silbenende als stimmlose Konsonanten ausgesprochen (z.B. "Tag" wird mit einem stimmlosen /k/ am Ende ausgesprochen). Die Erklärung dieses Phänomens verdeutlicht die praktische Anwendung der theoretischen Konzepte der Silbenstruktur.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter des Textes umfassen: Silbe, Silbenstruktur, Silbenbaugesetz, Sonoritätshierarchie, Anfangsrand, Silbenkern, Endrand, Koda, Onset, Nukleus, Auslautverhärtung, deutsche Sprache, Phonologie, Phonetik. Diese Begriffe repräsentieren die zentralen Themen und Konzepte, die im Text behandelt werden.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Dieser Text richtet sich an Personen, die sich mit der Struktur der deutschen Sprache und insbesondere mit der Phonologie befassen. Er eignet sich für Studenten der Linguistik, Sprachwissenschaftler und alle, die ein tiefergehendes Verständnis der Silbenstruktur der deutschen Sprache erlangen möchten.
- Quote paper
- Aileen Enders (Author), 2007, Zur Struktur und den Bestandteilen des Einsilbers in der deutschen Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83216