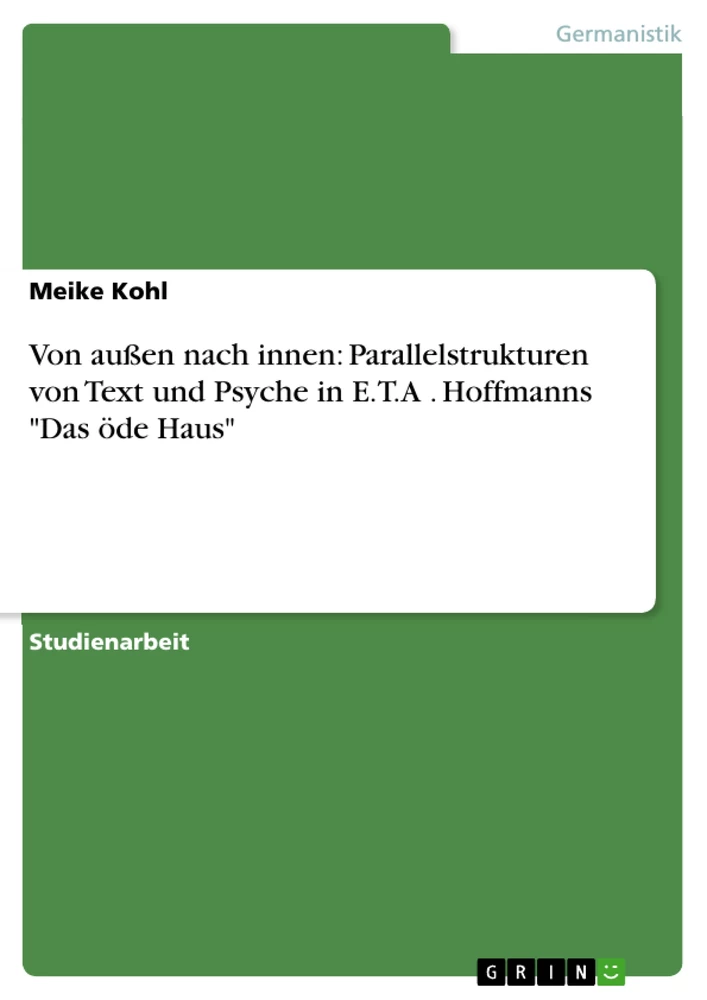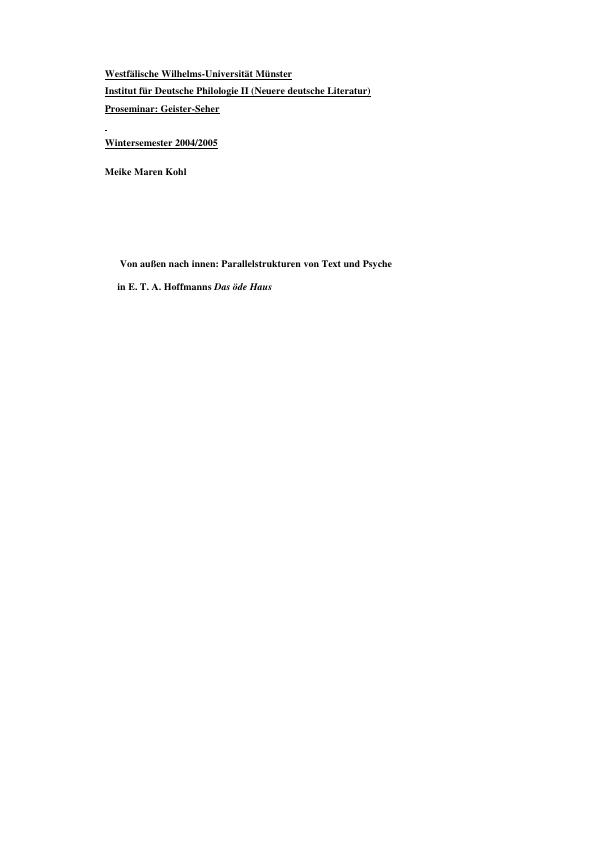Ernst Theodor Amadeus Hoffmanns 1817 erschienene Erzählung Das öde Haus steht an exponierter Stelle des zweiten Teils des Zyklus Nachtstücke. Obwohl eini-ge Ähnlichkeiten mit dem dazu im ersten Teil parallel gestellten Sandmann vor-handen sind, wird sich hier nur auf den Text des öden Hauses selbst bezogen. Nach einer strukturellen Analyse wird gezeigt, dass das öde Haus einen sehr eigenen Wirklichkeitsanspruch hat. Die Arbeit steht unter der Prämisse, dass eine klar von außen nach innen verlaufende Struktur erkennbar ist, die schon in der Form angelegt ist. Parallel dazu entwickelt sich der Krankheitsverlauf Theodors, der während dieses Fortschreitens immer tiefer in die Psyche eindringt. Der Versuch einer psy-choanalytischen Deutung liegt also nahe. Strukturell kann man von einem parallel zum Krankheitsverlauf Theodors immer tiefer ins Innere fortschreitenden Äußeren sprechen. Es wird also zunächst einmal auf Form und Funktion eingegangen wer-den, um dann unter Berücksichtigung von stilistischen Aspekten und Motiven auf Deutungsweisen zu kommen. Am Ende wird auf die gesellschaftlichen Verhältnis-se des 19. Jahrhunderts übertragen. Dabei wird sich auf den Handlungsablauf konzentriert werden und nicht auf die Aufklärung der Geschehnisse am Ende, welche für die Struktur nicht von großer Bedeutung ist.
Inhaltsverzeichnis
- Voraussetzungen
- Aufbau der Erzählung
- Erzählerfunktion in Rahmen- und Binnenhandlung
- Struktur
- Erzählräume
- Der imaginäre phantastische Raum
- Der 1. phantastische Raum: die Vision Theodors
- Der 2. phantastische Raum: die Erscheinung im Spiegelbild
- Belebung des toten Gegenstands
- Innere Projektion
- Der 3. phantastische Raum: Das Eindringen in das öde Haus
- Die psychische Erkrankung
- Kindheitstrauma und Folgen
- Das Spiegelmotiv
- Enthüllung des öden Hauses
- Das Heraustreten des Inneren ins Äußere
- Identitätskrise der Dichter
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert E.T.A. Hoffmanns Erzählung „Das öde Haus“ und untersucht, wie die Struktur des Textes parallel zur psychischen Entwicklung des Protagonisten Theodor verläuft. Die Arbeit argumentiert, dass die Geschichte eine klare Progression von außen nach innen zeigt, die sich sowohl in der Form als auch in der Thematik widerspiegelt.
- Die parallelen Strukturen von Text und Psyche
- Das Eindringen in das Innere der Psyche
- Die Rolle von Erzählräumen und Perspektiven
- Die Funktion des Spiegelmotivs und die Frage nach der Realität
- Die gesellschaftlichen Verhältnisse des 19. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
Voraussetzungen: Dieser Abschnitt stellt die Erzählung „Das öde Haus“ im Kontext von E.T.A. Hoffmanns Werk und dem Zyklus „Nachtstücke“ vor. Es wird die Prämisse der Arbeit dargelegt: die parallele Struktur von Text und Psyche sowie die Bedeutung der vom Äußeren zum Inneren verlaufenden Progression.
Aufbau der Erzählung: Dieses Kapitel beleuchtet die Erzählstruktur von „Das öde Haus“. Es werden die Rollen des auktorialen Erzählers in der Rahmenhandlung und des personalen Erzählers Theodor in der Binnenhandlung analysiert. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Perspektiven und der komplexen Struktur der Geschichte.
Erzählräume: Der Abschnitt untersucht die verschiedenen Erzählräume, die in der Binnenhandlung entstehen. Dazu gehören die Wahrnehmungen verschiedener Personen sowie die Geschichte des Obristen, die als Parallele zur psychischen Entwicklung Theodors dient.
Die psychische Erkrankung: Dieses Kapitel widmet sich der Darstellung der psychischen Erkrankung Theodors und analysiert die Rolle von Kindheitstrauma und dem Spiegelmotiv als Symbol für seine innere Zerrissenheit.
Enthüllung des öden Hauses: Der Abschnitt beleuchtet die Enthüllung des „öden Hauses“ und seine Beziehung zum Inneren und Äußeren. Es wird die Identitätskrise des Protagonisten und die Bedeutung der parallelen Strukturen von Text und Psyche hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von E.T.A. Hoffmanns „Das öde Haus“ unter Verwendung von Schlüsselbegriffen wie Erzählstruktur, Perspektiven, Traumata, Spiegelmotiv, psychische Erkrankung, Innen- und Außenwelt, und die gesellschaftlichen Verhältnisse des 19. Jahrhunderts.
- Quote paper
- Meike Kohl (Author), 2005, Von außen nach innen: Parallelstrukturen von Text und Psyche in E.T.A . Hoffmanns "Das öde Haus", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83085