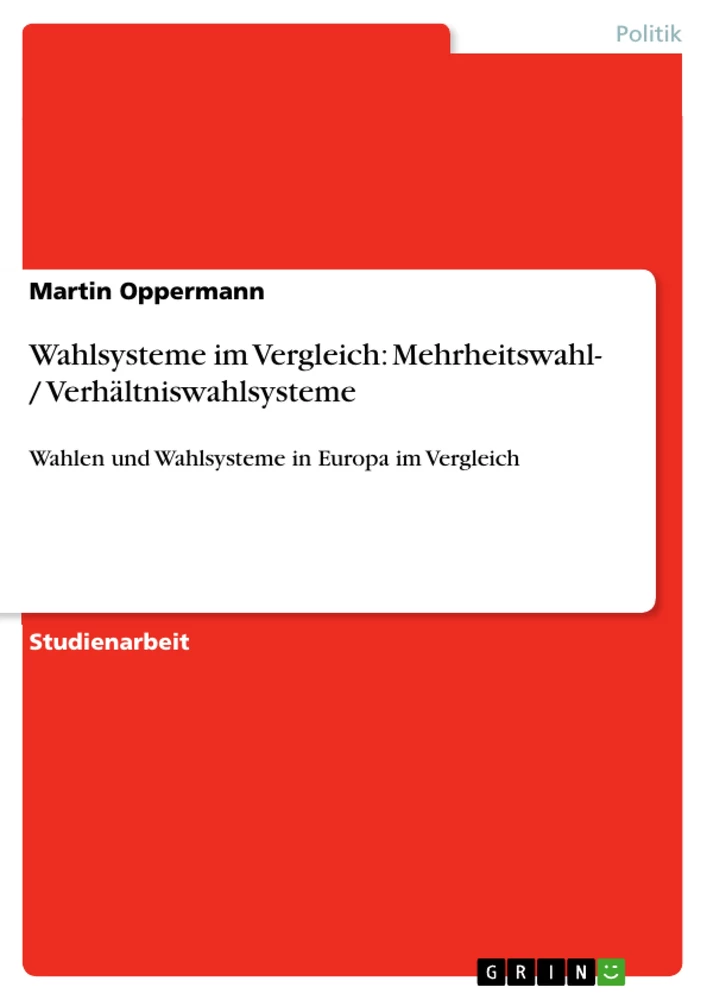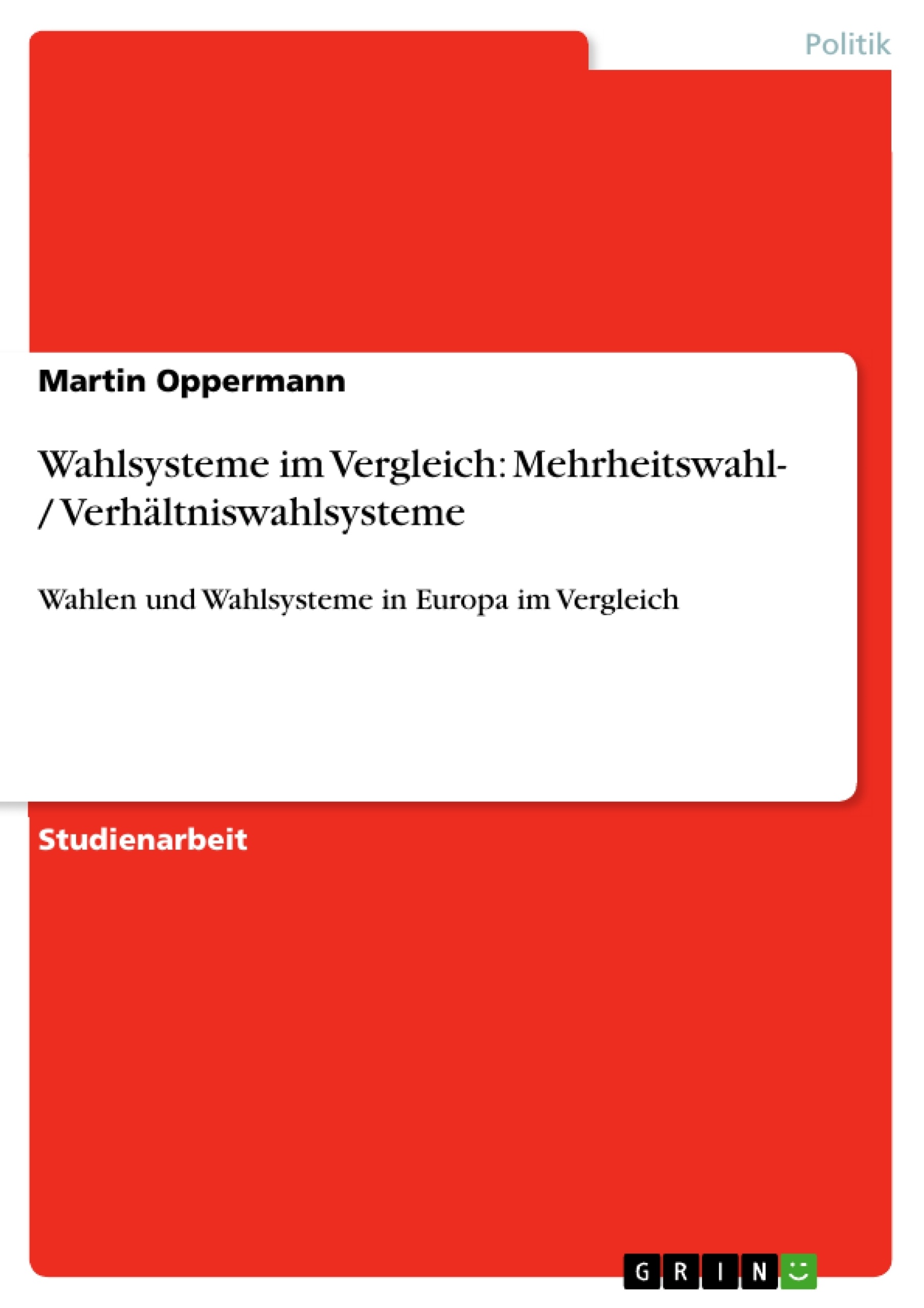Wahlen sind in demokratischen Staaten ein wichtiges Partizipationskriterium der wahlberechtigten Bevölkerung. Es gibt verschiedene, vom politischen System abhängige, Wahlen. In ieser Hausarbeit sollen ausschließlich Wahlen kompetitiver Systeme betrachtet werden. „Soll der Wähler im eigentlichen Sinne wählen können, so muss er Auswahlmöglichkeiten und Wahlfreiheit besitzen. Nur wer als Wähler eine Auswahl zwischen mindestens zwei Angeboten hat, kann wählen. Und er muss zwischen den Angeboten frei entscheiden können, sonst hätte er nicht die Wahl. Auswahlmöglichkeiten und Wahlfreiheit dürfen aber nicht nur auf dem Papier stehen. Sie müssen rechtlich gesichert sein. Wir bezeichnen Wahlen, für die diese Voraussetzungen gelten, als kompetitive Wahlen“ (Nohlen Dieter S. 23). Diese Voraussetzungen werden im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland auch „Wahlrechtsgrundsätze“ genannt. „Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt“ (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Artikel 38). In den westlichen Industrieländern gibt es unterschiedliche Wahlsysteme, die sich jedoch an zwei Grundtypen orientieren. Diese Grundtypen werden als Mehrheitswahl und Verhältniswahl bezeichnet. „In Mehrheitswahlsystemen wird die parlamentarische Mehrheit für eine Partei oder ein Parteienbündnis angestrebt. Dabei geht es im wesentlichen darum, eine Partei (ein Parteienbündnis), die (das) in Stimmen nicht die absolute Mehrheit erhalten hat, nach Mandaten zur parteilichen Mehrheit zu befähigen. (…) In Verhältniswahlsystemen wird im Prinzip die möglichst getreue Wiedergabe der in der Bevölkerung bestehenden sozialen Kräfte und politischen Gruppen angestrebt. Stimmanteile und Mandatsanteile sollen sich in etwa entsprechen“ (Nohlen, Dieter S.132). Aus diesen Definitionen lässt sich folgende Fragestellung ableiten: Wie unterscheiden sich europäische Wahlsysteme in Entscheidungsgerechtigkeit und Mehrheitsfindung? Dies soll an zwei Nationen exemplarisch dargestellt und erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Fragestellung
- Absolute Mehrheitswahl
- Das Wahlsystem Frankreichs
- Personalisierte Verhältniswahl
- Das Wahlsystem der Bundesrepublik Deutschland
- Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Unterschiede zwischen europäischen Wahlsystemen hinsichtlich Entscheidungsgerechtigkeit und Mehrheitsfindung. Sie analysiert zwei exemplarische nationale Wahlsysteme: das absolute Mehrheitswahlsystem in Frankreich und das personalisierte Verhältniswahlsystem in Deutschland.
- Vergleichende Analyse von Mehrheitswahl- und Verhältniswahlsystemen
- Bewertung der Entscheidungsgerechtigkeit verschiedener Wahlsysteme
- Untersuchung der Mehrheitsfindungsprozesse in unterschiedlichen politischen Systemen
- Analyse des französischen und deutschen Wahlsystems im Kontext ihrer jeweiligen politischen Geschichte und Kultur
- Bewertung der Vor- und Nachteile verschiedener Wahlsysteme
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung und Fragestellung
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Bedeutung von Wahlen in demokratischen Staaten hervorhebt und die verschiedenen Arten von Wahlen erläutert. Anschließend wird der Fokus auf kompetitive Wahlen gelegt, die durch Auswahlmöglichkeiten und Wahlfreiheit charakterisiert sind. Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Wie unterscheiden sich europäische Wahlsysteme in Entscheidungsgerechtigkeit und Mehrheitsfindung?
Absolute Mehrheitswahl
Dieses Kapitel behandelt die Absolute Mehrheitswahl in Einerwahlkreisen, auch bekannt als Two-Round-System. Es wird erläutert, wie dieses Wahlsystem funktioniert und welche Vor- und Nachteile es bietet. Frankreich wird als praktisches Beispiel für die Anwendung der Absoluten Mehrheitswahl in Einerwahlkreisen herangezogen. Das Kapitel beleuchtet die politische Entwicklung in Frankreich seit 1877 und die Einführung des Mehrheitswahlsystems in der V. Republik.
Personalisierte Verhältniswahl
Dieses Kapitel befasst sich mit der Personalisierten Verhältniswahl, die in Deutschland angewendet wird. Es wird erläutert, wie dieses Wahlsystem funktioniert und welche Vor- und Nachteile es bietet. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Funktionsweise des Wahlsystems und seiner Auswirkungen auf die politische Landschaft in Deutschland.
Schlüsselwörter
Mehrheitswahl, Verhältniswahl, Entscheidungsgerechtigkeit, Mehrheitsfindung, Wahlsystem, Frankreich, Deutschland, Two-Round-System, Personalisierte Verhältniswahl, politische Kultur, politische Geschichte, Vor- und Nachteile von Wahlsystemen.
- Quote paper
- Martin Oppermann (Author), 2003, Wahlsysteme im Vergleich: Mehrheitswahl- / Verhältniswahlsysteme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82936