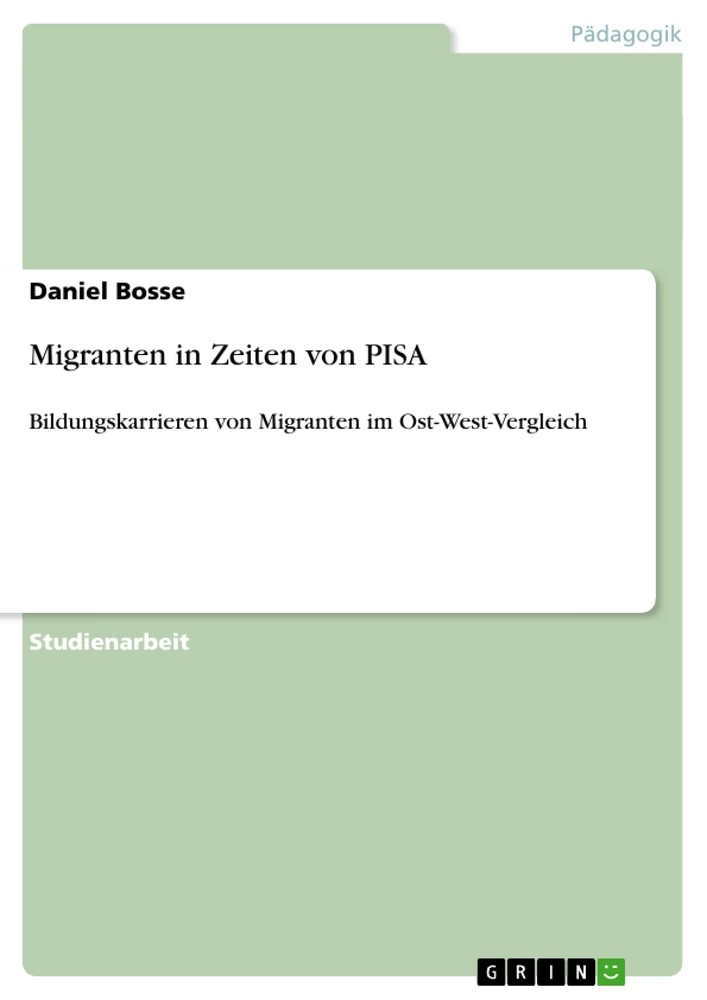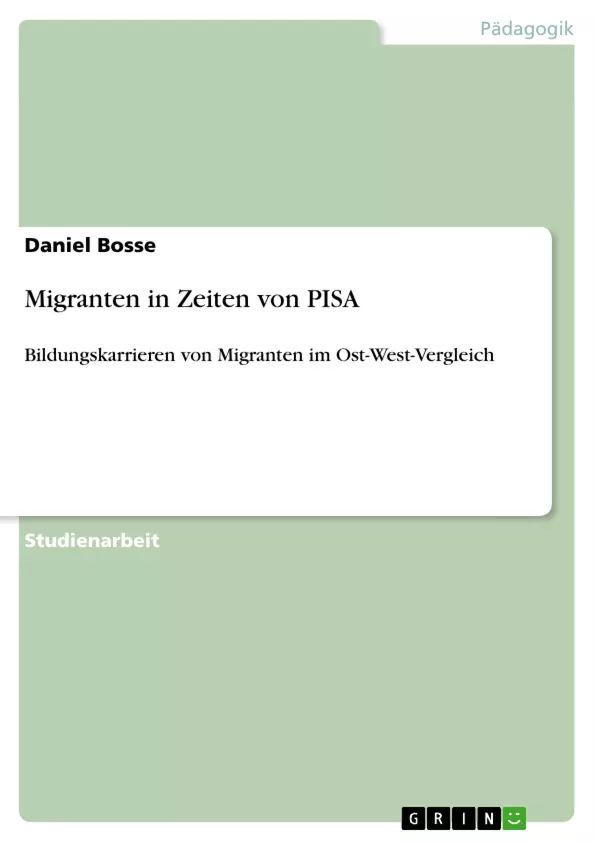Seit dem durchschnittlichen Abschneiden der deutschen Schüler bei den letzten OECD PISA – Studie (Programme for International Student Assessment) ist man auf der Suche nach Gründen für diese Ergebnisse. In alle Himmelsrichtungen sind Bildungsforscher und Pädagogen ausgeströmt, um den Aufbau der Hierbei möchte der Autor nicht in den Chor der Kritiker der HeterogenBildungseinrichtungen sowie die unterschiedlichen Lehrpläne der vermeintlichen PISA-Bestplatzierten zu studieren. Aber auch im Inland wird nach den Ursachen der „Bildungsmisere“ gesucht. Dabei wird oft der hohe Anteil von MigrantInnen an den Schulen und in den Klassenverbänden und deren Einstellung zur Schule als Grund genannt. Dieses ist nicht unbedingt ein falsches Argument, wenn man lediglich den hohen Anteil von MigrantInnen an Haupt- und Sonderschulen auf der einen Seite und den niedrigen an Gymnasien auf der anderen betrachtet. Gleichwohl fällt in den Schulstatistiken auf, dass der relative Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund an Gymnasium in den neuen Bundesländern höher ist als in den alten Bundesländern, respektive der niedrige Anteil von Migrantenkindern an Sonderschulen in den neuen Bundesländern . Ebenfalls zeigen die unterschiedlichen Studien, dass der Bildungserfolg von Kindern besonders an den wirtschaftlichen Erfolg der Eltern gebunden ist und daher in Anbetracht der hohen Arbeitslosenzahlen unter den verschiedenen Einwanderungsgruppen (teilweise doppelt so hoch wie bei Einheimischen), deren Kinder – entgegen der propagierten Chancengleichheit – besonders stark betroffen sind. Zudem wird die Existenz von Schülern mit Migrationshintergrund nicht als Bereicherung für alle empfunden, sondern eher als eine Belastung für das Schulsystem. In der folgenden Arbeit soll die oben genannte Tatsache, dass der relative Anteil von Migrantenkindern an Gymnasien in Ländern wie Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt fast doppelt bis viermal so hoch ist als in den anderen Ländern, untersucht werden. Welche Gründe gibt es hierfür? Liegt es an der Beschaffenheit des föderalen Schulsystems, an der unterschiedlichen Zusammensetzung des Migrantenmilieus oder ist es auf die in den alten Ländern tradierte Anwendung der „institutionellen Diskriminierung“ zurückzuführen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Rahmen
- Milieustruktur
- Schulsystem
- Institutionelle Diskriminierung
- Begriffsklärung
- Primärbereich
- Sekundarbereich
- Bildungskarrieren im Ost-West-Vergleich - eine Auswertung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, warum der relative Anteil von Migrantenkindern an Gymnasien in den neuen Bundesländern deutlich höher ist als in den alten Bundesländern.
- Einfluss des föderalen Schulsystems auf die Bildungskarrieren von Migrantenkindern
- Zusammensetzung des Migrantenmilieus und dessen Auswirkungen auf die Bildungserfolge
- Rolle von institutioneller Diskriminierung im Bildungssystem
- Chancengleichheit im Bildungsbereich für Kinder nicht-deutscher Herkunft
- Bildungskarrieren von Migrantenkindern im Ost-West-Vergleich
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Diskussion um die Bildungssituation von Migrantenkindern im Kontext der PISA-Studie. Sie stellt die Problematik des hohen Anteils von Migrantenkindern an Haupt- und Sonderschulen und den niedrigen Anteil an Gymnasien in den alten Bundesländern im Vergleich zu den neuen Bundesländern dar.
Das Kapitel "Theoretischer Rahmen" setzt sich mit den soziokulturellen Beschaffenheiten und den Schulgesetzen der einzelnen Länder auseinander, um die Argumente der Befürworter der Homogenität zu entkräften. Dabei werden die Zusammensetzung der Bevölkerung, die Erwerbsquote und die Humankapitaltheorie in Bezug auf die Bildungsinvestition einbezogen.
Schlüsselwörter
Bildungskarrieren, Migranten, Ost-West-Vergleich, PISA-Studie, institutionelle Diskriminierung, föderales Schulsystem, Milieustruktur, Humankapitaltheorie, Chancengleichheit, Heterogenität.
Häufig gestellte Fragen
Warum haben Migrantenkinder in Ostdeutschland öfter Erfolg am Gymnasium?
Die Arbeit untersucht, warum der relative Anteil von Migrantenkindern an Gymnasien in den neuen Bundesländern deutlich höher ist als in den alten Bundesländern.
Was ist „institutionelle Diskriminierung“ im Bildungswesen?
Es bezeichnet Strukturen und Praktiken innerhalb des Schulsystems, die Kinder nicht-deutscher Herkunft benachteiligen, oft unabhängig von ihrer individuellen Leistung.
Welchen Einfluss hat der wirtschaftliche Erfolg der Eltern?
Studien zeigen, dass der Bildungserfolg in Deutschland stark an den ökonomischen Status der Eltern gebunden ist, was Migrantenfamilien mit hoher Arbeitslosigkeit besonders trifft.
Was besagt die Humankapitaltheorie in diesem Kontext?
Sie wird herangezogen, um Bildungsinvestitionen in Bezug auf die soziokulturelle Zusammensetzung des Migrantenmilieus zu analysieren.
Ist Heterogenität in Schulen eine Belastung?
Der Autor kritisiert die Sichtweise, dass Migranten eine Belastung seien, und plädiert dafür, Vielfalt als Bereicherung für das Schulsystem wahrzunehmen.
- Quote paper
- Daniel Bosse (Author), 2005, Migranten in Zeiten von PISA, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82927