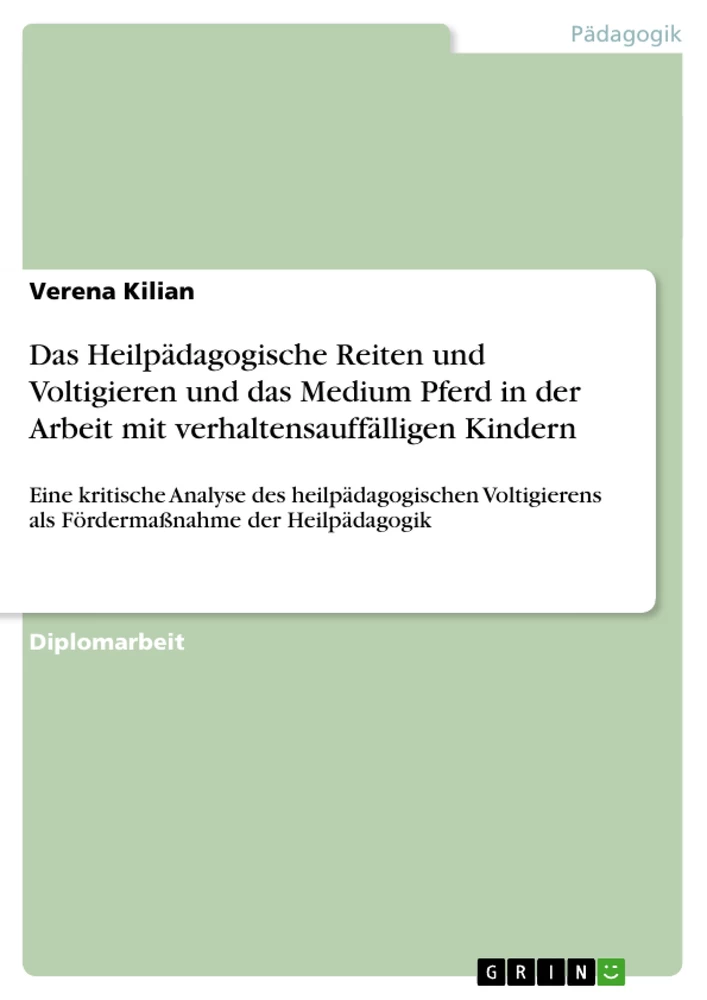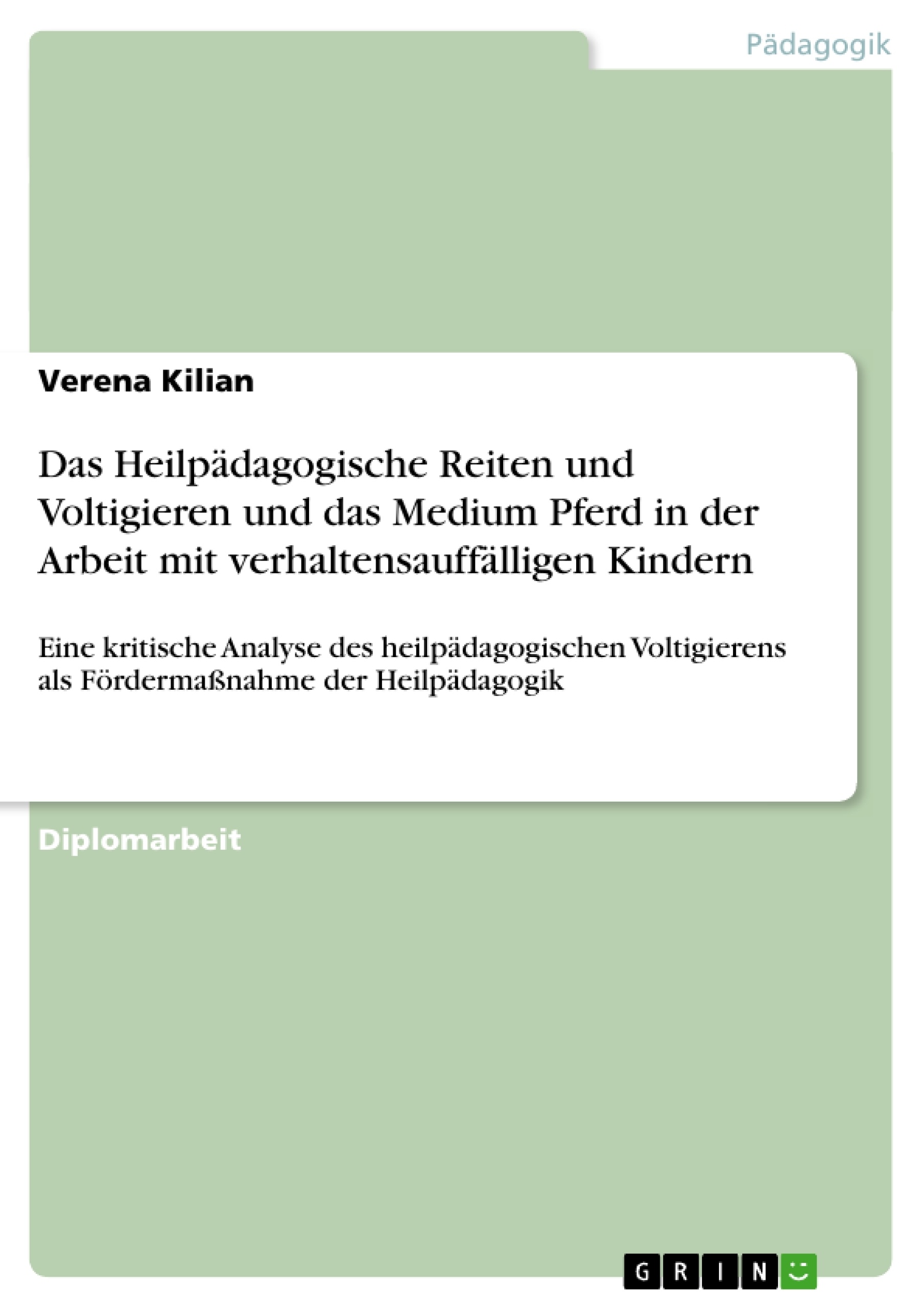Der Einsatz von Tieren in der Pädagogik beruht auf der Erkenntnis, dass Tiere dem
Menschen nicht nur Gesellschaft bieten, sondern eine wohltuende und heilende
Wirkung auf Körper und Seele des Menschen haben. Die verschiedenen Lebewesen
wie Kaninchen, Hund, Delphin und Pferd haben dabei ihre ganz individuelle
Anziehungskraft und Wirkung. Dies lässt sich auf die verschiedenen
Charaktereigenschaften der Tiere zurückführen. Meine Aufmerksamkeit gilt in
hohem Maße dem Pferd, da ich bereits seit meinem 6. Lebensjahr durch den
Reitsport, die Nähe des Tieres genießen konnte. Das Pferd bot mir dabei oftmals eine
Rückzugsmöglichkeit und erwies sich als verlässlicher Partner, in für mich als
schwierig erlebten Situationen. Die besondere Anziehungskraft des Pferdes setzte
sich über die Jahre fort und besteht bis heute. In den vergangenen Jahren erteilte ich
vielen Kindern Reitunterricht und bemerkte oft die wohltuende und erholsame
Wirkung des Pferdes auf die Kinder.
Im Rahmen eines Blockpraktikums, erlebte ich zum ersten Mal, wie das Pferd auch
in der pädagogischen Praxis eingesetzt werden kann. Das Praktikum absolvierte ich
in einem Heilpädagogischen Zentrum, welches über einen eigenen kleinen
Pferdestall verfügte und die Maßnahme des Heilpädagogischen Reiten/Voltigieren
anbot. Dort konnte ich erleben, wie sich Kinder im Umgang mit Pferden verändern.
Kinder mit aggressiven Verhaltensweisen wurden plötzlich ruhig, hilfsbereit und
umsichtig. Zurückhaltende oder stark verunsicherte Kinder schienen auf dem Rücken
des Pferdes eine Möglichkeit zu finden, aus sich heraus zu kommen und sich ihren
Ängsten zu stellen. Diese Erfahrungen weckten bei mir das Interesse, das Pferd nicht
nur innerhalb des Reitsports zu betrachten, sondern die zusätzliche pädagogische
Bedeutung zu ergründen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Therapeutisches Reiten in Medizin, Psychologie und Pädagogik
- 2.1 Hippotherapie als krankengymnastische Förderung
- 2.2 Der Behindertenreitsport als integrative Freizeitgestaltung
- 2.3 Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren als ganzheitliche Förderung
- 2.4 Weiterbildung zur Reit- Voltigierpädagogin
- 3. Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren
- 3.1 Abgrenzung zwischen Voltigieren und Heilpädagogischen Voltigieren
- 3.2 Entwicklung des HPR/V in der Schweiz und Deutschland
- 3.3 Zielgruppen des HPR/V
- 3.4 Förderdimensionen im HPR/V
- 3.4.1 Motorische Förderaspekte
- 3.4.2 Kognitive Förderaspekte
- 3.4.3 Emotionale Förderaspekte
- 3.4.4 Soziale Förderaspekte
- 3.5 Die Rolle der Voltigierpädagogin
- 3.6 Das Beziehungsdreieck im HPR/V
- 3.6.1 Kontakt zwischen Kind und Pferd
- 3.6.2 Kontakt zwischen Voltigierpädagogin und Pferd
- 3.6.3 Kontakt zwischen Kind und Voltigierpädagogin
- 3.6.4 Beziehungsdreieck in der Gruppe
- 4. Die Wirkung der Mensch-Pferd-Beziehung
- 4.1 Der Kontakt zum Pferd- ein menschliches Bedürfnis
- 4.2 Der Bewegungsdialog zwischen Mensch und Pferd
- 4.3 Die Bedeutung des “Getragenwerdens”
- 4.4 Die vom Pferd ausgehende Beziehungsinhalte
- 4.5 Die emotionale Kontaktaufnahme zum Pferd
- 5. Zum Begriff „Verhaltensauffälligkeit“
- 5.1 Definition
- 5.2 Ätiologie
- 5.2.1 Psychosoziale Faktoren
- 5.2.2 Biologische Faktoren
- 5.2.3 Gesellschaftliche Faktoren
- 5.3 Theoretisch-wissenschaftliche Ansätze der Intervention
- 5.3.1 Der lerntheoretische Ansatz
- 5.3.2 Der biophysische Ansatz
- 5.3.3 Der humanistisch-psychologische Ansatz
- 5.4 Pädagogisch-therapeutische Verfahren
- 5.4.1 Verhaltensmodifikation
- 5.4.2 Das Spiel
- 5.4.3 Hilfreiche Gesprächsführung
- 6. HPR/V als Fördermaßnahme für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten
- 6.1 Bedeutung der Motivation im Lernprozess
- 6.2 Die Wichtigkeit der Selbsterfahrung
- 6.3 Spezielle Förderaspekte für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten
- 6.3.1 Förderung auf emotionaler Ebene
- 6.3.2 Förderung auf sozialer Ebene
- 6.3.3 Förderung auf individueller Ebene
- 7. Notwendigkeit und Effektivität des HPR/V
- 7.1 Beobachtungsverfahren auf der Verhaltensebene
- 7.2 Einschätzung zur Notwendigkeit des HPR/V
- 7.3 Wissenschaftliche Untersuchungen der Maßnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die heilpädagogischen Fördermöglichkeiten des heilpädagogischen Reitens und Voltigierens (HPR/V) bei verhaltensauffälligen Kindern. Der Fokus liegt auf der Wirkung des Pferdes als pädagogisches Medium und der Klärung des positiven Einflusses von HPR/V auf das Verhalten der Kinder.
- Wirkung des Pferdes als therapeutisches Medium
- Heilpädagogische Förderansätze im HPR/V
- Behandlung verhaltensauffälliger Kinder mit HPR/V
- Theoretische Grundlagen des HPR/V
- Mensch-Pferd-Beziehung im therapeutischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die persönliche Motivation der Autorin für die Wahl des Themas, basierend auf eigenen Erfahrungen im Reitsport und einem Praktikum in einem heilpädagogischen Zentrum. Es wird auf die bisherige mangelnde Akzeptanz und wissenschaftliche Untermauerung des HPR/V hingewiesen und die Notwendigkeit einer tiefergehenden Untersuchung der Methode betont, insbesondere im Hinblick auf die positive Beeinflussung des Verhaltens von Kindern. Die Arbeit zielt darauf ab, die Wirkung des HPR/V bei verhaltensauffälligen Kindern zu untersuchen und den positiven Einfluss von Pferd und Voltigieren auf das Verhalten der Kinder zu belegen.
2. Therapeutisches Reiten in Medizin, Psychologie und Pädagogik: Dieses Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über verschiedene Formen des therapeutischen Reitens, von der Hippotherapie als krankengymnastische Maßnahme über den Behindertenreitsport bis hin zum heilpädagogischen Reiten und Voltigieren als ganzheitliche Fördermethode. Es werden die verschiedenen Ansätze und Zielsetzungen der jeweiligen Methoden erläutert und ihre unterschiedlichen Schwerpunkte herausgestellt. Der Abschnitt über die Weiterbildung zur Reit- und Voltigierpädagogin unterstreicht die professionelle Grundlage der Methode.
3. Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren: Dieses Kapitel fokussiert auf das HPR/V, indem es die Methode von anderen Formen des therapeutischen Reitens abgrenzt und ihre historische Entwicklung nachzeichnet. Es beschreibt die Zielgruppen und Förderdimensionen des HPR/V, welche die motorischen, kognitiven, emotionalen und sozialen Bereiche umfassen. Die Rolle der Voltigierpädagogin und die Bedeutung des Beziehungsdreiecks zwischen Kind, Pferd und Pädagogin werden detailliert analysiert, wobei die Interaktionen und deren Einfluss auf den Therapieerfolg hervorgehoben werden.
4. Die Wirkung der Mensch-Pferd-Beziehung: Dieses Kapitel erforscht die besondere Wirkung der Mensch-Pferd-Beziehung im therapeutischen Kontext. Es wird die Bedeutung des Kontakts zum Pferd als menschliches Bedürfnis, der Bewegungsdialog zwischen Mensch und Pferd und das „Getragenwerden“ als wichtige Aspekte untersucht. Die emotionalen und sozialen Aspekte der Kontaktaufnahme zum Pferd und deren Bedeutung für die therapeutische Wirkung werden ausführlich dargestellt und mit Beispielen aus der Praxis illustriert.
5. Zum Begriff „Verhaltensauffälligkeit“: Das Kapitel liefert eine fundierte Definition des Begriffs „Verhaltensauffälligkeit“ und analysiert dessen Ätiologie unter Berücksichtigung psychosozialer, biologischer und gesellschaftlicher Faktoren. Es werden verschiedene theoretisch-wissenschaftliche Interventionsansätze (lerntheoretisch, biophysisch, humanistisch-psychologisch) vorgestellt und in Bezug auf die Praxis des HPR/V diskutiert. Ein Überblick über relevante pädagogisch-therapeutische Verfahren (Verhaltensmodifikation, Spiel, Gesprächsführung) rundet das Kapitel ab.
6. HPR/V als Fördermaßnahme für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten: In diesem Kapitel wird der Einsatz des HPR/V als Fördermaßnahme für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten im Detail analysiert. Die Bedeutung der Motivation im Lernprozess, die Wichtigkeit der Selbsterfahrung und die spezifischen Förderaspekte auf emotionaler, sozialer und individueller Ebene werden eingehend betrachtet. Die Kapitel erläutert, wie die Methode positive Veränderungen im Verhalten und Wohlbefinden der Kinder bewirken kann.
Schlüsselwörter
Heilpädagogisches Reiten/Voltigieren (HPR/V), Verhaltensauffälligkeit, Pferd als Therapiemedium, Mensch-Pferd-Beziehung, emotionale Förderung, soziale Förderung, motorische Förderung, kognitive Förderung, Pädagogische Intervention, therapeutische Verfahren.
Häufig gestellte Fragen zu "Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht die heilpädagogischen Fördermöglichkeiten des heilpädagogischen Reitens und Voltigierens (HPR/V) bei verhaltensauffälligen Kindern. Der Fokus liegt auf der Wirkung des Pferdes als pädagogisches Medium und dem positiven Einfluss von HPR/V auf das Verhalten der Kinder. Die Arbeit umfasst eine Einleitung, eine Übersicht über therapeutisches Reiten, eine detaillierte Beschreibung von HPR/V, die Wirkung der Mensch-Pferd-Beziehung, eine Auseinandersetzung mit dem Begriff "Verhaltensauffälligkeit", die Anwendung von HPR/V bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten und schließlich die Notwendigkeit und Effektivität dieser Methode.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: verschiedene Formen des therapeutischen Reitens (Hippotherapie, Behindertenreitsport), die Abgrenzung und Entwicklung von HPR/V, die Zielgruppen und Förderdimensionen von HPR/V (motorisch, kognitiv, emotional, sozial), die Rolle der Voltigierpädagogin und das Beziehungsdreieck (Kind-Pferd-Pädagogin), die Wirkung der Mensch-Pferd-Beziehung, Definition und Ätiologie von Verhaltensauffälligkeiten, theoretische und praktische Interventionsansätze, der Einsatz von HPR/V bei verhaltensauffälligen Kindern und die wissenschaftliche Fundierung der Methode.
Welche Zielgruppen werden in der Arbeit betrachtet?
Die Hauptzielgruppe der Arbeit sind Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten. Die Arbeit betrachtet jedoch auch breitere Zielgruppen des therapeutischen Reitens, einschließlich derjenigen, die von Hippotherapie, Behindertenreitsport und anderen Formen des therapeutischen Reitens profitieren.
Welche Methoden werden im HPR/V eingesetzt?
HPR/V nutzt das Pferd als therapeutisches Medium. Die Arbeit beschreibt die Förderung auf motorischer, kognitiver, emotionaler und sozialer Ebene. Es werden Aspekte wie die Bedeutung der Mensch-Pferd-Beziehung, das "Getragenwerden", der Bewegungsdialog und die emotionale Kontaktaufnahme zum Pferd hervorgehoben. Pädagogisch-therapeutische Verfahren wie Verhaltensmodifikation, Spiel und hilfreiche Gesprächsführung werden ebenfalls im Zusammenhang mit HPR/V diskutiert.
Welche wissenschaftlichen Ansätze werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt lerntheoretische, biophysische und humanistisch-psychologische Ansätze zur Intervention bei Verhaltensauffälligkeiten. Sie bezieht sich auf wissenschaftliche Untersuchungen zur Effektivität des HPR/V und diskutiert Beobachtungsverfahren auf der Verhaltensebene.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Therapeutisches Reiten, Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren, Die Wirkung der Mensch-Pferd-Beziehung, Zum Begriff „Verhaltensauffälligkeit“, HPR/V als Fördermaßnahme für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und Notwendigkeit und Effektivität des HPR/V. Jedes Kapitel fasst die zentralen Inhalte und Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Heilpädagogisches Reiten/Voltigieren (HPR/V), Verhaltensauffälligkeit, Pferd als Therapiemedium, Mensch-Pferd-Beziehung, emotionale Förderung, soziale Förderung, motorische Förderung, kognitive Förderung, Pädagogische Intervention, therapeutische Verfahren.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit untersucht den positiven Einfluss von HPR/V auf das Verhalten verhaltensauffälliger Kinder und soll die Akzeptanz und wissenschaftliche Untermauerung dieser Methode verbessern. Die genauen Schlussfolgerungen sind im Text der Diplomarbeit selbst detailliert dargelegt.
- Quote paper
- Diplom-Heilpädagogin Verena Kilian (Author), 2007, Das Heilpädagogische Reiten und Voltigieren und das Medium Pferd in der Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82891