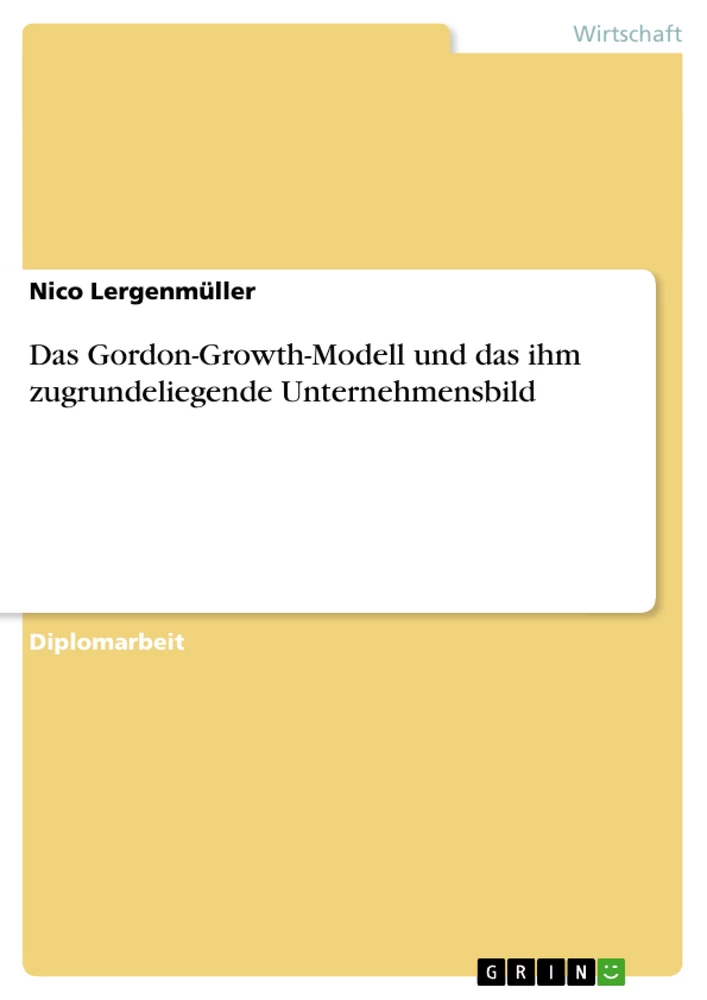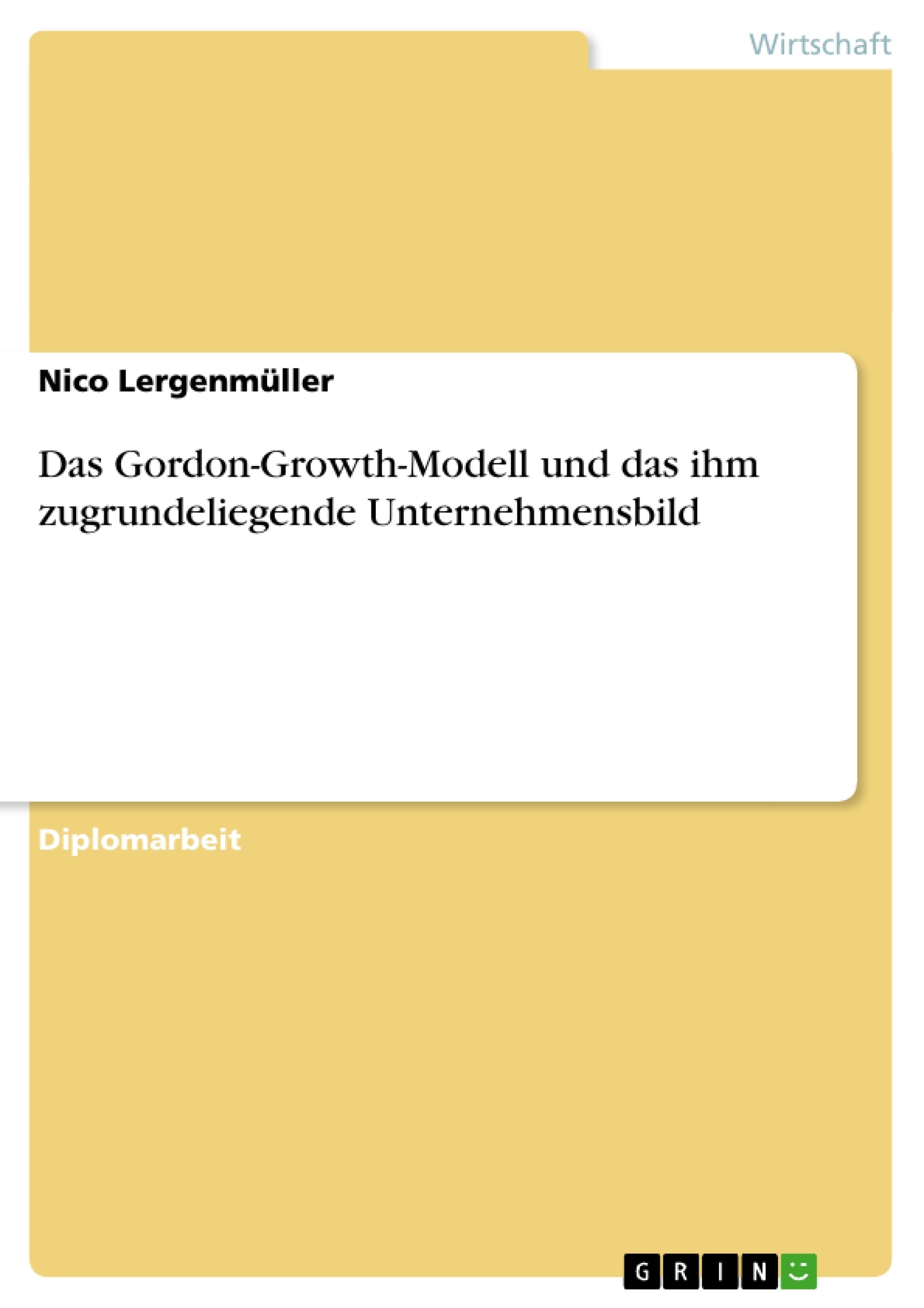Die Gordon-Growth-Formel wurde bereits 1938 von J.B. Williams entwickelt und dann im Jahre 1956 von M.J. Gordon und E. Shapiro wiederentdeckt. Das Gordon-Growth-Modell ist ein sogenanntes Dividendendiskontierungsmodell, das der Ermittlung eines Kapitalbarwertes einer Aktie dient. In solchen Modellen geht man davon aus, dass der Barwert der Investition von der Summe der zu erwartenden diskontierten Rückflüsse (Cash Flows) abhängt.
Die vorliegende Arbeit beschreibt die Herleitung des Gordon-Growth-Modells und die zugrundeliegenden Annahmen. Weiter werden die Kritikpunkte und Grenzen des Modells dargelegt und Lösungsansätze zu den dargestellten Problemen aufgezeigt. In einem nächsten Punkte werden die Anwendungsmöglichkeiten der Formel vorgestellt. Darüber hinaus werden mögliche dem Modell zugrundeliegende Unternehmen über ihr Investitionsverhalten beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Das Gordon-Growth-Modell
- 1.1 Der Stellenwert der Aktie in Deutschland
- 1.2 Das Gordon-Growth-Modell als Dividendendiskontierungsmodell
- 1.3 Das Gordon-Growth-Modell: Annahmen und Herleitung
- 1.4 Die Bestimmung des Dividendenwachstums
- 1.5 Kritikpunkte und Grenzen des Gordon-Growth-Modells
- 2. Erweiterungen des Gordon-Growth-Modells
- 2.1 Lösungsansätze zu den dargestellten Problemen
- 2.2 Mehrstufige Modelle
- 2.3 Anwendungen des Modells
- 3. Das zugrundeliegende Unternehmensbild
- 3.1 Die Abbildung der Unternehmensstruktur durch Rechnungslegungsgrößen
- 3.1.1 Fallbeispiel: Die Oceangroove AG bei konstant wachsendem Buchwert des Eigenkapitals pro Aktie
- 3.1.2 Fallbeispiel: Die Oceangroove AG bei konstant wachsendem Gewinn pro Aktie
- 3.1.3 Fallbeispiel: Die Oceangroove AG bei konstant wachsender Ausschüttungsquote
- 3.2 Investitionsverhalten der Unternehmen im Gordon-Growth-Modell
- 3.2.1 Fallbeispiel: Die Oceangroove AG bei Investitionen in ein Projekt mit positivem Kapitalbarwert
- 3.2.2 Fallbeispiel: Die Oceangroove AG bei Investitionen in ein Projekt mit Null-Kapitalbarwert
- 3.2.3 Fallbeispiel: Die Oceangroove AG bei Investitionen in ein Projekt mit negativem Kapitalbarwert
- 4. Die Bedeutung des Gordon-Growth-Modells
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht das Gordon-Growth-Modell und das ihm zugrundeliegende Unternehmensbild. Ziel ist es, das Modell detailliert zu erklären, seine Annahmen und Grenzen zu analysieren und seine Anwendbarkeit im Kontext verschiedener Unternehmensszenarien zu beleuchten.
- Das Gordon-Growth-Modell als Dividendendiskontierungsmodell
- Annahmen und Kritikpunkte des Gordon-Growth-Modells
- Erweiterungen und Anwendungen des Modells (mehrstufige Modelle)
- Das zugrundeliegende Unternehmensbild und dessen Abbildung durch Rechnungslegungsgrößen
- Der Einfluss des Investitionsverhaltens auf die Modellanwendung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Das Gordon-Growth-Modell: Dieses Kapitel führt in das Gordon-Growth-Modell als Dividendendiskontierungsmodell ein. Es beleuchtet den Stellenwert von Aktien in Deutschland und erklärt detailliert die Herleitung des Modells, inklusive seiner zentralen Annahmen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Bestimmung des Dividendenwachstums und einer kritischen Auseinandersetzung mit den Grenzen und Schwächen des Modells, die im weiteren Verlauf der Arbeit vertieft werden.
2. Erweiterungen des Gordon-Growth-Modells: Aufbauend auf den im ersten Kapitel dargestellten Kritikpunkten werden in diesem Kapitel Lösungsansätze und Erweiterungen des Gordon-Growth-Modells vorgestellt. Der Fokus liegt auf mehrstufigen Modellen, die die Einschränkung des konstanten Dividendenwachstums überwinden. Zusätzlich werden verschiedene Anwendungen des Modells in der Praxis diskutiert und konkrete Beispiele gegeben, um die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des erweiterten Modells zu demonstrieren.
3. Das zugrundeliegende Unternehmensbild: Dieses Kapitel analysiert das implizite Unternehmensbild, das dem Gordon-Growth-Modell zugrunde liegt. Es untersucht, wie die Unternehmensstruktur durch Rechnungslegungsgrößen abgebildet wird und bewertet verschiedene Fallbeispiele (Oceangroove AG) unter unterschiedlichen Bedingungen (konstant wachsendes Eigenkapital, Gewinn, Ausschüttungsquote). Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung des Einflusses des Investitionsverhaltens des Unternehmens auf die Modellanwendung, wobei verschiedene Szenarien mit positivem, negativem und Null-Kapitalbarwert analysiert werden.
4. Die Bedeutung des Gordon-Growth-Modells: Dieses Kapitel (ohne Zusammenfassung, da es sich vermutlich um eine Schlussfolgerung handelt und Spoiler enthalten könnte).
Schlüsselwörter
Gordon-Growth-Modell, Dividendendiskontierungsmodell, Dividendenwachstum, Annahmen, Kritikpunkte, Erweiterungen, mehrstufige Modelle, Unternehmensbild, Rechnungslegungsgrößen, Investitionsverhalten, Kapitalbarwert, Oceangroove AG.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Das Gordon-Growth-Modell
Was ist der Gegenstand der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit befasst sich umfassend mit dem Gordon-Growth-Modell, einem Dividendendiskontierungsmodell zur Aktienbewertung. Sie analysiert das Modell detailliert, beleuchtet seine Annahmen und Grenzen und untersucht seine Anwendbarkeit in verschiedenen Unternehmensszenarien.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: das Gordon-Growth-Modell als Dividendendiskontierungsmodell; seine Annahmen und Kritikpunkte; Erweiterungen und Anwendungen des Modells, insbesondere mehrstufige Modelle; das dem Modell zugrundeliegende Unternehmensbild und dessen Abbildung durch Rechnungslegungsgrößen; sowie den Einfluss des Investitionsverhaltens auf die Modellanwendung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel. Kapitel 1 führt in das Gordon-Growth-Modell ein, inklusive seiner Herleitung, Annahmen und Kritikpunkte. Kapitel 2 präsentiert Erweiterungen und Lösungsansätze, insbesondere mehrstufige Modelle. Kapitel 3 analysiert das dem Modell zugrundeliegende Unternehmensbild und den Einfluss des Investitionsverhaltens anhand von Fallbeispielen der fiktiven Oceangroove AG. Kapitel 4 (Zusammenfassung fehlt, da es sich um Schlussfolgerungen handelt).
Welche Fallbeispiele werden verwendet?
Die Arbeit verwendet die fiktive Oceangroove AG als Fallbeispiel, um die Anwendung des Gordon-Growth-Modells unter verschiedenen Bedingungen zu illustrieren. Die Beispiele untersuchen Szenarien mit konstant wachsendem Buchwert des Eigenkapitals pro Aktie, konstant wachsendem Gewinn pro Aktie, konstant wachsender Ausschüttungsquote und unterschiedlichen Investitionsprojekten (positiver, negativer und Null-Kapitalbarwert).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gordon-Growth-Modell, Dividendendiskontierungsmodell, Dividendenwachstum, Annahmen, Kritikpunkte, Erweiterungen, mehrstufige Modelle, Unternehmensbild, Rechnungslegungsgrößen, Investitionsverhalten, Kapitalbarwert, Oceangroove AG.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Gordon-Growth-Modell detailliert zu erklären, seine Stärken und Schwächen zu analysieren und seine Anwendbarkeit im Kontext verschiedener Unternehmensszenarien zu beleuchten. Sie soll ein umfassendes Verständnis des Modells und seiner Grenzen vermitteln.
- Quote paper
- Diplom Betriebswirt (FH) Nico Lergenmüller (Author), 2003, Das Gordon-Growth-Modell und das ihm zugrundeliegende Unternehmensbild, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82848