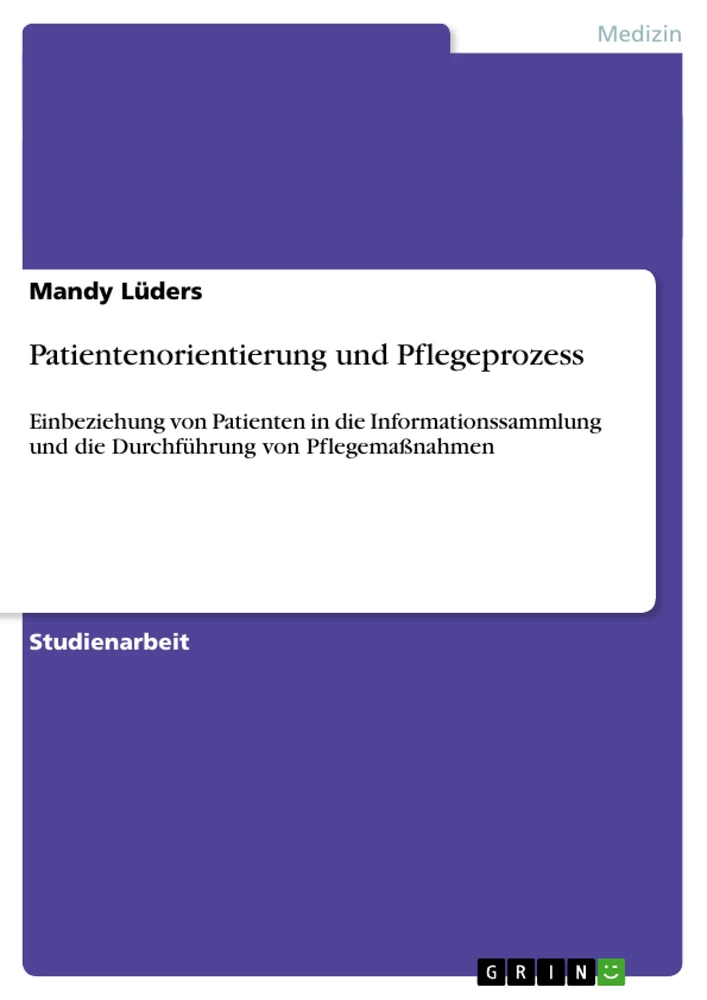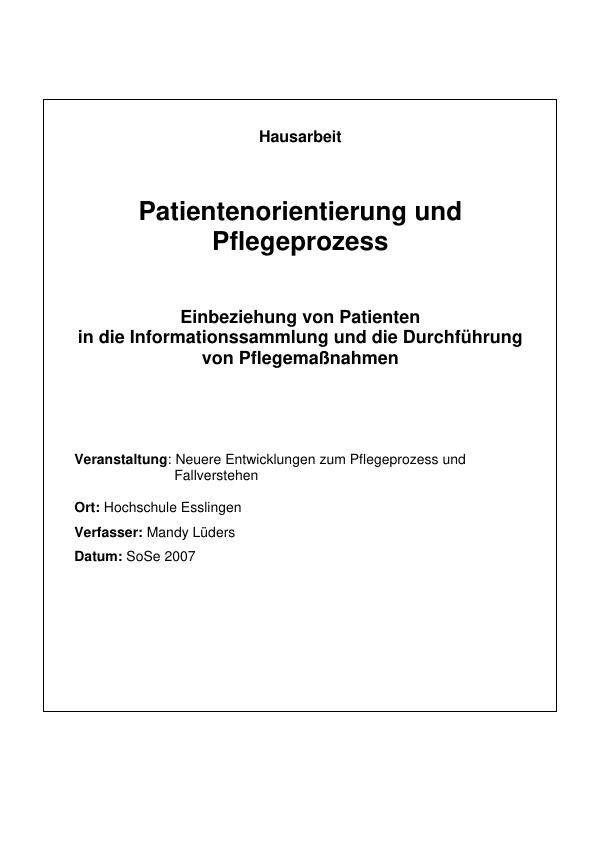Jeder Mensch wird durch Werte beeinflusst. Sie werden stark durch seine Sozialisation geprägt und begleiten ihn ein ganzes Leben lang. Überall trifft er auf moralisch relevante Idealvorstellungen, die ihn auf die eine oder andere Weise leiten. Auch das Fachgebiet der Pflege ist nicht wertfrei. Pflegeleitbilder, -theorien, -klassifikationen, -ziele, -standards oder auch Pflegeprobleme sind durch sie beeinflusst oder entstehen gar auf ihrer Grundlage (vgl. Bobbert, in Wiesemann et al., 2003, S. 89).
Da aber nicht alle Menschen in gleichem Maße sozialisiert werden und immer auch Faktoren wie beispielsweise kulturelle, soziale oder religiöse Aspekte eine Rolle spielen, versteht sich von selbst, dass Werte nie für jeden gleich bedeutsam sein können.
Für die Pflege ergeben sich hier recht brisante Fragestellungen: Inwieweit können zum Beispiel unterschiedliche Ansätze zwischen Patient und Pflegenden berücksichtigt werden und ist das überhaupt Aufgabe der professionellen Pflege? Ist es legitim, dass Pflegende dem Patienten unter Umständen ihre Wertvorstellungen auferlegen (nach dem Motto: „Ich weiß besser, was für sie gut ist“)? Hat der Patient das Recht, sich aktiv in seine Behandlung einzubringen und nur Leistungen einzufordern, die mit seinen Werten konform sind?
Diesen und ähnlichen Fragen unter dem Aspekt professioneller Pflege nachzugehen und speziell in Verbindung mit dem Pflegeprozess zu betrachten, ist Inhalt dieser Hausarbeit. Dabei wird verstärkt die Informationssammlung sowie die konkrete Umsetzung geplanter pflegerischer Maßnahmen als Bestandteile des Pflegeprozesses beleuchtet. Zu Beginn wird dargestellt, was professionelle Pflege ausmacht und welche Bedeutung der Pflegeprozess dabei hat. Es werden verschiedene Prozessmodelle aus Sicht der Patientenorientierung miteinander verglichen und dabei eine geeignete Alternative herausgearbeitet. Anschließend wird darauf eingegangen, was Patientenorientierung, Autonomierecht und Privatheit des Pflegeempfängers beinhalten und versucht diese theoretischen Grundlagen auf konkrete praktische Bestandteile des Pflegeprozesses zu übertragen.
Ziel dieser Ausarbeitung ist darzustellen, wie Pflegende eine patientenorientierte Arbeitsweise im Rahmen der Informationssammlung und der Durchführung von Pflegemaßnahmen konkret umsetzen können und welche Grenzen der Patientenorientierung es gibt.
Inhaltsverzeichnis
- Themenfindung
- 1. Grundlagen der professionellen Pflege
- 1.1. Trägerleitbild
- 1.2. Pflegeleitbild
- 1.3. Pflegetheorie
- 2. Der Pflegeprozess als Teil der professionellen Pflege
- 2.1. Definition des Pflegeprozesses
- 2.2. Vor- und Nachteile des Pflegeprozesses
- 2.3. Pflegeprozessmodelle
- 2.4. Pflegediagnose als Teil des Pflegeprozesses
- 2.5. Pflegevisite und Pflegeprozess
- 3. Definition der Patientenorientierung
- 4. Das Autonomierecht und die Privatsphäre des Patienten
- 4.1. Das Autonomierecht nach Bobbert
- 4.2. Die Privatsphäre des Patienten
- 5. Informationssammlung und Patientenorientierung
- 5.1. Zeitpunkt
- 5.2. Räumlichkeiten
- 5.3. Kommunikationsregeln für ein gelungenes Gespräch
- 5.4. Informationsnahme durch Pflegende
- 5.5. Informationsgabe an den Patienten
- 5.6. Weitere Informationsquellen
- 5.7. Kommunikationsschwierigkeiten
- 6. Durchführung von pflegerischer Maßnahmen und Patientenorientierung
- 6.1. Zeitpunkt
- 6.2. Ort
- 6.3. Durchführung
- 6.4. Recht auf Festlegung des Eigenwohls
- 6.5. Entziehen der Zustimmung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Umsetzung patientenorientierter Arbeitsweisen in der Pflege, insbesondere im Kontext der Informationssammlung und der Durchführung von Pflegemaßnahmen. Das Hauptziel ist es, praktische Vorgehensweisen aufzuzeigen und gleichzeitig die Grenzen der Patientenorientierung zu beleuchten. Die Arbeit analysiert den Pflegeprozess und dessen Bedeutung für eine professionelle und patientenorientierte Pflege.
- Der Pflegeprozess als integraler Bestandteil professioneller Pflege
- Patientenorientierung und deren Umsetzung in der Praxis
- Das Autonomierecht und die Privatsphäre des Patienten
- Effektive Kommunikation zwischen Pflegenden und Patienten
- Grenzen und Herausforderungen der Patientenorientierung
Zusammenfassung der Kapitel
Themenfindung: Diese Einleitung beschreibt die motivationale Grundlage der Arbeit, die in ethischen Fragen professioneller Pflege und der Berücksichtigung individueller Werte von Patienten im Pflegeprozess wurzelt. Es wird die Relevanz der Berücksichtigung unterschiedlicher Wertevorstellungen zwischen Patienten und Pflegenden hervorgehoben und die Forschungsfrage nach dem patientenorientierten Handeln innerhalb des Pflegeprozesses formuliert.
1. Grundlagen der professionellen Pflege: Dieses Kapitel beleuchtet den Wandel des Patientenbildes hin zu einem aktiven Teilnehmer im Behandlungsprozess. Es betont die Notwendigkeit einer wissenschaftlich fundierten Pflegepraxis, die über die traditionellen, gefühlsbasierten Methoden hinausgeht. Die Rolle des Trägerleitbildes und die Bedeutung der Rahmenberufsordnung für professionelle Pflegende werden ebenfalls diskutiert, um den Rahmen für eine qualitätsgesicherte und ethisch verantwortungsvolle Pflege zu etablieren.
2. Der Pflegeprozess als Teil der professionellen Pflege: Dieses Kapitel definiert den Pflegeprozess und bewertet seine Vor- und Nachteile. Es vergleicht verschiedene Pflegeprozessmodelle unter dem Aspekt der Patientenorientierung und versucht, eine passende Alternative zu finden. Der Fokus liegt dabei auf der systematischen und strukturierten Herangehensweise an die Pflegeplanung und -durchführung, um die individuellen Bedürfnisse der Patienten optimal zu berücksichtigen.
3. Definition der Patientenorientierung: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Patientenorientierung dar. Es wird die Bedeutung der Einbindung der Patienten in den gesamten Pflegeprozess, von der Informationssammlung bis zur Durchführung der Maßnahmen, betont. Die Kapitel 4 und 5 bauen auf diesem Verständnis auf und liefern konkrete Anwendungsbeispiele.
4. Das Autonomierecht und die Privatsphäre des Patienten: Dieses Kapitel behandelt die rechtlichen und ethischen Aspekte der Patientenrechte, insbesondere das Autonomierecht und die Wahrung der Privatsphäre. Es bezieht sich auf die Arbeit von Bobbert und analysiert die Bedeutung dieser Rechte im Kontext des Pflegeprozesses. Hier werden die Grenzen des Handelns der Pflegenden im Hinblick auf die Selbstbestimmung des Patienten deutlich herausgearbeitet.
5. Informationssammlung und Patientenorientierung: Dieses Kapitel befasst sich mit der praktischen Umsetzung der Patientenorientierung im Rahmen der Informationssammlung. Es analysiert den geeigneten Zeitpunkt und Ort für die Informationsgewinnung, beschreibt die notwendigen Kommunikationsregeln und zeigt Möglichkeiten der Informationsbeschaffung auf. Schwierigkeiten in der Kommunikation werden ebenfalls angesprochen.
6. Durchführung von pflegerischen Maßnahmen und Patientenorientierung: Das Kapitel fokussiert auf die patientenorientierte Durchführung pflegerischer Maßnahmen. Es betont den Einfluss von Zeitpunkt und Ort der Durchführung, aber auch die zentrale Bedeutung des Rechts des Patienten auf Selbstbestimmung und die Möglichkeit, die Zustimmung zu Maßnahmen jederzeit zu widerrufen.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Patientenorientierte Arbeitsweisen in der Pflege
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Umsetzung patientenorientierter Arbeitsweisen in der Pflege, insbesondere bei der Informationssammlung und Durchführung von Pflegemaßnahmen. Sie analysiert den Pflegeprozess und seine Bedeutung für eine professionelle und patientenorientierte Pflege, beleuchtet praktische Vorgehensweisen und die Grenzen der Patientenorientierung.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Themenfindung, Grundlagen der professionellen Pflege (Trägerleitbild, Pflegeleitbild, Pflegetheorie), Der Pflegeprozess als Teil der professionellen Pflege (Definition, Vor- und Nachteile, Modelle, Pflegediagnose, Pflegevisite), Definition der Patientenorientierung, Das Autonomierecht und die Privatsphäre des Patienten (Autonomierecht nach Bobbert, Privatsphäre), Informationssammlung und Patientenorientierung (Zeitpunkt, Räumlichkeiten, Kommunikationsregeln, Informationsnahme/gabe, weitere Quellen, Kommunikationsschwierigkeiten), Durchführung von pflegerischen Maßnahmen und Patientenorientierung (Zeitpunkt, Ort, Durchführung, Recht auf Eigenwohl, Entziehen der Zustimmung) und Fazit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Hauptzielsetzung ist es, praktische Vorgehensweisen patientenorientierter Arbeitsweisen aufzuzeigen und gleichzeitig die Grenzen dieser Orientierung zu beleuchten. Die Arbeit analysiert den Pflegeprozess und seine Bedeutung für eine professionelle und patientenorientierte Pflege.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Pflegeprozess als integralen Bestandteil professioneller Pflege, die Umsetzung der Patientenorientierung in der Praxis, das Autonomierecht und die Privatsphäre des Patienten, effektive Kommunikation zwischen Pflegenden und Patienten sowie die Grenzen und Herausforderungen der Patientenorientierung.
Wie wird der Pflegeprozess in der Hausarbeit behandelt?
Der Pflegeprozess wird als integraler Bestandteil professioneller und patientenorientierter Pflege definiert und seine Vor- und Nachteile bewertet. Verschiedene Pflegeprozessmodelle werden im Hinblick auf die Patientenorientierung verglichen. Der Fokus liegt auf der systematischen und strukturierten Herangehensweise an die Pflegeplanung und -durchführung, um individuelle Patientenbedürfnisse zu berücksichtigen.
Welche Rolle spielt die Patientenorientierung in der Hausarbeit?
Die Patientenorientierung bildet den zentralen Fokus der Arbeit. Es wird die Bedeutung der Einbindung von Patienten in den gesamten Pflegeprozess, von der Informationssammlung bis zur Durchführung der Maßnahmen, betont. Die Arbeit analysiert, wie Patientenorientierung in der Praxis umgesetzt werden kann und welche Grenzen und Herausforderungen dabei bestehen.
Wie werden das Autonomierecht und die Privatsphäre des Patienten behandelt?
Die Hausarbeit behandelt die rechtlichen und ethischen Aspekte der Patientenrechte, insbesondere das Autonomierecht und die Wahrung der Privatsphäre. Sie bezieht sich auf die Arbeit von Bobbert und analysiert die Bedeutung dieser Rechte im Kontext des Pflegeprozesses. Die Grenzen des Handelns der Pflegenden im Hinblick auf die Selbstbestimmung des Patienten werden deutlich herausgearbeitet.
Wie wird die Kommunikation zwischen Pflegenden und Patienten betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Kommunikation zwischen Pflegenden und Patienten als essentiellen Bestandteil patientenorientierter Pflege. Sie beleuchtet den geeigneten Zeitpunkt und Ort für die Informationsgewinnung, beschreibt notwendige Kommunikationsregeln und zeigt Möglichkeiten der Informationsbeschaffung auf. Schwierigkeiten in der Kommunikation werden ebenfalls thematisiert.
Welche Zusammenfassung der Kapitel bietet die Hausarbeit?
Die Hausarbeit bietet für jedes Kapitel eine Zusammenfassung, die die zentralen Inhalte und Ergebnisse übersichtlich darstellt. Diese Zusammenfassungen geben einen schnellen Überblick über die behandelten Themen und deren Ergebnisse.
- Quote paper
- Mandy Lüders (Author), 2007, Patientenorientierung und Pflegeprozess, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82822