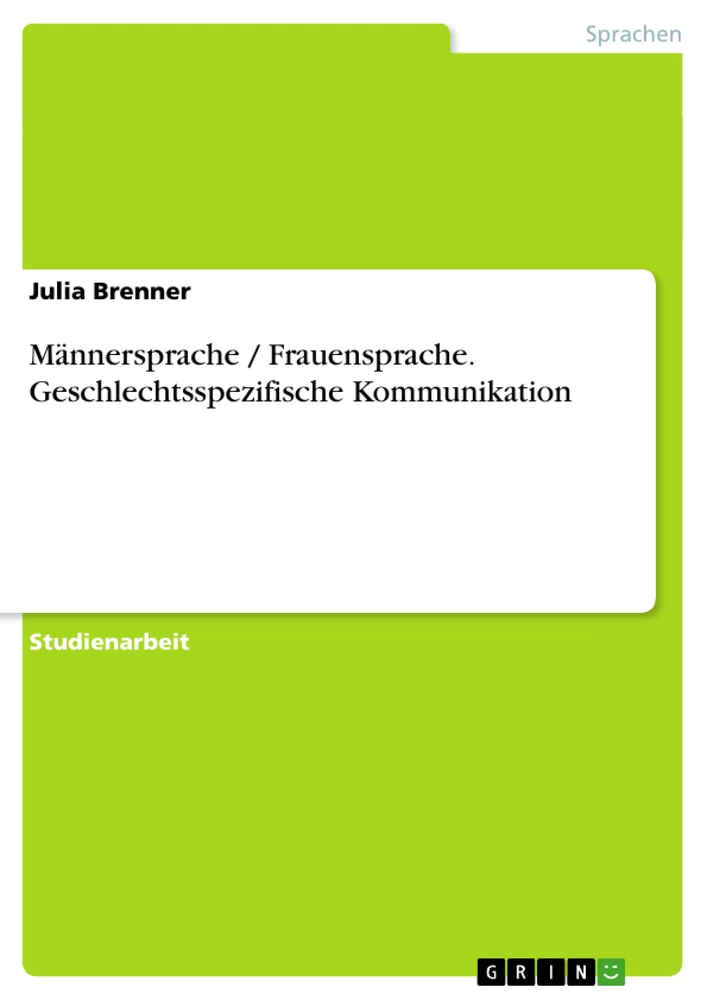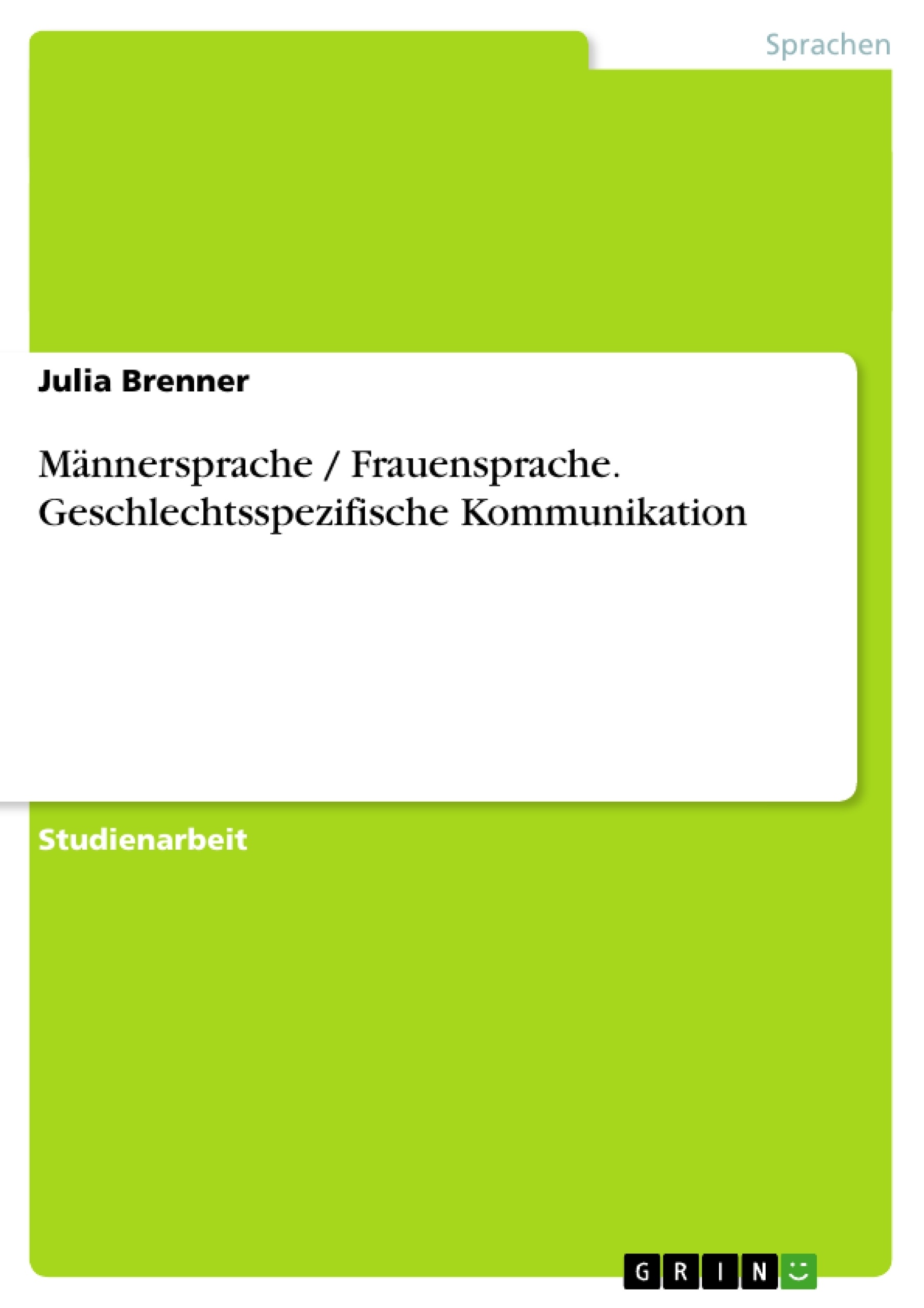Problemstellung: Andere Worte, andere Welten.
„Du verstehst mich einfach nicht!“ Dieser Satz steht oftmals am Ende von Diskussionen zwischen Männern und Frauen. Tatsächlich scheint es, dass Frauen und Männer unterschiedlichen Sprachen sprechen. Die Arbeit wird sich mit dem Thema der geschlechtsspezifischen Kommunikation auseinandersetzen und grundlegende Unterschiede aufführen.
Des weiteren sollen die geschlechtstypischen Kommunikationsstile unter besonderer Berücksichtigung systemlinguistischer Gesichtspunkte – in Anlehnung an das Seminar „Soziolinguistik“ – beschrieben und die Gründe für Missverständnisse zwischen Männern und Frauen beleuchtet werden.
Ziel der Arbeit ist es, so weit möglich, Lösungsansätze zu entwickeln, die zu einer besseren Verständigung der Geschlechter beitragen könnten.
Zuvor werden die Anfänge der feministischen Sprachwissenschaft und der aus ihr entstandenen Sprachkritik mit besonderem Augenmerk auf den Sexismus in der Sprache thematisiert. Als ein weiterer relevanter Themenschwerpunkt soll die Rolle der Frau im Sprachsystem und damit ihr geschlechtsspezifisches Sprachverhalten behandelt werden.
Verschiedene Autoren, Wissenschaftler und Linguisten haben sich bereits mit dem Bereich der geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Sprache, der sich als fester Bestandteil soziolinguistischer Forschung etabliert hat, befasst. Die Bücher „Frauensprache: Sprache der Veränderung“ von Senta Trömel-Plötz, „Das Deutsche als Männersprache“ von Luise F. Pusch, die „Einführung in die feministische Sprachwissenschaft“ von Ingrid Samel sowie der Forschungsbericht „Feministische Linguistik / Linguistische Geschlechterforschung“ von Gisela Schoenthal dienen daher als grundlegende Literatur für die folgende Ausarbeitung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problemstellung: Andere Worte, andere Welten
- 2. Der Inhalts- und Beziehungsaspekt von Sprache
- 3. Feminismus und Linguistik
- 3.1. Die Frauenbewegung in der BRD
- 3.2. Anfänge der feministischen Sprachwissenschaft
- 3.3. Sprachkritik
- 3.4. Sexismus in der Sprache
- 3.4.1. Die Diskriminierung von Frauen in der Bibel
- 3.4.2. Die Diskriminierung von Frauen in Sprichwörtern
- 3.5. Lösungsansätze
- 3.5.1. Beidbenennung
- 3.5.2. Neutralisation
- 3.5.3. Das generische Femininum
- 3.6. Sprachwandel
- 4. Geschlechtsspezifisches Sprachverhalten von Frauen
- 4.1. Hypothesen zur Frauensprache
- (a) Defizithypothese
- (b) Differenzhypothese
- (c) Code-switching-Hypothese
- (d) Sexstereotypentheorie
- (e) Das Konzept des „doing gender“
- 4.2. Die Doppelbindungssituation
- 4.1. Hypothesen zur Frauensprache
- 5. Kommunikationsverhalten von Frauen und Männern
- 5.1. Geschlechtsspezifische Merkmale im weiblichen Sprachverhalten
- 5.2. Der feminine Gesprächsstil
- 5.3. Geschlechtsspezifische Merkmale in der Männersprache
- 5.4. Der maskuline Gesprächsstil
- 5.5. Nonverbales Verhalten von Frauen und Männern
- 6. Erklärungsansatz / Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht geschlechtsspezifische Unterschiede in der Kommunikation zwischen Männern und Frauen. Ziel ist es, die Gründe für Missverständnisse zu beleuchten und mögliche Lösungsansätze für eine verbesserte Verständigung zu entwickeln. Der Fokus liegt auf systemlinguistischen Aspekten und der Berücksichtigung feministischer Perspektiven.
- Geschlechtsspezifische Kommunikationsstile
- Anfänge der feministischen Sprachwissenschaft und Sprachkritik
- Sexismus in der Sprache
- Die Rolle der Frau im Sprachsystem und ihr geschlechtsspezifisches Sprachverhalten
- Hypothesen zur Frauensprache (Defizit-, Differenz-, Code-Switching-Hypothese, Sexstereotypentheorie, "doing gender")
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problemstellung: Andere Worte, andere Welten: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Ursachen von Kommunikationsunterschieden zwischen den Geschlechtern. Sie begründet die Notwendigkeit der Untersuchung geschlechtsspezifischer Kommunikationsstile unter systemlinguistischen Gesichtspunkten und formuliert das Ziel, Lösungsansätze für eine bessere Verständigung zu entwickeln. Die Einleitung verweist auf die Bedeutung feministischer Sprachwissenschaft und deren Kritik an sexistischen Sprachstrukturen.
2. Der Inhalts- und Beziehungsaspekt von Sprache: Dieses Kapitel beleuchtet das grundlegende Konzept von Kommunikation, basierend auf dem Sender-Empfänger-Modell von Shannon und Weaver. Es beschreibt Kommunikation als den Austausch von Informationen und betont die unterschiedlichen Ebenen (Inhalts- und Beziehungsaspekt), auf denen Kommunikation stattfinden kann. Es werden die Ursachen für kommunikative Störungen zwischen den Geschlechtern angesprochen, wobei die ungleiche Ebene der Gesprächsführung als möglicher Faktor genannt wird.
3. Feminismus und Linguistik: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Geschichte der Frauenbewegung in der BRD und ihren Einfluss auf die Entwicklung der feministischen Sprachwissenschaft. Es analysiert die Kritik an sexistischem Sprachgebrauch, der Frauen diskriminiert, und untersucht die Lösungsansätze wie Beidbenennung, Neutralisation und das generische Femininum. Der Sprachwandel im Kontext der geschlechtsspezifischen Sprache wird ebenfalls diskutiert.
4. Geschlechtsspezifisches Sprachverhalten von Frauen: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Hypothesen zur Frauensprache, darunter die Defizit-, Differenz-, Code-Switching-Hypothese, die Sexstereotypentheorie und das Konzept des „doing gender“. Es wird analysiert, wie diese Theorien das Sprachverhalten von Frauen erklären und welche Faktoren zu den beobachteten Unterschieden beitragen. Die Doppelbindungssituation von Frauen wird ebenfalls thematisiert.
5. Kommunikationsverhalten von Frauen und Männern: Dieses Kapitel vergleicht das Kommunikationsverhalten von Frauen und Männern. Es werden geschlechtsspezifische Merkmale im weiblichen und männlichen Sprachverhalten, die jeweiligen Gesprächsstile und nonverbales Verhalten untersucht. Die Kapitel analysieren die Unterschiede und Gemeinsamkeiten im kommunikativen Handeln der Geschlechter.
Schlüsselwörter
Geschlechtsspezifische Kommunikation, Frauensprache, Männersprache, Feministische Linguistik, Sprachkritik, Sexismus, Kommunikationsstile, Missverständnisse, Lösungsansätze, Defizithypothese, Differenzhypothese, Code-Switching, Doppelbindung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Geschlechtsspezifische Kommunikation
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht geschlechtsspezifische Unterschiede in der Kommunikation zwischen Männern und Frauen. Sie beleuchtet die Gründe für Missverständnisse und entwickelt mögliche Lösungsansätze für eine verbesserte Verständigung. Der Fokus liegt auf systemlinguistischen Aspekten und der Berücksichtigung feministischer Perspektiven.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: geschlechtsspezifische Kommunikationsstile, Anfänge der feministischen Sprachwissenschaft und Sprachkritik, Sexismus in der Sprache, die Rolle der Frau im Sprachsystem und ihr geschlechtsspezifisches Sprachverhalten, sowie verschiedene Hypothesen zur Frauensprache (Defizit-, Differenz-, Code-Switching-Hypothese, Sexstereotypentheorie, "doing gender").
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel 1 stellt die Problemstellung vor und begründet die Forschungsfrage. Kapitel 2 erklärt den Inhalts- und Beziehungsaspekt von Sprache. Kapitel 3 behandelt Feminismus und Linguistik, inklusive Sprachkritik und Lösungsansätze für sexistische Sprache. Kapitel 4 befasst sich mit geschlechtsspezifischem Sprachverhalten von Frauen und verschiedenen Hypothesen dazu. Kapitel 5 vergleicht das Kommunikationsverhalten von Frauen und Männern. Kapitel 6 bietet einen Erklärungsansatz und eine Schlussbetrachtung.
Welche Hypothesen zur Frauensprache werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Defizit-, Differenz-, Code-Switching-Hypothese, die Sexstereotypentheorie und das Konzept des „doing gender“ als Erklärungsansätze für geschlechtsspezifisches Sprachverhalten von Frauen.
Welche Lösungsansätze für sexistische Sprache werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert Lösungsansätze wie Beidbenennung, Neutralisation und das generische Femininum zur Bekämpfung von Sexismus in der Sprache.
Welche Rolle spielt der Feminismus in dieser Arbeit?
Der Feminismus spielt eine zentrale Rolle, indem er die Kritik an sexistischen Sprachstrukturen liefert und feministische Perspektiven in die Analyse der geschlechtsspezifischen Kommunikation einbezieht. Die Arbeit betrachtet die Anfänge der feministischen Sprachwissenschaft und deren Einfluss auf die aktuelle Sprachdiskussion.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Geschlechtsspezifische Kommunikation, Frauensprache, Männersprache, Feministische Linguistik, Sprachkritik, Sexismus, Kommunikationsstile, Missverständnisse, Lösungsansätze, Defizithypothese, Differenzhypothese, Code-Switching, Doppelbindung.
Wo finde ich weitere Informationen zum Inhalts- und Beziehungsaspekt von Sprache?
Kapitel 2 der Arbeit beleuchtet dieses grundlegende Konzept der Kommunikation, basierend auf dem Sender-Empfänger-Modell von Shannon und Weaver.
Wie wird die Doppelbindungssituation von Frauen behandelt?
Kapitel 4 thematisiert die Doppelbindungssituation von Frauen im Kontext der verschiedenen Hypothesen zur Frauensprache.
Welche Aspekte des nonverbalen Verhaltens werden untersucht?
Kapitel 5 untersucht das nonverbales Verhalten von Frauen und Männern im Vergleich.
- Quote paper
- M.A. (Magistra Artium) Julia Brenner (Author), 2003, Männersprache / Frauensprache. Geschlechtsspezifische Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82768