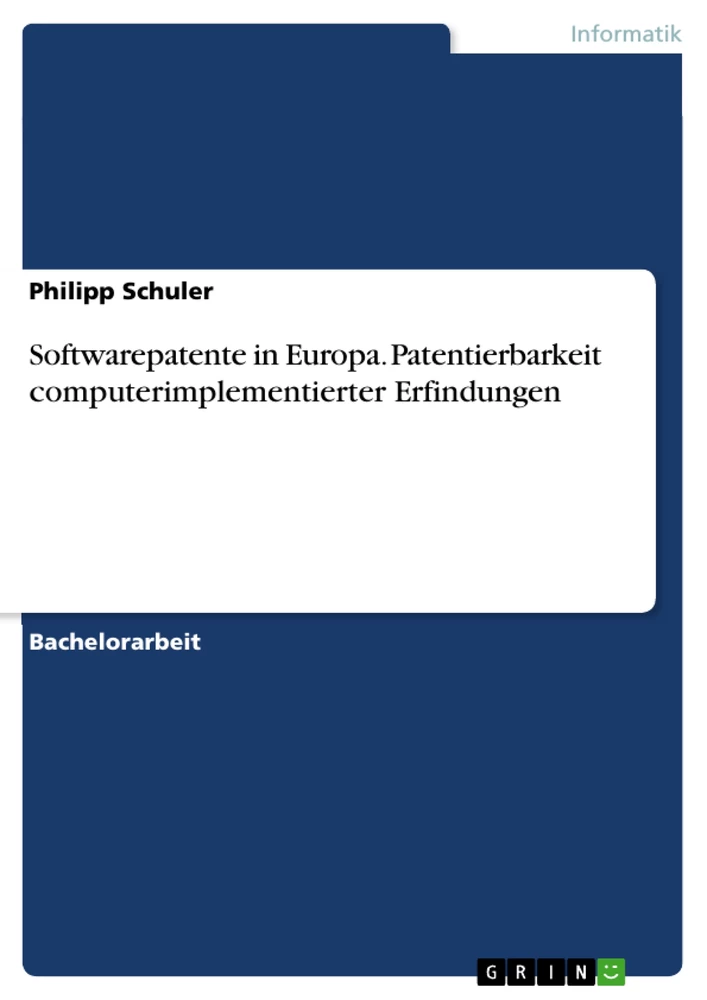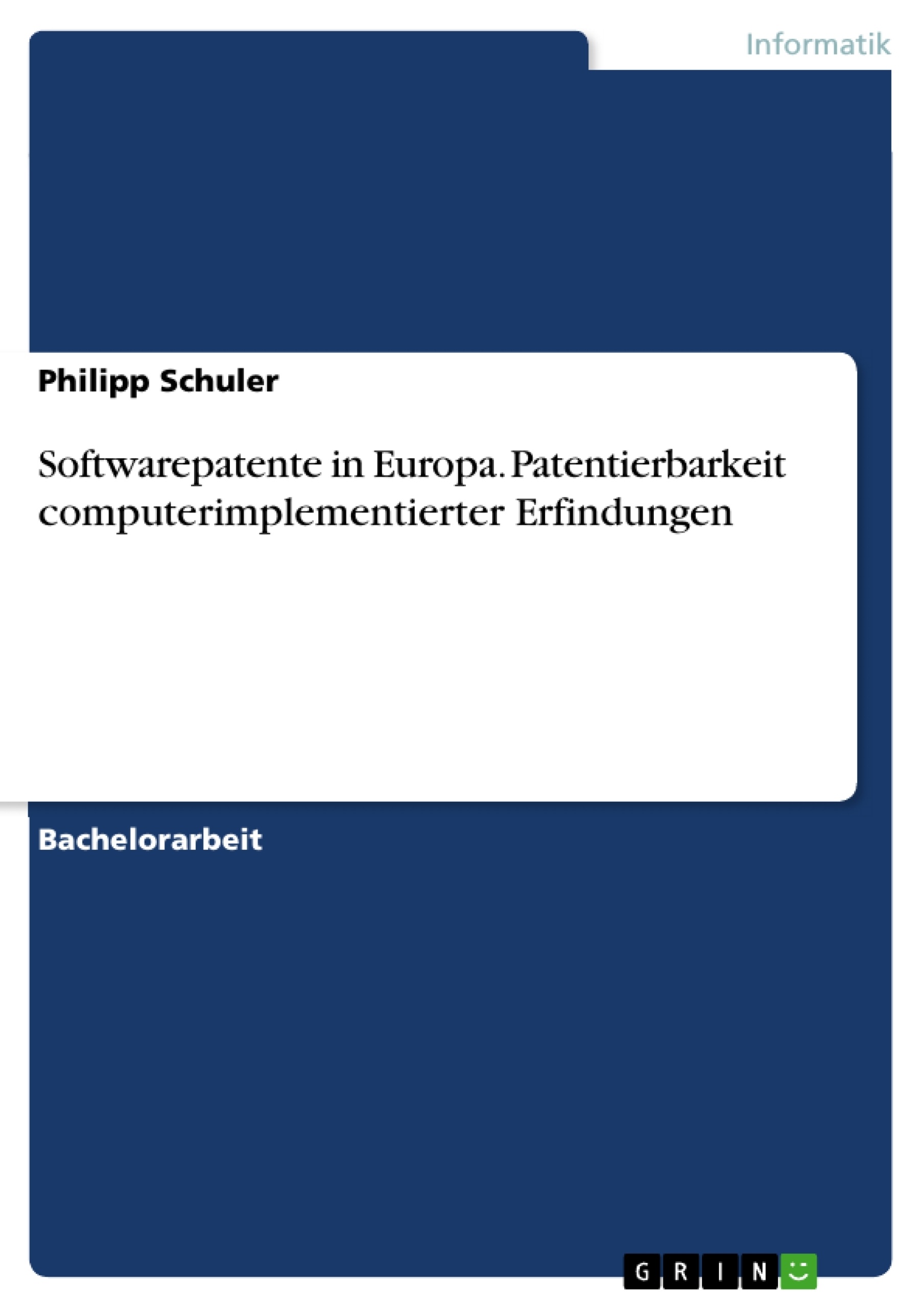Diese Arbeit wurde vor dem Hintergrund der Ablehnung der EU-Richtlinie zu „computerimplementierten Erfindungen“ erstellt. Im ersten Teil wird auf die Ursprünge des geistigen Schutzes von Erfindungen und auf die seit Jahren diskutierte Patentierung von Software eingegangen. Teil zwei stellt den (nicht) Werdegang der Europäischen Richtlinie „über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen“ dar. Neben der von Kritikern grundsätzlich angeprangerten Trivialität von Software Patenten soll auch auf mögliche Gefahren für den europäischen Mittelstand und die Innovation in Europa durch solche Patente eingegangen werden. Im dritten Abschnitt wird das System der Patentevergabe der „Vorreiter“ USA beleuchtet. Abschließend wird der Open Source Gedanke in Kontrast zum Schutz von geistigem Eigentum gestellt, um dann in einem Resümee einen Überblick über die Arbeit zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- Das Patent als Erfindungsschutz
- "Software Patente" in Europa
- Einleitung
- Wettbewerb im Gerichtssaal
- Bisherige Patentpraxis in Europa
- Die EU im Zugzwang
- WTO / TRIPS Abkommen
- Begriffsabgrenzung
- EU Richtlinie für "Computerimplementierte Erfindungen"
- Unterstützer und Kritiker
- Stimmen zur Entscheidung..
- Sind Software Patente trivial?
- Beispiele aus dem Europäischen Patentamt..
- Wieso ist Trivialität schwer zu erkennen?..
- Sind Software Patente Wachstums hemmend?
- Im Zeichen des Lobbyismus
- Vorläufer USA?
- Mythos Freie Software
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Ablehnung der EU-Richtlinie zu „computerimplementierten Erfindungen“. Sie untersucht die Ursprünge des geistigen Schutzes von Erfindungen und die seit Jahren diskutierte Patentierung von Software. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse des (nicht) Werdegangs der Europäischen Richtlinie „über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen“ und den damit verbundenen möglichen Gefahren für den europäischen Mittelstand und die Innovation in Europa. Des Weiteren wird das System der Patentvergabe in den USA beleuchtet und der Open Source Gedanke im Kontrast zum Schutz von geistigem Eigentum betrachtet.
- Die Ursprünge des geistigen Schutzes von Erfindungen
- Die Patentierung von Software
- Die Europäische Richtlinie „über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen“
- Die Patentvergabe in den USA
- Der Open Source Gedanke
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des Patents als Instrument zum Schutz von Erfindungen. Kapitel 2 befasst sich mit dem komplexen Thema der Software-Patente in Europa und analysiert die bisherige Patentpraxis, den Einfluss der WTO und der EU, sowie die Kontroverse um die Trivialität von Software-Patenten. Kapitel 3 wirft einen Blick auf das US-amerikanische Patentierungssystem, untersucht die potenziellen Auswirkungen auf kleine und mittlere IT-Unternehmen und die Unterschiede zum europäischen Markt.
Schlüsselwörter
Softwarepatente, geistiges Eigentum, europäische Richtlinie, computerimplementierte Erfindungen, Trivialität, Innovation, Mittelstand, Open Source, US-Patentierungssystem, freie Software.
- Quote paper
- Philipp Schuler (Author), 2006, Softwarepatente in Europa. Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82542