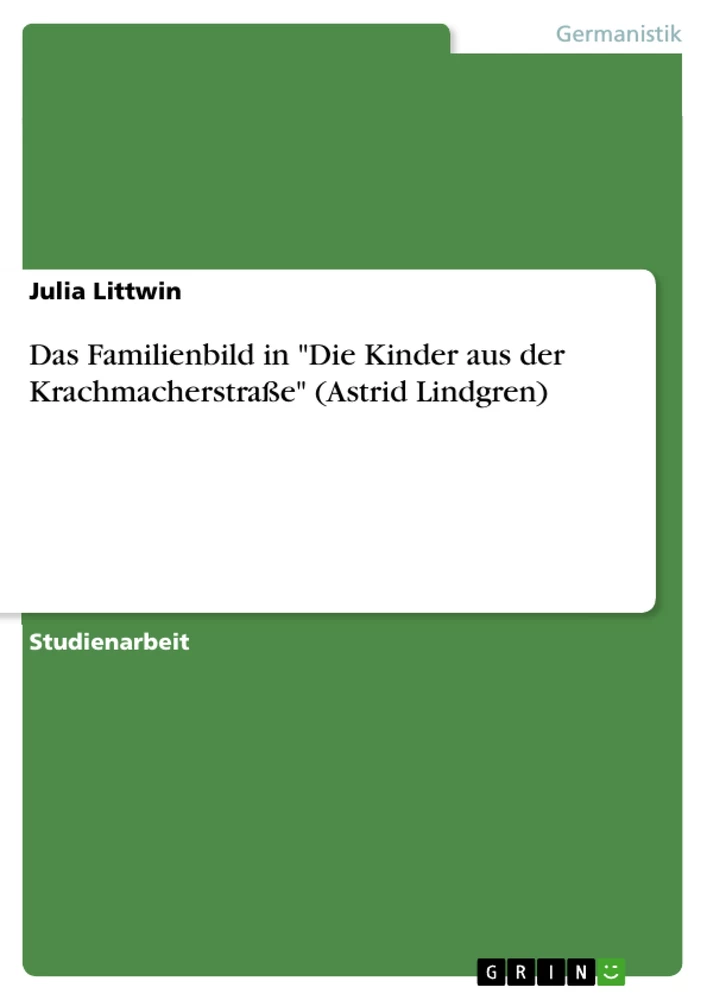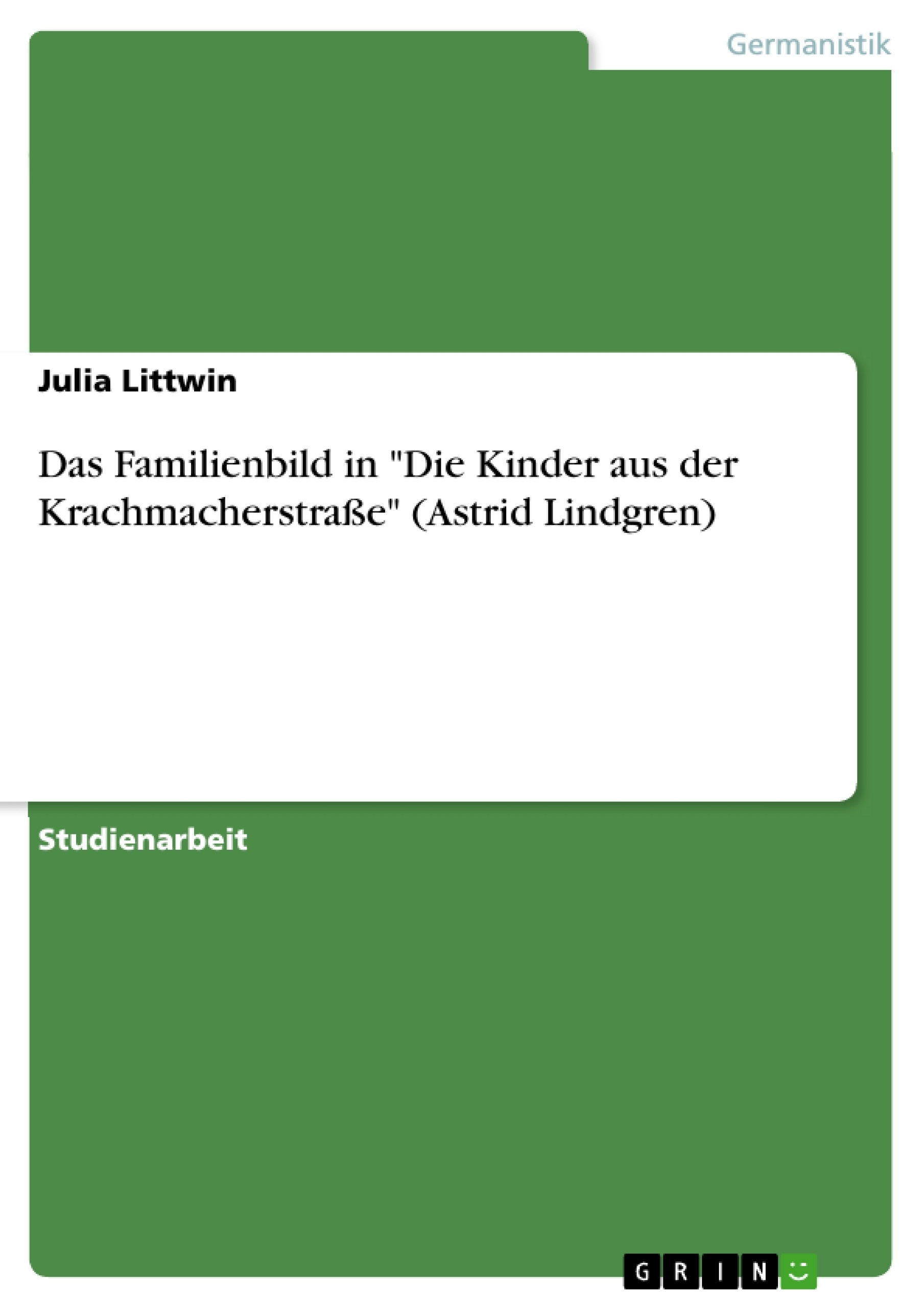Inhalt
1. Literaturgeschichtliche Einordnung
2. Familienform
3. Funktion der Familie
4. Beziehungen
4.1 Die Beziehung zwischen Vater und Mutter
4.2 Die Beziehung zwischen den Kindern und dem Vater
4.3 Die Beziehung zwischen den Kindern und der Mutter
4.4 Die Beziehungen zwischen den Kindern
5. Rollenverteilung
6. Erziehung
1. Literaturgeschichtliche Einordnung
Das Kinderbuch „Die Kinder aus der Krachmacherstraße“ erschien im Jahr 1957.
In Deutschland verblassten nach 1945 bis ca. 1948 allmählich die nationalsozialistischen Einflüsse in der Kinderliteratur und es bestand zunächst einmal die Hoffnung, die junge Generation könne eine friedvollere und humanitäre Welt verwirklichen.
Allerdings entwickelte sich erst in der zweiten Hälfte der 50ger Jahre in Deutschland eine neue Richtung in der Kinderliteratur. Kinder sollten sich völlig ungestört und unbeeinträchtigt von den Problemen und Schwierigkeiten der Erwachsenenwelt entwickeln können.
„Durch Aktivierung und Förderung ihrer eigenen, unverdorbenen, schöpferischen Kräfte sollten sie aus sich selbst heraus genügend Stärke und Selbstvertrauen gewinnen können, um in der Wirklichkeit bestehen zu können.“
(www.fbi.fh-koeln.de/institut/personen/schikorsky/Material/ss03/KJL-Schnellkurs.doc; abgerufen am 26.06.2007)
Auch wenn die Kinderliteratur in Schweden in ihrer Entwicklung relativ unbeeinflusst von deutschen Geschehnissen blieb und Astrid Lindgrens Werke schon vom ersten Buch an („Pippi Langstrumpf“, 1944) als wenig normangepasst bezeichnet werden können, lassen sich dennoch Übereinstimmungen finden.
Auch „Die Kinder der Krachmacherstraße“, Jonas (6), Mia-Maria (5) und Lotta (3) befinden sich in einer Art Schonraum. Sie „spielen ganze Tage lang“, dürfen Krach machen und wachsen alles in allem in einer heilen Welt auf.
Interessant ist zu erwähnen, dass das Buch bereits typische Kennzeichen der Kinder- und Jugendliteratur der 60ger Jahre aufweist:
• die Geschichte wird aus der Perspektive eines Kindes erzählt
• sie enthält bereits Ansätze anti-autoritärer Erziehungsvorstellungen
• die Geschichte thematisiert Alltagsgeschehen
• sie bietet den kindlichen Lesern und Zuhörern (verschiedene) Identifikationsfiguren
Inhaltsverzeichnis
- Familienform
- Funktion der Familie
- Beziehungen
- Die Beziehung zwischen Vater und Mutter
- Die Beziehung zwischen den Kindern und dem Vater
- Die Beziehung zwischen den Kindern und der Mutter
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert das Familienbild im Kinderbuch „Die Kinder aus der Krachmacherstraße“ von Astrid Lindgren. Sie untersucht die Familienstruktur, die Funktion der Familie und die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern im Kontext der 1950er Jahre. Die Arbeit beleuchtet, wie das Buch typische Kennzeichen der Kinder- und Jugendliteratur der 60er Jahre aufweist und wie es gesellschaftliche Normen und Erziehungsvorstellungen widerspiegelt.
- Das Familienbild in den 1950er Jahren
- Die Rolle der Familie in der Kindererziehung
- Die Darstellung von Vater- und Mutterrollen
- Die Beziehung zwischen Kindern und Eltern
- Die Herausforderungen und Chancen der Familie im Wandel
Zusammenfassung der Kapitel
Familienform
Die Familie in „Die Kinder aus der Krachmacherstraße“ entspricht der idealtypischen Form der „modernen Kleinfamilie“ der 1950er Jahre. Merkmale dieser Familienform sind die Ehe der Eltern, leibliche Kinder, eine traditionelle Rollenverteilung zwischen Mann und Frau, räumliche Trennung von Wohn- und Arbeitsstätte und die Anzahl der Kinder (zwei bis drei).
Funktion der Familie
Die Familie in Lindgrens Buch dient in erster Linie dazu, den Kindern einen sicheren und angenehmen Raum für ihre Entwicklung zu bieten. Der Zusammenhalt zwischen den Familienmitgliedern hat einen hohen Stellenwert, und die Eltern vermitteln ihren Kindern ihre Werte und Normen. Wirtschaftliche Aspekte spielen zwar eine Rolle, sind aber nicht das Hauptmotiv für die Familiengründung.
Beziehungen
Die Beziehung zwischen Vater und Mutter
Die Beziehung zwischen Vater und Mutter wird aus der Perspektive der fünfjährigen Tochter dargestellt, daher ist der Einblick in ihre Gefühle und ihr Liebesleben begrenzt. Dennoch scheint es sich um eine harmonische Beziehung zu handeln, die von gegenseitigem Respekt und Verständnis geprägt ist.
Die Beziehung zwischen den Kindern und dem Vater
Der Vater wird als liebevoll, humorvoll und verantwortungsbewusst dargestellt. Er hat eine Engelsgeduld und zeigt seinen Kindern stets seine Zuneigung und Wertschätzung. Die Kinder lieben ihn inständig.
Die Beziehung zwischen den Kindern und der Mutter
Die Mutter nimmt ihre Erziehungsaufgabe ernst und setzt Strafen konsequent ein. Dennoch behandelt sie ihre Kinder liebevoll und verständnisvoll. Sie versucht, ihnen die Welt begreiflich zu machen und ihnen ihre Sorgen und Ängste abzunehmen. Die Kinder respektieren ihre Autorität und sehen in ihr eine wichtige Bezugsperson.
Schlüsselwörter
Familienbild, moderne Kleinfamilie, Kinder- und Jugendliteratur, 1950er Jahre, Erziehungsvorstellungen, Vater- und Mutterrolle, Beziehungen, Zusammenhalt, Wertevermittlung.
- Quote paper
- Julia Littwin (Author), 2007, Das Familienbild in "Die Kinder aus der Krachmacherstraße" (Astrid Lindgren), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82522