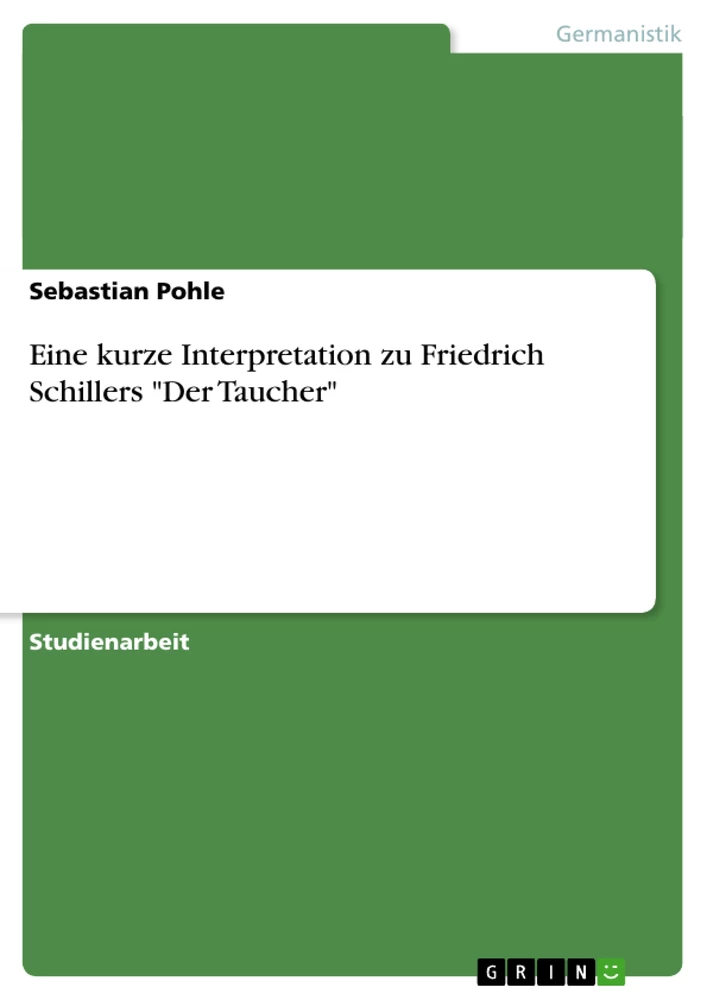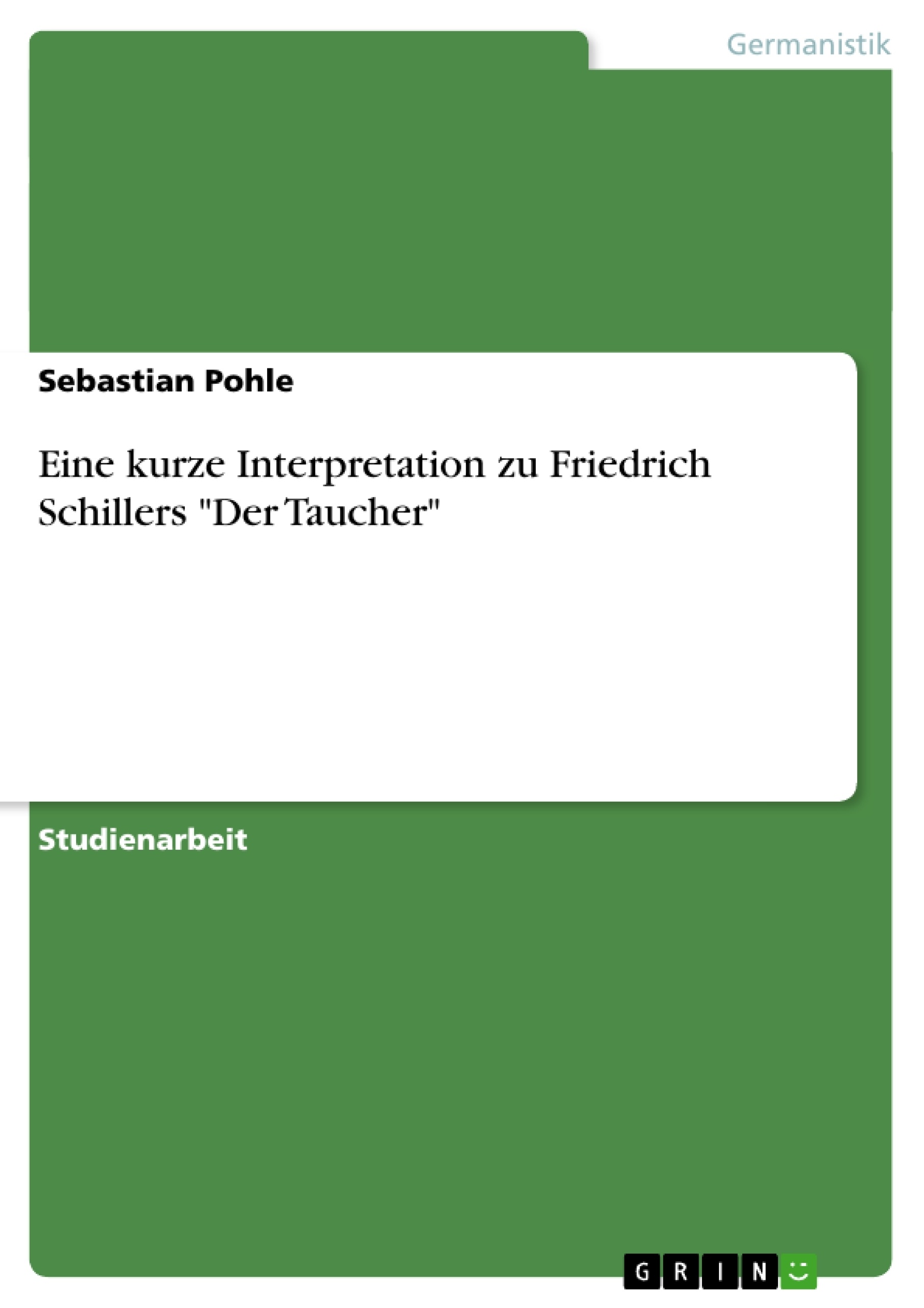Friedrich Schillers Werk Der Taucher entstand in einem relativ kurzen Zeitraum zwischen dem 5. und 15. Juni 1797 und erschien im Jahr darauf erstmalig im Musenalmanach, welches von Schiller selbst herausgegeben wurde. Dieses Sammelwerk enthielt verschiedene Werke Schillers und Goethes, unter diesen auch Der Handschuh, welcher in engem Zusammenhang mit dem Taucher steht.
Goethe bezeichnete die Ballade als „wirklich ein artiges Nach- und Gegenstück [zum Taucher]“ .
Zum Motiv der Ballade gibt es eine Vielzahl von Überlieferungen zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert, wodurch die Frage nach der Quelle verschiedene Schlüsse zulässt. Die Handlung kommt aber sehr nahe an die Historia de Pescecola Urimatore Siculo (Geschichte vom sizilianischen Taucher Pescecola) in Athanasii Kircheri mundus subterraneus (Athanasius Kirchers unterirdische Welt) aus dem Jahr 1651. Diese Geschichte handelt von einem sizilianischen Berufstaucher aus der Zeit des Königs Friedrich und scheint in diesem Fall motivgeschichtlich zentral zu sein.
Diverse wissenschaftliche Ausgaben befassen sich mit den Werken Schillers. Als Basis dieser Hausarbeit soll die Frankfurter Ausgabe dienen.
Zu Beginn der Arbeit steht der Nachweis einer Einordnung als Ballade anhand des Textes und seiner literaturgattungsspezifischen Merkmale. Weiterhin soll der enge Bezug zum eben genannten Handschuh näher beleuchtet werden. Im Anschluss folgt eine eingehende formale und inhaltliche Interpretation des Textes. Dabei soll auf drei wesentliche Aufsätze zum Thema Bezug genommen werden.
Im Mittelpunkt der Betrachtung soll die Entwicklung der Persönlichkeit des Knappen im Verlauf der Geschichte stehen. Des Weiteren wird untersucht, ob er selbst oder der König die Schuld an seinem Schicksal trägt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Taucher und das Verhältnis zu seinem „Nachstück“ Der Handschuh
- Der Taucher als Ballade
- Interpretation
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Friedrich Schillers Ballade „Der Taucher“, ihren Zusammenhang mit Goethes „Der Handschuh“, und analysiert die literarischen Merkmale und die Interpretation des Textes. Der Fokus liegt auf der Einordnung als Ballade, der Beziehung zu „Der Handschuh“, sowie der Analyse der Charakterentwicklung des Knappen und der Frage nach der Schuld an seinem Schicksal.
- Einordnung von „Der Taucher“ als Ballade
- Vergleich und Kontrast zwischen „Der Taucher“ und „Der Handschuh“
- Interpretation der Handlung und der Charaktere
- Analyse der Schuldfrage (Knabe vs. König)
- Literarische und gattungsspezifische Merkmale der Ballade
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Entstehung und den Kontext von Schillers „Der Taucher“, seine Veröffentlichung im Musenalmanach und den engen Zusammenhang mit Goethes „Der Handschuh“. Sie skizziert die Forschungslage und benennt die Ziele der Arbeit: die Einordnung als Ballade, den Vergleich mit „Der Handschuh“ und eine detaillierte Interpretation. Die Arbeit basiert auf der Frankfurter Ausgabe von Schillers Werken und bezieht sich auf ausgewählte wissenschaftliche Aufsätze.
Der Taucher und das Verhältnis zu seinem „Nachstück“ Der Handschuh: Dieses Kapitel analysiert die Beziehung zwischen Schillers „Der Taucher“ und Goethes „Der Handschuh“, welche Goethe selbst als „Nach- und Gegenstück“ bezeichnete. Es vergleicht die beiden Balladen hinsichtlich ihrer Handlung und Thematik. Die Frage nach Kritik oder Korrektur des „Taucher“ durch den „Handschuh“ wird diskutiert. Der Fokus liegt auf dem Thema der Unterwerfung und dem aufkeimenden Selbstbewusstsein der Beherrschten, insbesondere im Kontext der Französischen Revolution.
Der Taucher als Ballade: Dieses Kapitel argumentiert für die Einordnung des „Taucher“ als Ballade. Es führt drei Punkte an: die Veröffentlichung im „Balladen-Almanach“, das Entstehungsjahr (1797, das „Balladenjahr“) und den expliziten Hinweis auf die Gattung durch den Autor. Die Analyse zeigt, wie Elemente aus Lyrik, Epik und Dramatik in der Ballade verwoben sind, was sie nach Goethes Ansicht zu einem „Ur-Ei“ der Dichtung macht. Die Kapitel analysiert die metrischen und formalen Eigenschaften des Gedichtes, die Verwendung der direkten Rede und die dramatische Struktur.
Interpretation: Die Interpretation von „Der Taucher“ beginnt mit der Lokalisierung des Handlungsortes mittels des Begriffs „Charybde“, wodurch die geographische Lage in der Straße von Messina geklärt wird. Der Zeitpunkt der Handlung kann jedoch nicht genau bestimmt werden. Der Abschnitt fokussiert auf die Entwicklung der Persönlichkeit des Knappen, und untersucht den Spannungsbogen und den Konflikt zwischen König und Knappen. Die Analyse bezieht sich auf Interpretationen von Segebrecht und Kaiser.
Schlüsselwörter
Friedrich Schiller, Der Taucher, Der Handschuh, Ballade, Lyrik, Epik, Dramatik, Interpretation, Charakteranalyse, Schuldfrage, König, Knabe, Unterwerfung, Selbstbewusstsein, Französische Revolution.
Häufig gestellte Fragen zu Schillers "Der Taucher"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Friedrich Schillers Ballade "Der Taucher", ihren Bezug zu Goethes "Der Handschuh", und interpretiert die literarischen Merkmale des Textes. Schwerpunkte sind die Einordnung als Ballade, der Vergleich mit "Der Handschuh", die Charakteranalyse des Knappen und die Frage nach der Schuld an seinem Schicksal.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Vergleich von "Der Taucher" und "Der Handschuh", ein Kapitel zur Einordnung als Ballade, ein Interpretationskapitel und eine Schlussbetrachtung. Die Einleitung beschreibt den Kontext und die Ziele der Arbeit. Die Kapitel untersuchen die Beziehung der beiden Balladen, die literarischen Merkmale des "Tauchers" als Ballade und bieten eine detaillierte Interpretation des Textes.
Wie wird "Der Taucher" als Ballade eingeordnet?
Die Einordnung als Ballade wird durch die Veröffentlichung im "Balladen-Almanach", das Entstehungsjahr (1797, das "Balladenjahr") und den impliziten Hinweis auf die Gattung durch Schiller begründet. Die Analyse zeigt die Verknüpfung von lyrischen, epischen und dramatischen Elementen.
Welchen Vergleich zieht die Arbeit zwischen "Der Taucher" und "Der Handschuh"?
Die Arbeit analysiert die Beziehung zwischen den beiden Balladen, die Goethe selbst als "Nach- und Gegenstück" bezeichnete. Sie vergleicht Handlung und Thematik und diskutiert die Frage nach einer möglichen Kritik oder Korrektur des "Tauchers" durch den "Handschuh", insbesondere im Kontext der Französischen Revolution und dem Thema der Unterwerfung und des aufkeimenden Selbstbewusstseins der Beherrschten.
Wie wird die Interpretation von "Der Taucher" vorgenommen?
Die Interpretation beginnt mit der Lokalisierung des Handlungsortes (Straße von Messina) und fokussiert auf die Entwicklung der Persönlichkeit des Knappen, den Spannungsbogen und den Konflikt zwischen König und Knappen. Sie bezieht sich auf Interpretationen von Segebrecht und Kaiser.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Friedrich Schiller, Der Taucher, Der Handschuh, Ballade, Lyrik, Epik, Dramatik, Interpretation, Charakteranalyse, Schuldfrage, König, Knabe, Unterwerfung, Selbstbewusstsein, Französische Revolution.
Auf welchen Quellen basiert die Arbeit?
Die Arbeit basiert auf der Frankfurter Ausgabe von Schillers Werken und bezieht sich auf ausgewählte wissenschaftliche Aufsätze.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Schillers "Der Taucher" als Ballade einzuordnen, sie mit Goethes "Der Handschuh" zu vergleichen und eine detaillierte Interpretation des Textes zu liefern, inklusive der Analyse der Charakterentwicklung und der Schuldfrage.
- Quote paper
- Sebastian Pohle (Author), 2007, Eine kurze Interpretation zu Friedrich Schillers "Der Taucher", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82500