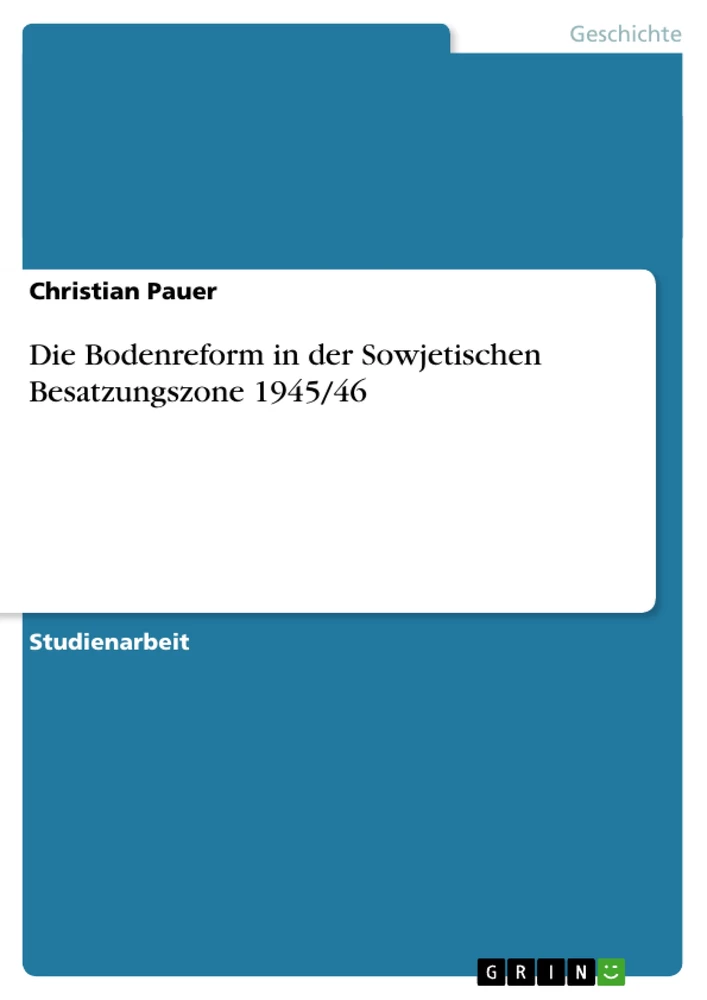Die Arbeit befasst sich mit der Bodenreform, die im September 1945 in der Sowjetischen Besatzungszone von deutschen Kommunisten unter Protektion und Förderung der sowjetischen Besatzungsmacht eingeleitet wurde. Es soll geklärt werden, wie sich die Ausgangslage darstellte, wie sich die Reform vollzog, und inwieweit sie eine diktatorische Maßnahme darstellt.
Die Reform stellt einen Transformationsprozess dar, der radikale Eingriffe in die Eigentumsverhältnisse und die soziale Autonomie in der ländlichen Gesellschaft bedeutete.
Nach der eben erst beendeten Diktatur des Nationalsozialismus wurde, gerade in Abgrenzung zu dieser, von den meisten Menschen eine demokratische Selbstreform des Landes erwartet. Nach dem Willen der Kommunisten sollte der grundlegende Wandel von Staat und Gesellschaft, also auch der in der Agrar- und Wirtschaftspolitik, in einem, als fortschrittlich proklamiertem Bündnis mit der Sowjetunion erreicht werden.
Ein Hintergrund der Reform war, die Macht der Kräfte, die aus Sicht der Sowjets und der deutschen Kommunisten, wichtige Träger des Faschismus darstellten, zu brechen, indem man ihnen die Lebensgrundlage, also ihr Land entzog und es den unteren Schichten der Gesellschaft zur Verfügung stellte. In diesem Sinne ist auch die Kampfparole der Bodenreform: „Junkerland in Bauernhand“ zu verstehen. Ein weiterer Beweggrund war die auf dem Lande traditionell schwache Verankerung der Kommunisten. Mit der Vergabe von kostenlosem Boden schuf man materielle und soziale Verlockungen, die die Landbevölkerung zu loyalen Mitstreitern der neuen Ordnung machen sollten.
Die führenden Protagonisten leiteten einen Großteil ihrer Maßnahmen, darunter auch die Bodenreform, aus der Propagandaformel vom radikalen Bruch mit der NS-Vergangenheit ab. Eine „antifaschistisch-demokratische Revolution“ wurde propagiert, doch diese Aussage entlarvte sich sehr bald, durch einen „Rückgriff auf nationalsozialistische Instrumente und Methoden der Wirtschaftslenkung“ , als Trugbild. Auch die Art und Weise der Durchführung der Bodenreform auf unterer Ebene ließen demokratische Maßstäbe oft genug vermissen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Nachkriegssituation
- Einordnung in den historischen Kontext
- Situation der Landbevölkerung
- Die Bodenreform
- Ideologische Vorgaben
- Vorbereitung und Durchführung
- Ergebnis und Ausblick
- Ergebnis
- Ausblick
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bodenreform in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) von 1945/46. Ziel ist es, die Ausgangslage, den Ablauf der Reform und ihren Charakter als mögliche diktatorische Maßnahme zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die Reform als Transformationsprozess mit weitreichenden Folgen für Eigentumsverhältnisse und soziale Strukturen im ländlichen Raum.
- Die Nachkriegssituation in der SBZ und ihre Einordnung in den internationalen Kontext.
- Die ideologischen Grundlagen und politischen Ziele der Bodenreform.
- Der Ablauf der Bodenreform: Vorbereitung, Durchführung und Umsetzung.
- Die Ergebnisse der Bodenreform und ihre Auswirkungen auf die ländliche Gesellschaft.
- Der Vergleich der Bodenreform in der SBZ mit den Entwicklungen in den westlichen Besatzungszonen.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Bodenreform in der SBZ ein und skizziert die zentralen Forschungsfragen der Arbeit. Sie beschreibt die Bodenreform als einen radikalen Eingriff in die Eigentumsverhältnisse und die soziale Struktur des ländlichen Raums, der im Kontext der Nachkriegsordnung und der Auseinandersetzung zwischen den Besatzungsmächten zu verstehen ist. Die einleitenden Worte betonen den Wunsch nach einer demokratischen Selbstreform im Gegensatz zur kürzlich beendeten NS-Diktatur und die Rolle der Kommunisten im Bündnis mit der Sowjetunion bei der Gestaltung des grundlegenden Wandels von Staat und Gesellschaft. Die Kampfparole „Junkerland in Bauernhand“ wird als Ausdruck des Ziels, die Macht des ehemaligen Landadels zu brechen und die Landbevölkerung für die neue Ordnung zu gewinnen, interpretiert. Kritisch wird bereits hier auf den Widerspruch zwischen der propagierten „antifaschistisch-demokratischen Revolution“ und dem Rückgriff auf nationalsozialistische Methoden hingewiesen.
Forschungsstand: Dieses Kapitel analysiert die vorhandene Literatur zur Bodenreform, wobei ein Unterschied zwischen der DDR- und der BRD-Perspektive deutlich wird. In der DDR wurde die Bodenreform als erfolgreicher Bestandteil der Staatsgründung und der Etablierung einer antifaschistischen Gesellschaft dargestellt. Im Gegensatz dazu wurde sie in der BRD oft als Schritt zur Sozialisierung und Sowjetisierung der SBZ interpretiert, wobei die damit verbundenen Unrechtstaten im Vordergrund standen. Der Zugang zu den DDR-Archiven nach der Wende ermöglichte eine differenziertere und weniger ideologisch geprägte Forschung.
Nachkriegssituation: Dieses Kapitel beschreibt die unmittelbare Nachkriegssituation in Deutschland nach der Kapitulation 1945 und der Aufteilung in Besatzungszonen. Es beleuchtet die Rolle des Alliierten Kontrollrats und die sich entwickelnden Spannungen zwischen den Westmächten und der Sowjetunion, die zum Kalten Krieg führten. Der Fokus liegt auf der sowjetischen Strategie, ihren Einflussbereich in ganz Deutschland auszuweiten und gleichzeitig in der SBZ die Grundlagen für ein kommunistisches System zu schaffen. Die Kapitel unterstreichen die Bedeutung des historischen Kontexts für das Verständnis der Bodenreform.
Schlüsselwörter
Bodenreform, Sowjetische Besatzungszone, DDR, Kommunismus, Landfrage, Junker, Bauern, antifaschistisch-demokratische Revolution, Transformationsprozess, Kalter Krieg, Eigentumsverhältnisse, soziale Autonomie, ideologische Vorgaben, historischer Kontext.
Häufig gestellte Fragen zur Bodenreform in der SBZ 1945/46
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Bodenreform in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) von 1945/46. Sie untersucht die Ausgangslage, den Ablauf der Reform und ihren Charakter als mögliche diktatorische Maßnahme. Die Arbeit beleuchtet die Reform als Transformationsprozess mit weitreichenden Folgen für Eigentumsverhältnisse und soziale Strukturen im ländlichen Raum und vergleicht sie mit Entwicklungen in den westlichen Besatzungszonen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Nachkriegssituation in der SBZ, die ideologischen Grundlagen und politischen Ziele der Bodenreform, den Ablauf der Reform (Vorbereitung, Durchführung, Umsetzung), die Ergebnisse und Auswirkungen auf die ländliche Gesellschaft sowie einen Vergleich mit den westlichen Besatzungszonen. Es wird der historische Kontext, die Rolle der Kommunisten und die "Kampfparole „Junkerland in Bauernhand“ erörtert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zum Forschungsstand, ein Kapitel zur Nachkriegssituation (inkl. Einordnung in den historischen Kontext und der Situation der Landbevölkerung), ein Kapitel zur Bodenreform (inkl. ideologischer Vorgaben und Vorbereitung/Durchführung), ein Kapitel zu Ergebnis und Ausblick und abschließend ein Fazit. Zusätzlich werden Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter bereitgestellt.
Welche unterschiedlichen Perspektiven auf die Bodenreform werden dargestellt?
Die Arbeit zeigt den Unterschied zwischen der DDR- und BRD-Perspektive auf die Bodenreform auf. In der DDR wurde sie positiv dargestellt, in der BRD oft kritisch als Sozialisierung und Sowjetisierung interpretiert. Der Zugang zu den DDR-Archiven nach der Wende ermöglichte eine differenziertere Betrachtung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bodenreform, Sowjetische Besatzungszone, DDR, Kommunismus, Landfrage, Junker, Bauern, antifaschistisch-demokratische Revolution, Transformationsprozess, Kalter Krieg, Eigentumsverhältnisse, soziale Autonomie, ideologische Vorgaben, historischer Kontext.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit wird im Dokument nicht explizit dargestellt, aber die Arbeit zielt auf eine umfassende Analyse der Bodenreform in der SBZ, ihrer Ursachen, ihres Ablaufs und ihrer Folgen ab, wobei verschiedene Perspektiven und der historische Kontext berücksichtigt werden.
Wie wird die Bodenreform im Kontext der Nachkriegsordnung bewertet?
Die Bodenreform wird als radikaler Eingriff in die Eigentumsverhältnisse und die soziale Struktur des ländlichen Raumes beschrieben, der im Kontext der Nachkriegsordnung und der Auseinandersetzung zwischen den Besatzungsmächten zu verstehen ist. Der Widerspruch zwischen der propagierten „antifaschistisch-demokratischen Revolution“ und dem Rückgriff auf nationalsozialistische Methoden wird kritisch beleuchtet.
- Quote paper
- B.A. Christian Pauer (Author), 2006, Die Bodenreform in der Sowjetischen Besatzungszone 1945/46, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82461