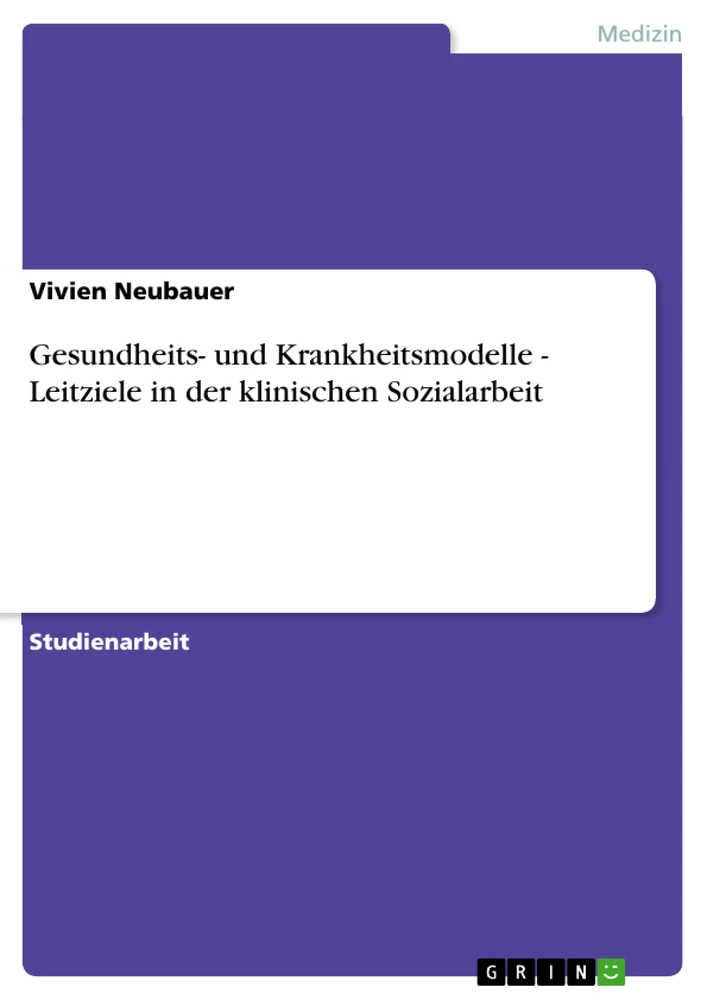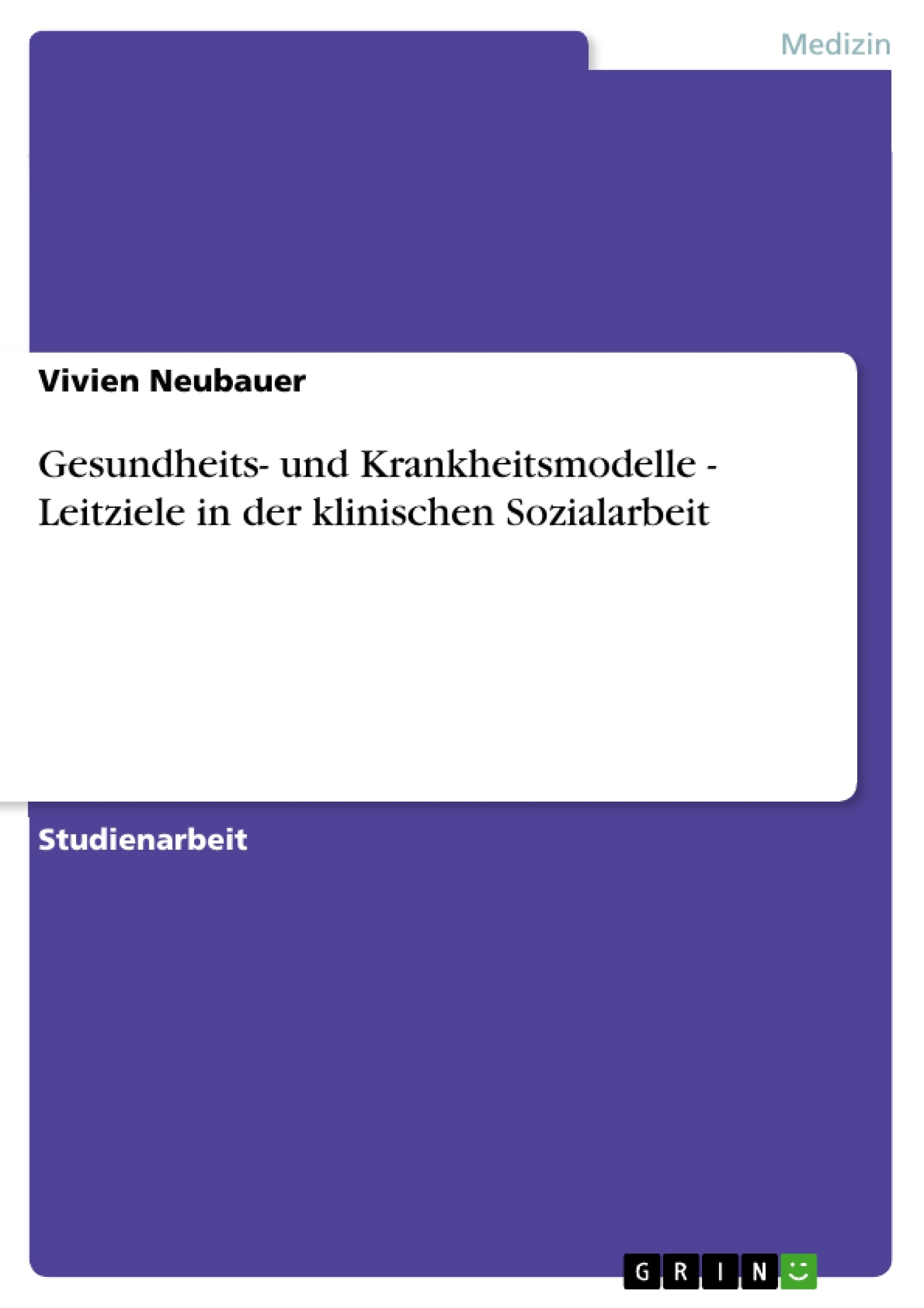Mit dem Thema Gesundheit setzen sich heutzutage nicht nur die Politiker, Experten und verschiedene Professionen auseinander, sondern auch viele Menschen beschäftigen sich täglich im Alltag damit. Gesundheit ist ein hohes Gut und es betrifft uns alle. Über Gesundheit kann jede und jeder mitreden, weil alle irgendwelche Erfahrungen in ihrem eigenen Leben gemacht haben. Gesundheit ist in gewisser Weise zu einem Allerweltsthema in unserer Gesellschaft geworden. In der Wertehierarchie der Bevölkerung steht die Gesundheit ganz oben. Es besteht aber auch eine große Diskrepanz zwischen dem abstrakten Wert und seiner Handlungsrelevanz. Im Alltag wird Gesundheit oft weit nach hinten geschoben, weil anderes wichtiger er-scheint. Geht die Gesundheit durch Krankheit verloren, dann erlangt sie sehr schnell eine fast existentielle Bedeutung für den Betroffenen und zwingt zum Handeln. Der Klinische Sozial-dienst greift weniger in die medizinische Behandlung, sondern in das soziale Umfeld des Betroffenen ein, um eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft nach dem Krankenhausaufenthalt zu ermöglichen. Im Klinischen Sozialdienst sind die Begriffe Krankheit und Gesundheit in der täglichen Arbeit mit den Betroffenen von zentraler Bedeutung. In meiner Studien-arbeit möchte ich deswegen zuerst einen relativ kurzen Einblick über die Gesundheitspsychologie geben. Danach werde ich speziell auf die zwei dazugehörigen Begriffe Gesundheit und Krankheit näher eingehen. Mein Schwerpunkt in dieser Studienarbeit liegt auf den Krankheits- und Gesundheitsmodellen der Gesundheitspsychologie. Die 3 grundlegenden Paradigmen werde ich näher erläutern. Am Ende meiner Studienarbeit möchte ich Bezug auf die Paradigmen nehmen, weil diese in der alltäglichen Arbeit im Klinischen Sozialdienst eine bedeutende Rolle einnehmen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gesundheitspsychologie
- 2.1 Geschichte
- 2.2 Definition und Aufgaben
- 2.2.1 Definition
- 2.2.2 Aufgaben
- 2.3 Erkenntnisse der Gesundheitspsychologie
- 3. Gesundheit und Krankheit
- 3.1 Gesellschaftliche Auffassungen
- 3.2 Expertenbegriff Gesundheit
- 3.2.1 Definition
- 3.2.2 Sicht des Medizinsoziologen Talcott Parson
- 3.3 Expertenbegriff Krankheit
- 3.3.1 Definition
- 3.3.2 Sicht des Medizinsoziologen Talcott Parson
- 4. Paradigmen der Gesundheitspsychologie: Krankheits- und Gesundheitsmodelle
- 4.1 Die Paradigmen
- 4.2 Das biomedizinische Krankheitsmodell
- 4.2.1 Kennzeichen
- 4.2.2 Kritikschwerpunkte
- 4.3 Das psychosoziale Krankheitsmodell
- 4.3.1 Grundannahmen
- 4.3.2 Übergang zum biopsychosozialen Modell
- 4.4 Das biopsychosoziale Krankheitsmodell
- 4.5 Das Paradigma der Salutogenese
- 5. Anwendung im klinischen Sozialdienst
- 5.1 Verständnis von Gesundheit und Krankheit
- 5.2 Ziele, Aufgaben und Kernelemente
- 5.2.1 Ziele
- 5.2.2 Aufgaben
- 5.2.3 Kernelemente
- 5.3 Praktische Anwendungen der Modelle im Klinischen Sozialdienst
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht die Konzepte von Gesundheit und Krankheit, insbesondere im Kontext des klinischen Sozialdienstes. Ziel ist es, verschiedene Gesundheits- und Krankheitsmodelle der Gesundheitspsychologie zu beleuchten und deren Relevanz für die praktische Arbeit im Sozialdienst aufzuzeigen.
- Gesundheitspsychologische Grundlagen und deren historische Entwicklung
- Definitionen und gesellschaftliche Auffassungen von Gesundheit und Krankheit
- Vergleichende Analyse verschiedener Krankheitsmodelle (biomedizinisch, psychosozial, biopsychosozial)
- Das Paradigma der Salutogenese
- Anwendung der Modelle im klinischen Sozialdienst und deren Bedeutung für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Gesundheit und Krankheit ein und betont deren zentrale Bedeutung im Alltag und im klinischen Sozialdienst. Sie erläutert die Diskrepanz zwischen dem abstrakten Wert von Gesundheit und ihrer praktischen Umsetzung im Alltag. Die Arbeit kündigt die folgenden Abschnitte an: einen Überblick über die Gesundheitspsychologie, eine detailliertere Betrachtung der Begriffe Gesundheit und Krankheit, eine Analyse von Krankheitsmodellen und schließlich deren Anwendung im klinischen Sozialdienst.
2. Gesundheitspsychologie: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die relativ junge Disziplin der Gesundheitspsychologie. Es beleuchtet die historische Entwicklung, die durch Veränderungen im Gesundheitsbegriff, wechselnde Krankheitsmuster, steigende Gesundheitskosten und einen Paradigmenwechsel geprägt wurde. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von einer biomedizinischen hin zu einer biopsychosozialen Perspektive, die psychische und soziale Faktoren in die Betrachtung von Gesundheit und Krankheit integriert. Die Entstehung der Gesundheitspsychologie wird als interdisziplinäre Entwicklung dargestellt.
3. Gesundheit und Krankheit: Dieses Kapitel befasst sich mit den Definitionen von Gesundheit und Krankheit, sowohl aus gesellschaftlicher Sicht als auch aus der Perspektive von Experten. Es analysiert verschiedene Auffassungen von Gesundheit und Krankheit, einschließlich der Perspektive des Medizinsoziologen Talcott Parsons, welcher einen umfassenden Ansatz anwendet. Der Abschnitt beleuchtet die verschiedenen Perspektiven und Verständnisweisen von Gesundheit und Krankheit, was für den weiteren Verlauf der Arbeit fundamental ist.
4. Paradigmen der Gesundheitspsychologie: Krankheits- und Gesundheitsmodelle: Dieser zentrale Abschnitt erläutert verschiedene Paradigmen der Gesundheitspsychologie, konzentriert auf Krankheits- und Gesundheitsmodelle. Es werden das biomedizinische Modell, das psychosoziale Modell und das biopsychosoziale Modell detailliert beschrieben, einschließlich ihrer Kennzeichen, Kritikpunkte und Grundannahmen. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Übergang vom psychosozialen zum biopsychosozialen Modell. Das Kapitel schließt mit einer Betrachtung des Paradigmas der Salutogenese ab, welches einen positiven Gesundheitsbegriff im Mittelpunkt hat.
5. Anwendung im klinischen Sozialdienst: Der abschließende inhaltliche Abschnitt widmet sich der Anwendung der zuvor vorgestellten Krankheits- und Gesundheitsmodelle im klinischen Sozialdienst. Es werden die Bedeutung des Verständnisses von Gesundheit und Krankheit, sowie Ziele, Aufgaben und Kernelemente der Arbeit im klinischen Sozialdienst im Kontext dieser Modelle erläutert. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der theoretischen Modelle in der täglichen Arbeit mit Betroffenen.
Schlüsselwörter
Gesundheitspsychologie, Krankheitsmodelle, Gesundheitsmodelle, Biomedizinisches Modell, Psychosoziales Modell, Biopsychosoziales Modell, Salutogenese, Klinischer Sozialdienst, Gesundheit, Krankheit, Prävention, Rehabilitation, Gesellschaftliche Auffassungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studienarbeit: Gesundheit und Krankheit im Kontext des Klinischen Sozialdienstes
Was ist der Gegenstand dieser Studienarbeit?
Die Studienarbeit untersucht die Konzepte von Gesundheit und Krankheit, insbesondere im Kontext des klinischen Sozialdienstes. Sie beleuchtet verschiedene Gesundheits- und Krankheitsmodelle der Gesundheitspsychologie und deren Relevanz für die praktische Arbeit im Sozialdienst.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Gesundheitspsychologische Grundlagen und deren historische Entwicklung, Definitionen und gesellschaftliche Auffassungen von Gesundheit und Krankheit, vergleichende Analyse verschiedener Krankheitsmodelle (biomedizinisch, psychosozial, biopsychosozial), das Paradigma der Salutogenese und die Anwendung der Modelle im klinischen Sozialdienst und deren Bedeutung für die Praxis.
Welche Krankheitsmodelle werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht das biomedizinische, das psychosoziale und das biopsychosoziale Krankheitsmodell. Es werden deren Kennzeichen, Kritikpunkte und Grundannahmen detailliert beschrieben.
Was ist die Salutogenese und welche Rolle spielt sie in der Arbeit?
Die Arbeit betrachtet das Paradigma der Salutogenese, welches einen positiven Gesundheitsbegriff in den Mittelpunkt stellt. Es wird in den Kontext der anderen Krankheitsmodelle eingeordnet und dessen Relevanz für den klinischen Sozialdienst diskutiert.
Wie werden die Krankheitsmodelle im klinischen Sozialdienst angewendet?
Der letzte Abschnitt der Arbeit widmet sich der praktischen Anwendung der vorgestellten Krankheits- und Gesundheitsmodelle im klinischen Sozialdienst. Es werden die Bedeutung des Verständnisses von Gesundheit und Krankheit, sowie Ziele, Aufgaben und Kernelemente der Arbeit im klinischen Sozialdienst im Kontext dieser Modelle erläutert.
Welche Definitionen von Gesundheit und Krankheit werden verwendet?
Die Arbeit analysiert verschiedene Auffassungen von Gesundheit und Krankheit, sowohl aus gesellschaftlicher Sicht als auch aus der Perspektive von Experten, einschließlich der Perspektive des Medizinsoziologen Talcott Parsons.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gesundheitspsychologie, Krankheitsmodelle, Gesundheitsmodelle, Biomedizinisches Modell, Psychosoziales Modell, Biopsychosoziales Modell, Salutogenese, Klinischer Sozialdienst, Gesundheit, Krankheit, Prävention, Rehabilitation, Gesellschaftliche Auffassungen.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, welche die zentralen Inhalte und Argumente jedes Abschnitts zusammenfasst.
Welche Zielsetzung verfolgt die Studienarbeit?
Ziel der Arbeit ist es, verschiedene Gesundheits- und Krankheitsmodelle der Gesundheitspsychologie zu beleuchten und deren Relevanz für die praktische Arbeit im Sozialdienst aufzuzeigen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist strukturiert in Einleitung, Kapitel zur Gesundheitspsychologie, Kapitel zu Gesundheit und Krankheit, Kapitel zu den Paradigmen der Gesundheitspsychologie (Krankheits- und Gesundheitsmodelle), Kapitel zur Anwendung im klinischen Sozialdienst und Schlussfolgerung/Zusammenfassung. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
- Quote paper
- Dipl.Sozialpädagogin Vivien Neubauer (Author), 2006, Gesundheits- und Krankheitsmodelle - Leitziele in der klinischen Sozialarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82415