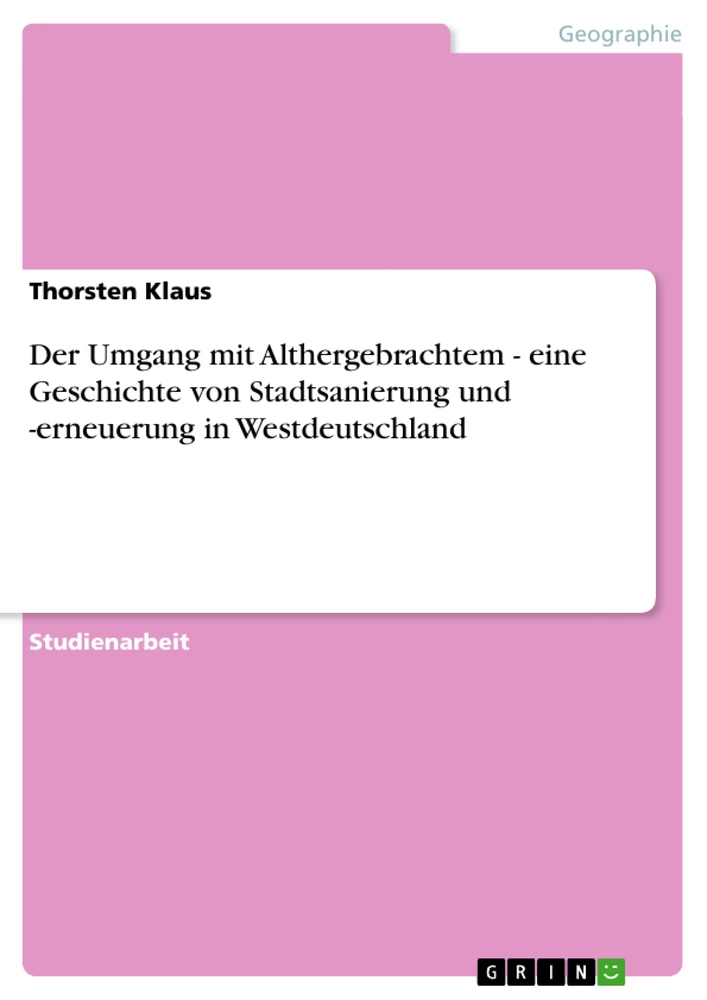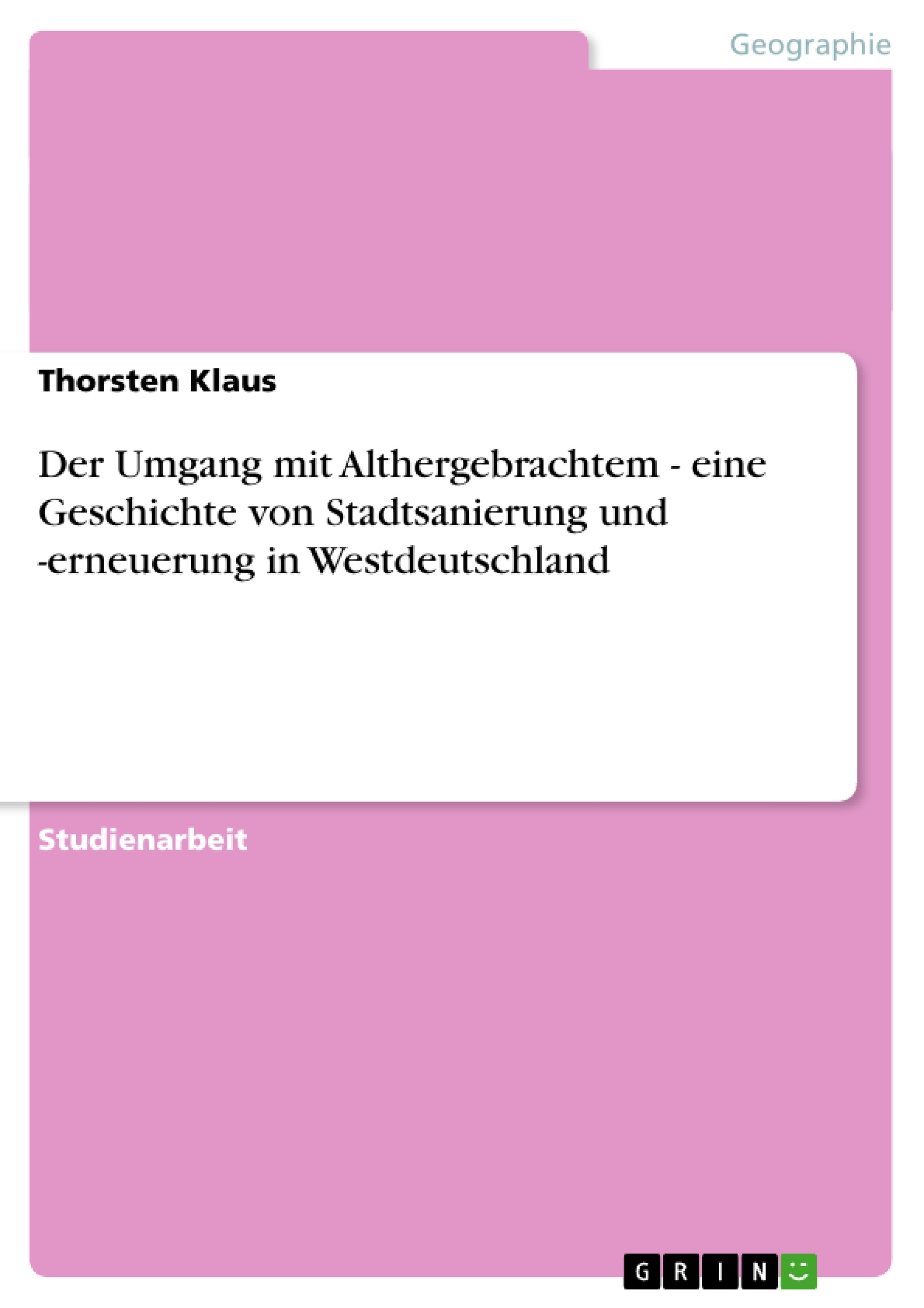Ziel dieses ersten Teils der vorliegenden Arbeit ist es, das Konzept der Stadtsanierung darzustellen und kritisch zu hinterfragen. Städte sind immer Produkte der Gesellschaft. Wie im Titel angedeutet, liegt daher ein besonderer Schwerpunkt auf der Frage des Umganges der Gesellschaft mit ihren Stadträumen. Welche Bedeutung wird ihnen zugeschrieben und welche Ansprüche hat die Gesellschaft an ihre Städte?
Der zweite Teil der Arbeit befasst sich überwiegend mit dem Thema der Stadterneuerung. Zu Beginn werden die Begrifflichkeiten von Stadterneuerung und Stadtsanierung unterschieden, die in der Literatur des Öfteren nebeneinander verwand werden.
Die Geschichte der Stadterneuerung mit besonderem Augenmerk auf die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg soll einen tieferen Einblick in die über die Jahre entwickelten Sichtweisen zu Stadterneuerung geben. Die heutige Sichtweise bezogen auf Stadterneuerung ist viel differenzierter und „sanfter“, als zu Zeiten der Nachkriegsjahre.
An zwei Beispielen werden die verschiedenen Herangehensweisen von Stadterneuerung verdeutlicht. Da die beiden Konzepte von Stadtsanierung und -erneuerung z. T. große Ähnlichkeiten aufweisen und die beiden Begriffe in der Literatur oft synonym verwendet werden, soll hier eine genauere Differenzierung vorgenommen werden, um Unklarheiten auszuschließen.
„Die Stadterneuerung ist als komplexe Aufgabe zu betrachten, deren Lösungsmöglichkeiten zwischen der Flächensanierung und Neubebauung einerseits und der Modernisierung andererseits liegen.“ (DER BUNDESMINISTER FÜR RAUMORDNUNG, BAUWESEN UND STÄDTEBAU 1976: 15). Somit findet sich in der Stadterneuerung die Stadtsanierung wieder, die einen Großteil dessen ausmacht. Sanierungsmaßnahmen tragen dazu bei, dass Stadterneuerung geschehen kann. Die Sanierung ist somit als Werkzeug der Stadterneuerung zu verstehen. Die Stadterneuerung ist damit beauftragt alle Aspekte einer Stadt, wie Wohnbevölkerung, Einkaufsmöglichkeiten, Verkehr, Industrie, sowie bestehende Bausubstanz mit einem stetigen Wandel der Modernisierung, Erhaltung und Erneuerung in Einklang zu bringen. Diese hohen Anforderungen an die Stadterneuerung haben sich im Laufe der letzten 60-70 Jahre herauskristallisiert und nicht immer wurde auf alle oben genannten Aspekte Rücksicht genommen.
Inhaltsverzeichnis
- A) Der Umgang mit Althergebrachtem: Eine Geschichte von Stadtsanierung in Westdeutschland...
- 1. Vorbemerkungen.
- 2. Stadtsanierung im Wandel der Zeit.
- 3. Gesetzliche Rahmenbedingungen..........\n
- 4. Ablauf einer Sanierung
- 5. Sanierung für wen?......
- 6. Fallstudie Sanierung Essen-Steele.…..........\n
- 7. Fazit..........\n
- B) Der Umgang mit Althergebrachtem: eine Geschichte von Stadterneuerung in Westdeutschland..
- 8. Einleitung
- 9. Aufgaben der Stadterneuerung
- 10. Geschichte der Stadterneuerung.
- 11. Public-Private-Partnership und die „sanfte\" Stadterneuerung am Beispiel Wiens
- 12. Stadterneuerung in Klein- und Mittelstädten am Beispiel Straelens
- 13. Fazit.......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Geschichte von Stadtsanierung und -erneuerung in Westdeutschland, wobei der Fokus auf dem Umgang mit Althergebrachtem liegt. Das Ziel der Arbeit ist es, das Konzept der Stadtsanierung und -erneuerung darzustellen und kritisch zu hinterfragen, insbesondere im Hinblick auf die Bedeutung, die der Gesellschaft ihren Stadträumen zuschreibt.
- Die Evolution der Stadtsanierung im Laufe der Zeit.
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Stadtsanierung in Deutschland.
- Die verschiedenen Ziele und Zielgruppen der Stadtsanierung.
- Die Rolle der Public-Private-Partnership bei der Stadterneuerung.
- Fallstudien von Stadtsanierungs- und Stadterneuerungsprojekten in Westdeutschland.
Zusammenfassung der Kapitel
A) Der Umgang mit Althergebrachtem: Eine Geschichte von Stadtsanierung in Westdeutschland
Das erste Kapitel stellt die Stadtsanierung als Teilbereich der Stadtentwicklungsplanung vor und untersucht die historischen Entwicklungen, die zu den verschiedenen Ansätzen der Stadtsanierung geführt haben. Dabei wird auch auf die Rolle der Gesellschaft bei der Gestaltung von Stadträumen eingegangen.
Kapitel 2 befasst sich mit der Entwicklung der Stadtsanierung im Wandel der Zeit, von der Antike bis zur Neuzeit. Es werden die unterschiedlichen Herangehensweisen und Zielsetzungen der Sanierungsmaßnahmen in verschiedenen Epochen beleuchtet, wie beispielsweise die drastischen Eingriffe der Nationalsozialisten oder die Umgestaltung mittelalterlicher Stadtviertel im 19. Jahrhundert.
In Kapitel 3 werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Stadtsanierung in Deutschland vorgestellt. Es wird auf das Städtebauförderungsgesetz und die entsprechenden Paragraphen im Baugesetzbuch eingegangen, die die rechtlichen Grundlagen für Sanierungsmaßnahmen definieren.
Kapitel 4 beschreibt den Ablauf einer typischen Sanierung. Es werden die verschiedenen Phasen der Sanierungsprozesse, von der Planung bis zur Umsetzung, dargestellt.
Kapitel 5 untersucht die Zielgruppen der Stadtsanierung und die sozialen und ökonomischen Auswirkungen der Maßnahmen auf die Bewohner der sanierten Gebiete.
Kapitel 6 präsentiert eine Fallstudie zur Sanierung des Essener Stadtteils Steele, die die Anwendung der Sanierungskonzepte in der Praxis veranschaulicht.
Kapitel 7 fasst die wichtigsten Erkenntnisse des ersten Teils der Arbeit zusammen und stellt eine kritische Bewertung des Konzepts der Stadtsanierung vor.
B) Der Umgang mit Althergebrachtem: eine Geschichte von Stadterneuerung in Westdeutschland
Kapitel 8 führt in den zweiten Teil der Arbeit ein, der sich mit der Stadterneuerung befasst. Es werden die Aufgaben und Ziele der Stadterneuerung im Vergleich zur Stadtsanierung erläutert.
Kapitel 9 geht auf die verschiedenen Aufgaben der Stadterneuerung ein, wie beispielsweise die Revitalisierung von Stadtzentren, die Entwicklung von neuen Wohnformen und die Verbesserung der Lebensqualität in Städten.
Kapitel 10 zeichnet die Geschichte der Stadterneuerung in Westdeutschland nach und beleuchtet die Entwicklung neuer Konzepte und Ansätze im Laufe der Zeit.
Kapitel 11 untersucht die Rolle der Public-Private-Partnership bei der Stadterneuerung, am Beispiel der „sanften“ Stadterneuerung in Wien.
Kapitel 12 präsentiert eine Fallstudie zur Stadterneuerung in der Kleinstadt Straelen, die zeigt, wie die Konzepte der Stadterneuerung in kleineren Städten umgesetzt werden können.
Kapitel 13 fasst die wichtigsten Erkenntnisse des zweiten Teils der Arbeit zusammen und bietet eine kritische Betrachtung der Stadterneuerung als Konzept.
Schlüsselwörter
Stadtsanierung, Stadterneuerung, Westdeutschland, Althergebrachtes, Stadtentwicklungsplanung, Stadtplanung, Geschichte, Gesetze, Rahmenbedingungen, Fallstudien, Public-Private-Partnership, Wohnen, Arbeitsverhältnisse, Städtebauliche Missstände, Modernisierung, Erhaltung, Veränderungen, Revitalisierung, Lebensqualität, Soziale Folgen, Wirtschaftliche Folgen, Zielgruppen, Planungsprozesse, Umsetzung, Kritik, Bewertung.
- Quote paper
- Thorsten Klaus (Author), 2007, Der Umgang mit Althergebrachtem - eine Geschichte von Stadtsanierung und -erneuerung in Westdeutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82381