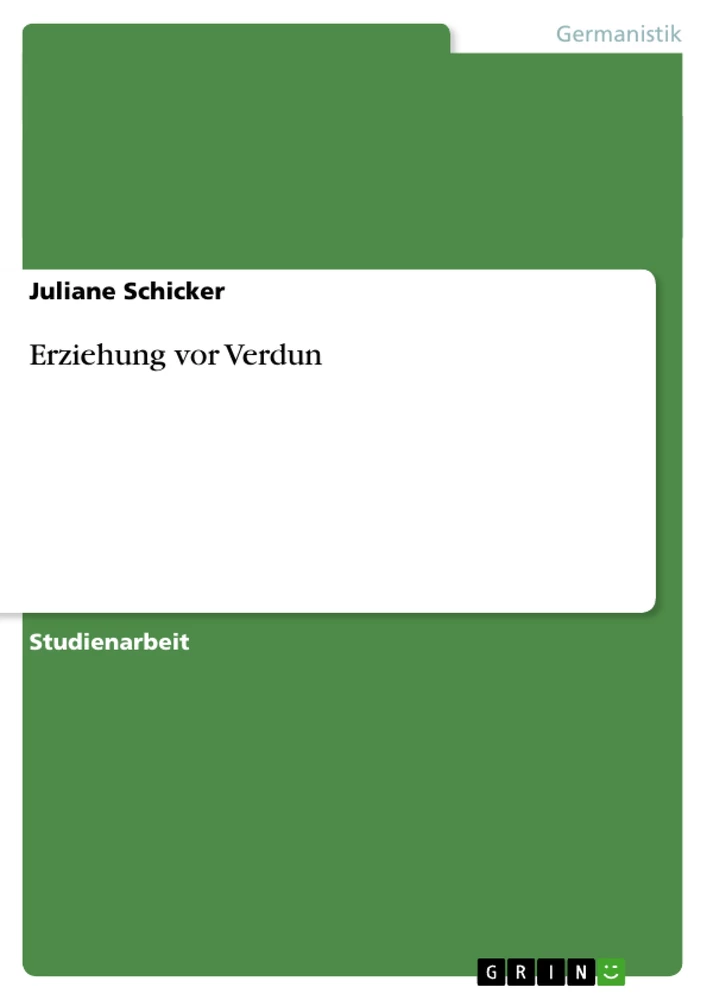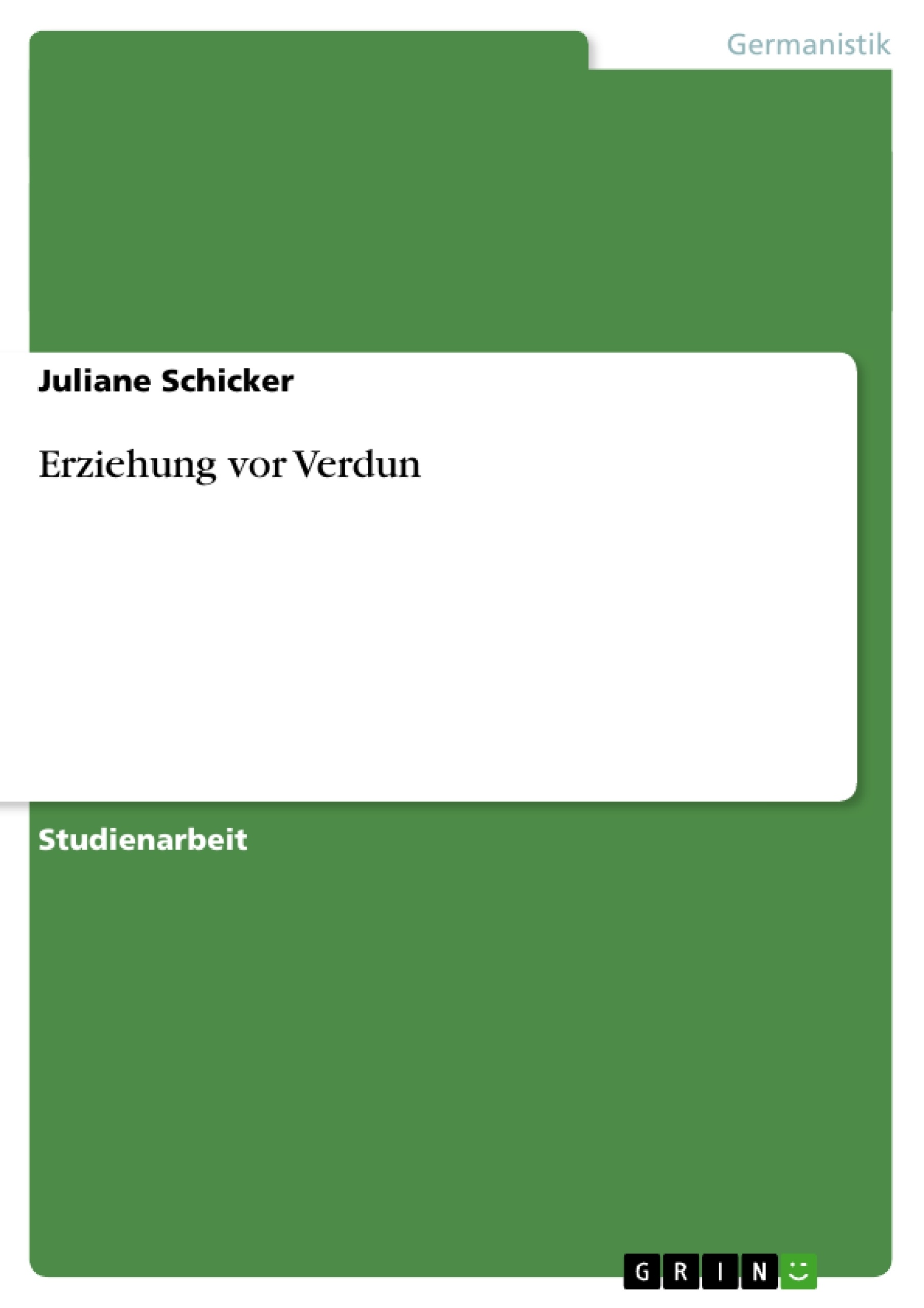1934 nahm der erste Präsident der Deutschen Akademie der Künste Arnold Zweig mit 47 Jahren seine Arbeit am Roman Erziehung vor Verdun wieder auf, nachdem er ein verloren geglaubtes Manuskript von 1928 gefunden hatte. Hinter ihm lag die Entscheidung, mit seiner Frau nach Palästina auszuwandern, um dem Nazi-Regime zu entgehen. Vor ihm lag eine Zeit der Unsicherheit, Geldnot und Bedrängnis. Wie kommt ein überzeugter Zionist nach der Machtergreifung Hitlers und der Verbrennung seiner Bücher durch die Nazis dazu, einen Romanzyklus zu schreiben, der sich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt? Wie wird in diesem Roman der Krieg dargestellt? Auf diese Fragen soll diese Hausarbeit Antwort finden.
Arnold Zweig sah einen direkten Zusammenhang zwischen dem Jahr 1914 und der Machtübernahme Hitlers 1933, denn die Nachwirkungen des Ersten Weltkrieges waren noch deutlich zu spüren. So sah Zweig in der Veröffentlichung des Romans Erziehung vor Verdun eine Möglichkeit, für die aktuelle politische Situation und ihre Ursachen eine Erklärung zu bieten. In dieser Hausarbeit soll somit die Einstellung Zweigs zum Krieg untersucht und ihre literarische Umsetzung im Roman analysiert werden. Denn der Krieg verändert die Sicht auf die Dinge, doch die eigene Sicht auf die Dinge verändert auch die Ansicht vom Krieg. Da das Werk stark autobiographische Züge aufweist, ist es meines Erachtens notwendig, eine Kurzbiographie Zweigs voranzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Arnold Zweig
- Erziehung vor Verdun
- Darstellung des Krieges im Roman
- Krieg ist Geschäft
- Krieg ist eine Lüge
- Krieg ist Gewohnheit
- Krieg bedeutet Willkür
- Krieg ist allumfassend
- Krieg bedeutet Willenlosigkeit
- Krieg ist notwendig
- Krieg ist eine Krankheit
- Krieg als Veränderungsmöglichkeit
- Krieg ist unpersönlich
- Krieg ist etwas von höheren Mächten Geschaffenes
- Krieg ist unsterblich
- Krieg ist Erziehung
- Warum hat Zweig Krieg so dargestellt?
- Literatur
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Darstellung des Ersten Weltkriegs im Roman „Erziehung vor Verdun“ von Arnold Zweig. Sie untersucht die Entstehung des Romans im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse der Zeit und analysiert die literarische Umsetzung der Kriegserfahrungen des Autors.
- Die Darstellung des Krieges als ein komplexes Phänomen, das sowohl wirtschaftliche und politische Interessen als auch psychologische und soziale Folgen umfasst.
- Die Rolle des Ersten Weltkriegs in der Entstehung des Nationalsozialismus.
- Die autobiographischen Elemente in Zweigs Werk und ihr Einfluss auf die Darstellung des Krieges.
- Die literarische Umsetzung der Kriegserfahrungen in „Erziehung vor Verdun“.
- Die Bedeutung der literarischen Gestaltung des Krieges für die politische und gesellschaftliche Debatte.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung und führt den Leser in die Thematik der Hausarbeit ein. Der Fokus liegt dabei auf der Entstehung des Romans „Erziehung vor Verdun“ im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse der Zeit. Das zweite Kapitel beleuchtet die Biographie des Autors Arnold Zweig und seine Erfahrungen im Ersten Weltkrieg. Die Kapitel 3 bis 4 befassen sich mit der Darstellung des Krieges in „Erziehung vor Verdun“ und analysieren die verschiedenen Facetten des Krieges, wie er im Roman zur Sprache kommt. Dabei werden Themen wie die wirtschaftlichen und politischen Interessen hinter dem Krieg, die psychologischen und sozialen Folgen des Krieges und die Rolle des Krieges in der Entstehung des Nationalsozialismus behandelt.
Schlüsselwörter
Der Erste Weltkrieg, Arnold Zweig, „Erziehung vor Verdun“, Kriegserfahrungen, politische und gesellschaftliche Verhältnisse, autobiographische Elemente, literarische Gestaltung, Nationalsozialismus, Zionismus, Exil, Pazifismus, Antimilitarismus.
- Quote paper
- Juliane Schicker (Author), 2006, Erziehung vor Verdun, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82363