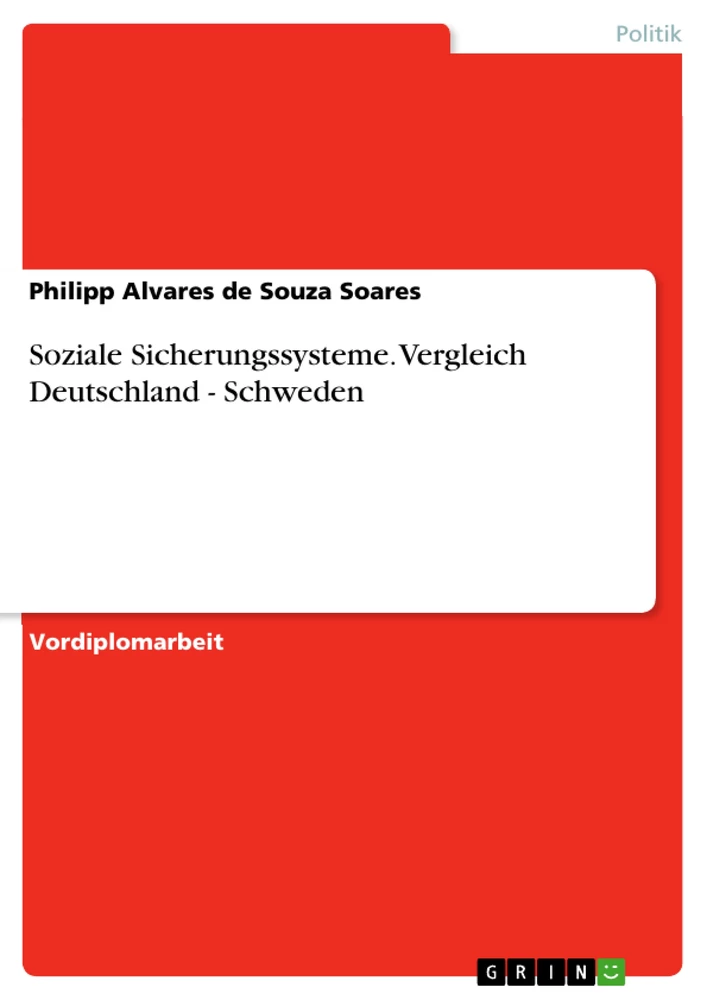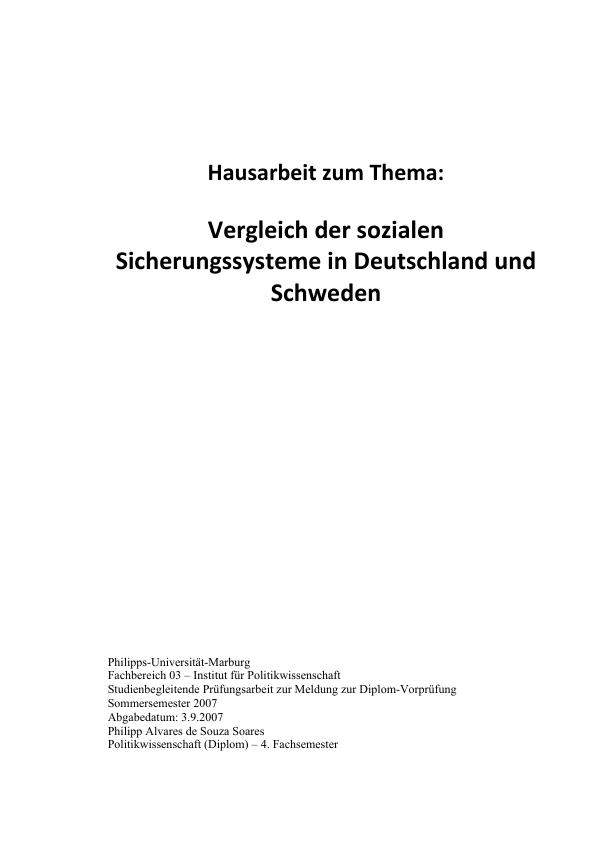Das Thema soziale Sicherung ist in der öffentlichen wie wissenschaftlichen Diskussion zu einem wahren Dauerbrenner geworden. Das ist nicht verwunderlich wenn man die Entwicklung des sogenannten Sozialstaats etwas näher betrachtet. War dieser Anfang des vergangenen Jahrhunderts zunächst nur verstreut und wenn meist marginal vertreten, erlebte er spätestens nach Ende des zweiten Weltkriegs einen rasanten Aufstieg. Immer mehr europäische Demokratien versuchten den Risiken, die durch Industrialisierung und Kapitalismus entstanden waren, durch staatliche Institutionen den Schrecken zu nehmen und so auch dem fortschreitenden gesellschaftlichen Wandel gerecht zu werden. Daraufhin, in der durch hohes Wachstum geprägten Zeit bis zu den 1970er Jahren, erlebte der Sozialstaat eine beispiellose Expansion und wurde zu einem festen Bestandteil vieler Gesellschaften. Unter dem Druck von Globalisierung und demographischen Wandel, wurde es dann ab den 1980er Jahren immer dringlicher den liebgewonnenen Wohlfahrtsstaat zu reformieren, um ihn den veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Dieser Reformprozess fiel vielerorts schwer und ist oftmals bis heute noch nicht abgeschlossen.
Deutschland, einst Pionier wie Modell, was die soziale Sicherung anbelangt, ist nicht zuletzt durch die Lasten der Wiedervereinigung zu einem Problemfall im europäischen Vergleich geworden. Schon seit Jahren werden hier „Reformstau“ und steigende finanzielle Lasten beklagt.
In dieser Arbeit sollen diese beiden unterschiedlichen Modelle des Sozialstaats in ihrer aktuellen Ausprägung untersucht und miteinander verglichen werden. Dazu wird zunächst ein Überblick über verschiedene Methoden der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung gegeben. Daraufhin werden die maßgeblichen Grundlagen und institutionellen Systeme der sozialen Sicherung beider Länder dargestellt, um so einen vergleichende Betrachtung zu ermöglichen. Ferner wird ein Vergleich beider Wohlfahrtsstaaten nach den Kriterien Gøsta Esping-Andersens durchgeführt, welche in der von mir bearbeiteten Literatur als besonders aussagekräftig herausstachen. Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass in dieser Arbeit die Begriffe „Sozialstaat“ und „Wohlfahrtsstaat“ als Synonyme gebraucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung
- 2.1 Die typologische Methode Esping-Andersens
- 2.2 Esping-Andersens drei Welten der Wohlfahrtsstaaten
- 3. Soziale Sicherung in Schweden
- 3.1 Rentenversicherung
- 3.1.1 Das alte System
- 3.1.2 Das neue System
- 3.2 Krankenversicherung
- 3.3 Arbeitslosenversicherung
- 4. Soziale Sicherung in Deutschland
- 4.1 Rentenversicherung
- 4.2 Krankenversicherung
- 4.3 Arbeitslosenversicherung
- 5. Vergleich Deutschland-Schweden nach Esping-Andersen
- 5.1 Grad der Dekommodifizierung
- 5.2 Grad der Stratifizierung
- 5.3 Mischung privater und staatlicher Vorsorge
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die aktuellen Sozialversicherungssysteme in Deutschland und Schweden und vergleicht sie anhand der typologischen Methode von Gøsta Esping-Andersen. Das Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Systeme im Hinblick auf ihre Dekommodifizierung, Stratifizierung und die Mischung privater und staatlicher Vorsorge aufzuzeigen.
- Vergleich der Sozialversicherungssysteme in Deutschland und Schweden
- Anwendung der typologischen Methode von Esping-Andersen
- Analyse der Dekommodifizierung, Stratifizierung und Vorsorgemodelle
- Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den beiden Systemen
- Entwicklung und Gestaltung des Sozialstaats im Wandel
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Soziale Sicherung ein und erläutert die Relevanz des Themas im Kontext von Industrialisierung, Kapitalismus und gesellschaftlichem Wandel. Sie stellt die beiden zu vergleichenden Systeme, Deutschland und Schweden, im Kontext ihrer jeweiligen Entwicklung und Reformbestrebungen vor.
- Kapitel 2: Vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Methoden der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung, darunter die quantitative, historisch-vergleichende, institutionell-vergleichende und die typologische Methode. Es erläutert die Stärken und Schwächen der einzelnen Methoden und hebt die besondere Relevanz der typologischen Methode nach Esping-Andersen hervor, welche in dieser Arbeit angewandt wird.
- Kapitel 3: Soziale Sicherung in Schweden: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die soziale Sicherung in Schweden, einschließlich der Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung. Es beschreibt das historische und aktuelle System sowie die wichtigsten Reformschritte.
- Kapitel 4: Soziale Sicherung in Deutschland: Dieses Kapitel stellt die sozialen Sicherungssysteme in Deutschland vor, mit Fokus auf Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung. Es beleuchtet den deutschen Sozialstaat im Wandel und die aktuellen Herausforderungen.
- Kapitel 5: Vergleich Deutschland-Schweden nach Esping-Andersen: Dieses Kapitel vergleicht die beiden Systeme nach den Kriterien der Dekommodifizierung, Stratifizierung und Mischung privater und staatlicher Vorsorge, um so die jeweiligen Modelle des Sozialstaats nach Esping-Andersens Typologie zu klassifizieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der sozialen Sicherung, Wohlfahrtsstaatsforschung, Dekommodifizierung, Stratifizierung, Vergleichender Politikwissenschaft, Sozialstaat, Schweden und Deutschland. Die wichtigsten Themen der Arbeit liegen im Bereich der Sozialpolitik und der vergleichenden Analyse von Sozialsystemen.
- Quote paper
- Philipp Alvares de Souza Soares (Author), 2007, Soziale Sicherungssysteme. Vergleich Deutschland - Schweden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82300