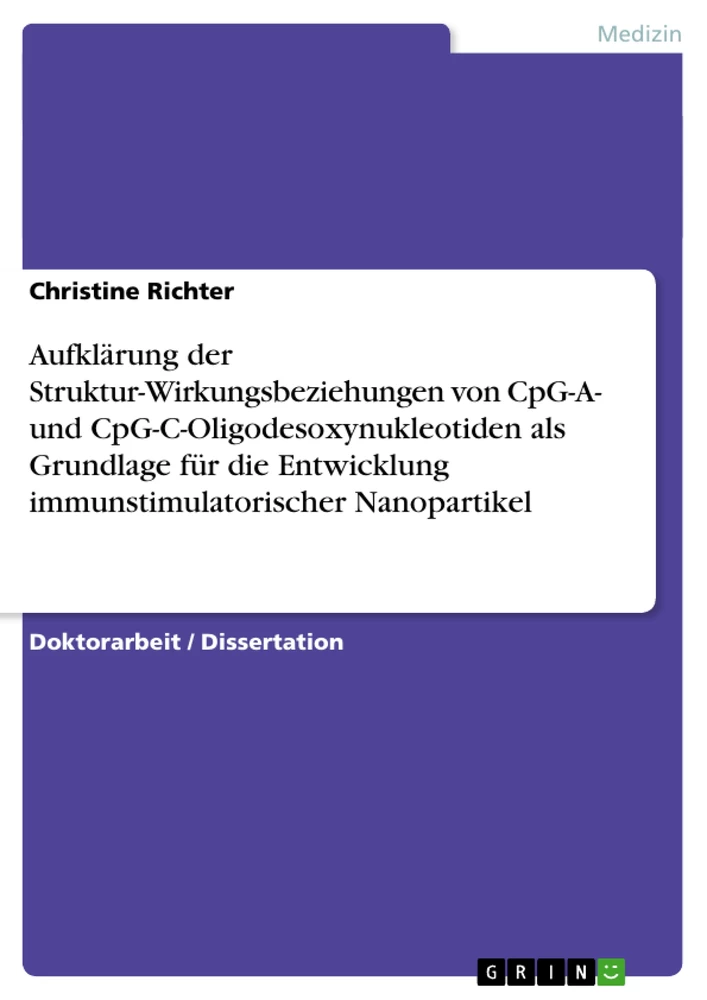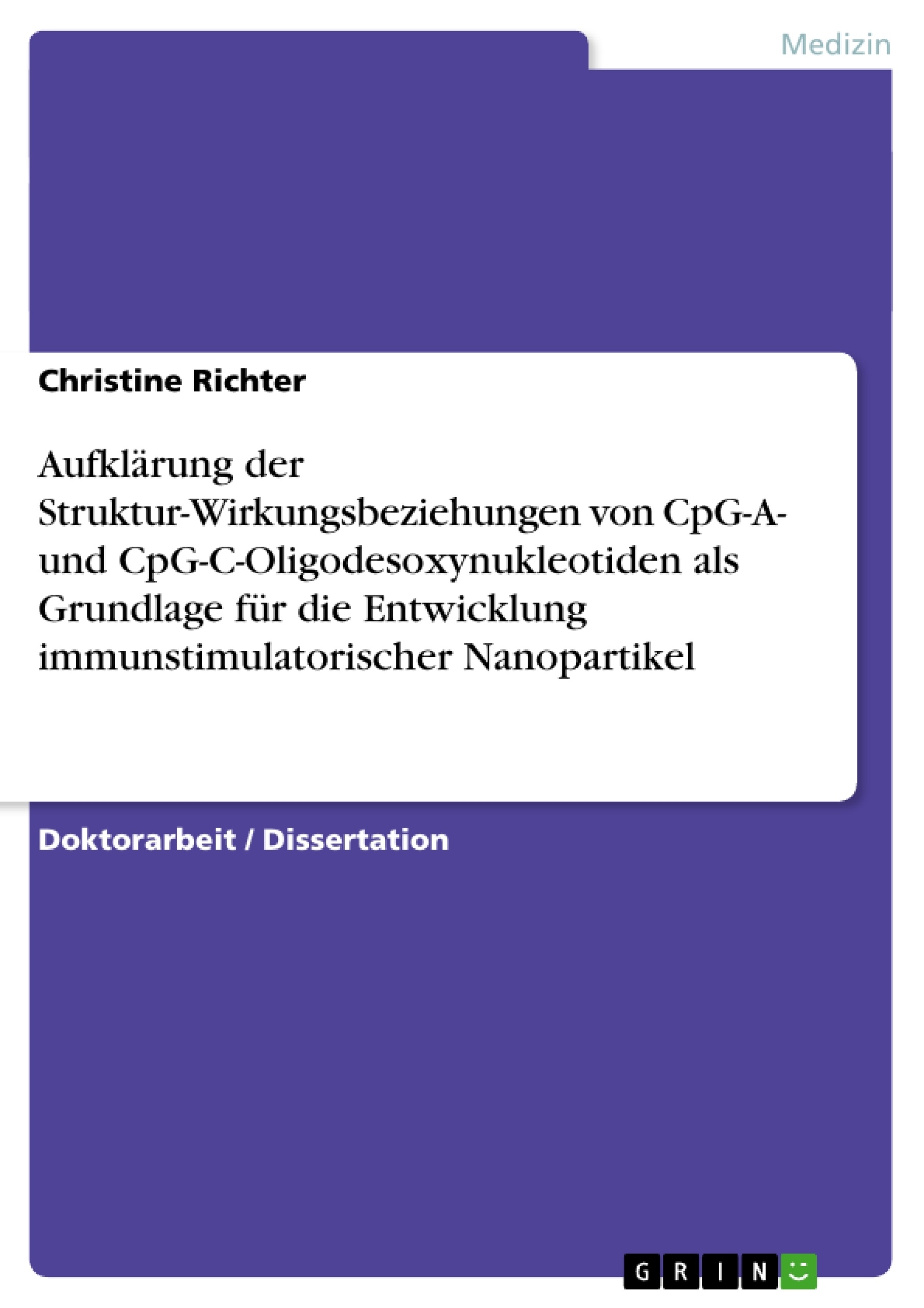Der erfolgreiche therapeutische Einsatz von CpG ODN hängt entscheidend davon ab, wie gut mit diesen eine virale Infektion imitiert und das Immunsystem gezielt in einen Alarmzustand versetzt werden kann. Während das jeweilige immunologische Aktivierungsprofil der drei CpG-Klassen A, B und C bereits weitgehend bekannt ist, sind die sequenzspezifischen und strukturellen Voraussetzungen für diese unterschiedlichen Wirkungen unzureichend verstanden. Eine experimentelle Einschränkung stellt die begrenzte Übertragbarkeit der Struktur-Analysen auf die tatsächlichen Vorgänge im physiologischen Milieu dar. Ohne Kenntnisse der für die differenziellen Wirkprofile maßgeblichen Faktoren kann darauf kein Einfluss genommen werden, um das Spektrum an Einsatzmöglichkeiten für CpG-ODN zu erweitern und zu optimieren. Die therapeutische Anwendung von CpG ODN wird außerdem bislang durch deren geringe Halbwertszeit in vivo eingeschränkt. Eine galenische Hilfe, die systemische Stabilität zu erhöhen, stellt die Bindung der ODN an partikuläre Trägersysteme dar – eine Methode, deren Effektivität in unserer Abteilung bereits gezeigt werden konnte. Eine Weiterentwicklung dieses Prinzips wären partikuläre Strukturen, die aus immunstimulatorischen Nukleinsäuren aufgebaut sind und keiner weiteren Trägermaterialien bedürfen.
Ziele der vorliegenden Arbeit sind:
1)Die systematische Aufklärung der sequenzspezifischen und strukturbestimmenden Eigenschaften der bereits bekannten CpG Klassen A und C, um die maßgeblichen Struktur-Wirkungsbeziehungen darzulegen. Dabei soll die Entwicklung geeigneter Methoden zur strukturellen Analyse im physiologischen Milieu im Vordergrund stehen.
2)Die Entwicklung Nukleinsäure-basierter, immunstimulatorischer Partikel unter Einsatz der in Teil 1 ermittelten wirksamen Strukturelemente beider CpG Klassen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- Das humane Immunsystem
- Die angeborene und die adaptive Immunität
- Toll-like Rezeptoren - Erkennungssysteme der angeborenen Immunität
- Typ-l Interferon - ein Effektor der angeborenen Immunität
- Dendritische Zellen - Mittler zwischen der angeborenen und der adaptiven Immunität
- B-Zellen - Effektorzellen der adaptiven Immunität
- CpG-Oligodesoxynukleotide
- Geschichtlicher Hintergrund: Von bakteriellen Lysaten zu synthetischer CpG-DNA
- Wirkung und Wirkmechanismen von CpG-DNA
- Definition von drei Klassen synthetischer CpG-ODN: CpG-A, CpG-B und CpG-C
- Therapeutischer Einsatz von CpG-Oligodesoxynukleotiden
- Ziele dieser Arbeit
- MATERIAL UND METHODEN
- Geräte, Chemikalien und Reagenzien
- Geräte
- Verbrauchsmaterialien
- Chemikalien
- Reagenziensätze
- Materialien für die Zellkultur
- Zytokine
- Zellkulturmedien, Puffer und Lösungen
- Medien und Puffer für die Zellkultur
- Puffer und Lösungen für die Gelelektrophorese
- Antikörper für die Durchflusszytometrische Analyse
- Oligodesoxynukleotide
- Zur Zellstimulation eingesetzte Sequenzen
- Zur Gelelektrophorese eingesetzte Sequenzen
- Temperatur-Präinkubation von ODN 2216
- Temperatur-Präinkubation von ODN M362
- Polyvalente Linker
- Polyvalente Linker - CpG-DNA
- Trivalente Linker - palindromische RNA
- Poly-L-Arginine als Transfektionsreagenzien
- Herstellung des , Master-Mixes' zur Transfektion
- Zellulär - immunologische Methoden
- Isolation der gewünschten Zellpopulation
- Mononukleäre Zellen des peripheren Blutes
- Plasmazytoide dendritische Zellen
- Gesamt B-Zellen (CD19+)
- Herstellung autologen Serums
- Zellkultur
- Durchflusszytometrie (FACS-Analyse)
- Grundprinzip der FACS-Analyse
- Durchflusszytometrische Bestimmung der Reinheit von plasmazytoiden dendritischen Zellen und B-Zellen
- Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- Zytokine
- Proliferation (BrdU-ELISA)
- Molekularbiologische Methoden
- Gelelektrophorese
- Prinzip der Gelelektrophorese
- Prinzip der Detektion von Digoxigenin-markierten Oligodesoxynukleotiden
- Prinzip der Detektion von DNA durch Ethidiumbromidfärbung
- Durchführung der Gelelektrophorese
- Blotting und Detektion Digoxigenin-markierter Oligodesoxynukleotide
- Färbung mit Ethidiumbromid
- Auswertung der Gelbilder
- Partikelgrößenbestimmung durch Zetapotenzialmessung
- Grundprinzip
- Durchführung der Messung
- Statistische Analyse
- Software
- ERGEBNISSE
- Untersuchung der Struktur-Wirkungsbeziehungen von CpG-A und CpG-C
- Untersuchung des Klasse A Oligodesoxynukleotids 2216
- CpG-A bildet Nanopartikel im Größenbereich von Viren
- Entwicklung der Temperatur-Präinkubationsmethode zur experimentellen Kontrolle der Multimerisierungen
- Strukturelle Analyse: CpG-A multimerisiert im physiologischen Milieu
- Identifizierung des zentralen Palindroms als notwendiges Element zum Aufbau größerer Partikel aus G-Tetraden
- Identifizierung der Natriumionen als wichtiges stabilisierendes Element zum Aufbau der G-Tetraden
- Große Partikel sind die Voraussetzung zur raschen Induktion hoher Mengen von Interferon-alpha in plasmazytoiden dendritischen Zellen
- Die Präinkubation von PDCs mit Interferon-beta verstärkt die Induktion von Interferon-alpha durch Einzelstränge
- B-Zellen werden von kleinen Partikeln und Einzelsträngen des ODN 2216 nicht aktiviert
- Strukturelle Analyse: Die Multimere öffnen ihre Bindungen bei < 37 °C
- Untersuchung des Klasse C Oligodesoxynukleotids M362
- Strukturelle Analyse bei 4 °C: Die Stabilität der Duplices hängt von den anwesenden Natrium- oder Magnesiumionen ab
- Strukturelle Analyse bei 37°C: Weder Duplices noch Hairpins sind im physiologischen Milieu stabil
- Übertragung der Ergebnisse der strukturellen Analyse auf den Zellversuch
- Design immunstimulatorischer Partikel unter Einsatz wirksamer Strukturelemente von CpG-A und CpG-C
- Polyvalente Linker - palindromische CpG-DNA
- Strukturelle Analyse
- Starke Induktion von Interferon-alpha in PBMCs nach Transfektion mit Poly-L-Arginin
- Screening verschieden langer Poly-L-Arginine als Transfektionsreagenzien
- Das humane Immunsystem und dessen Funktionsweise
- Die Rolle von CpG-Oligodesoxynukleotiden in der Immunantwort
- Strukturelle Eigenschaften von CpG-A und CpG-C und ihre Auswirkungen auf die Immunstimulation
- Die Entwicklung und Charakterisierung von immunstimulatorischen Nanopartikeln
- Therapeutische Anwendungsmöglichkeiten von CpG-basierten Nanopartikeln
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Dissertation befasst sich mit der Aufklärung der Struktur-Wirkungsbeziehungen von CpG-A- und CpG-C-Oligodesoxynukleotiden. Ziel ist es, die Erkenntnisse für die Entwicklung immunstimulatorischer Nanopartikel zu nutzen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das humane Immunsystem und die Rolle von CpG-Oligodesoxynukleotiden in der Immunantwort vor. Sie definiert zudem die drei Klassen synthetischer CpG-ODN: CpG-A, CpG-B und CpG-C. Abschließend werden die Ziele der Arbeit erläutert.
Kapitel 2 beschreibt die verwendeten Materialien und Methoden. Es werden die Geräte, Chemikalien, Reagenzien, Oligodesoxynukleotide, polyvalente Linker, zellulär-immunologischen und molekularbiologischen Methoden sowie die statistische Analyse erläutert.
Kapitel 3 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung der Struktur-Wirkungsbeziehungen von CpG-A und CpG-C. Es wird die Multimerisierung des Klasse A Oligodesoxynukleotids 2216 untersucht und die Bildung von Nanopartikeln im Größenbereich von Viren festgestellt. Darüber hinaus wird die Induktion von Interferon-alpha durch CpG-A in plasmazytoiden dendritischen Zellen analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass große Partikel von CpG-A die rasche Induktion von Interferon-alpha bewirken. Abschließend werden die strukturellen Eigenschaften des Klasse C Oligodesoxynukleotids M362 untersucht und die Ergebnisse in den Kontext der Zellversuche gesetzt.
Kapitel 4 behandelt die Entwicklung immunstimulatorischer Partikel unter Einsatz wirksamer Strukturelemente von CpG-A und CpG-C. Es werden polyvalente Linker - palindromische CpG-DNA - verwendet, um Nanopartikel zu konstruieren, die eine starke Induktion von Interferon-alpha in PBMCs nach Transfektion mit Poly-L-Arginin bewirken.
Schlüsselwörter
CpG-Oligodesoxynukleotide, Immunstimulation, Nanopartikel, Interferon-alpha, plasmazytoide dendritische Zellen, B-Zellen, Struktur-Wirkungsbeziehung, G-Tetraden, Palindrome, Poly-L-Arginine, Transfektion.
- Quote paper
- Dr. Christine Richter (Author), 2006, Aufklärung der Struktur-Wirkungsbeziehungen von CpG-A- und CpG-C-Oligodesoxynukleotiden als Grundlage für die Entwicklung immunstimulatorischer Nanopartikel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82264