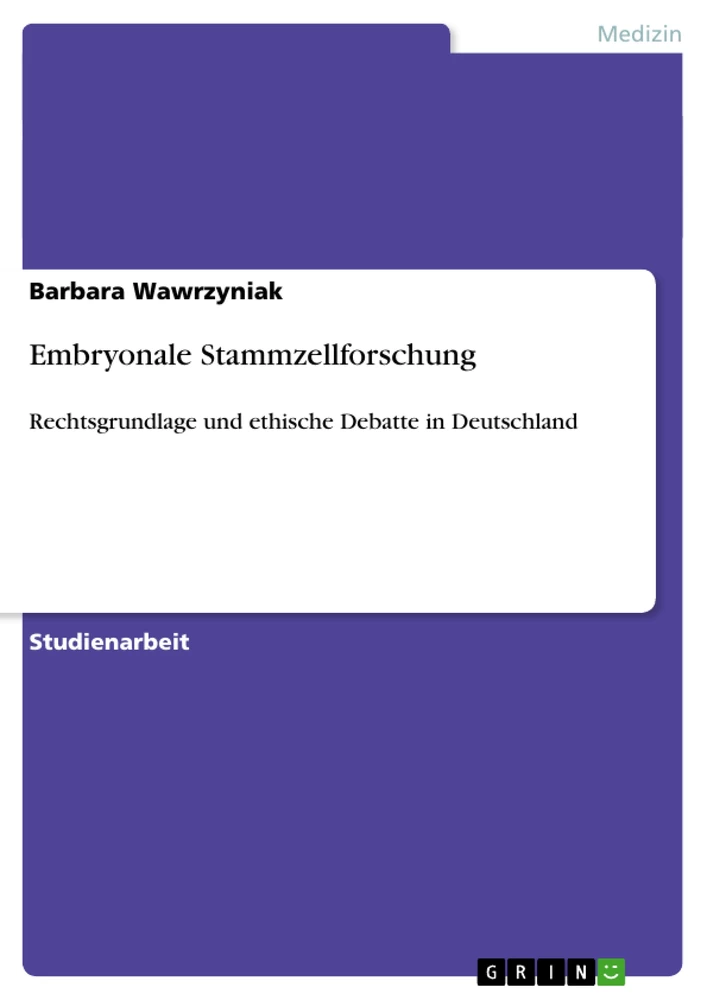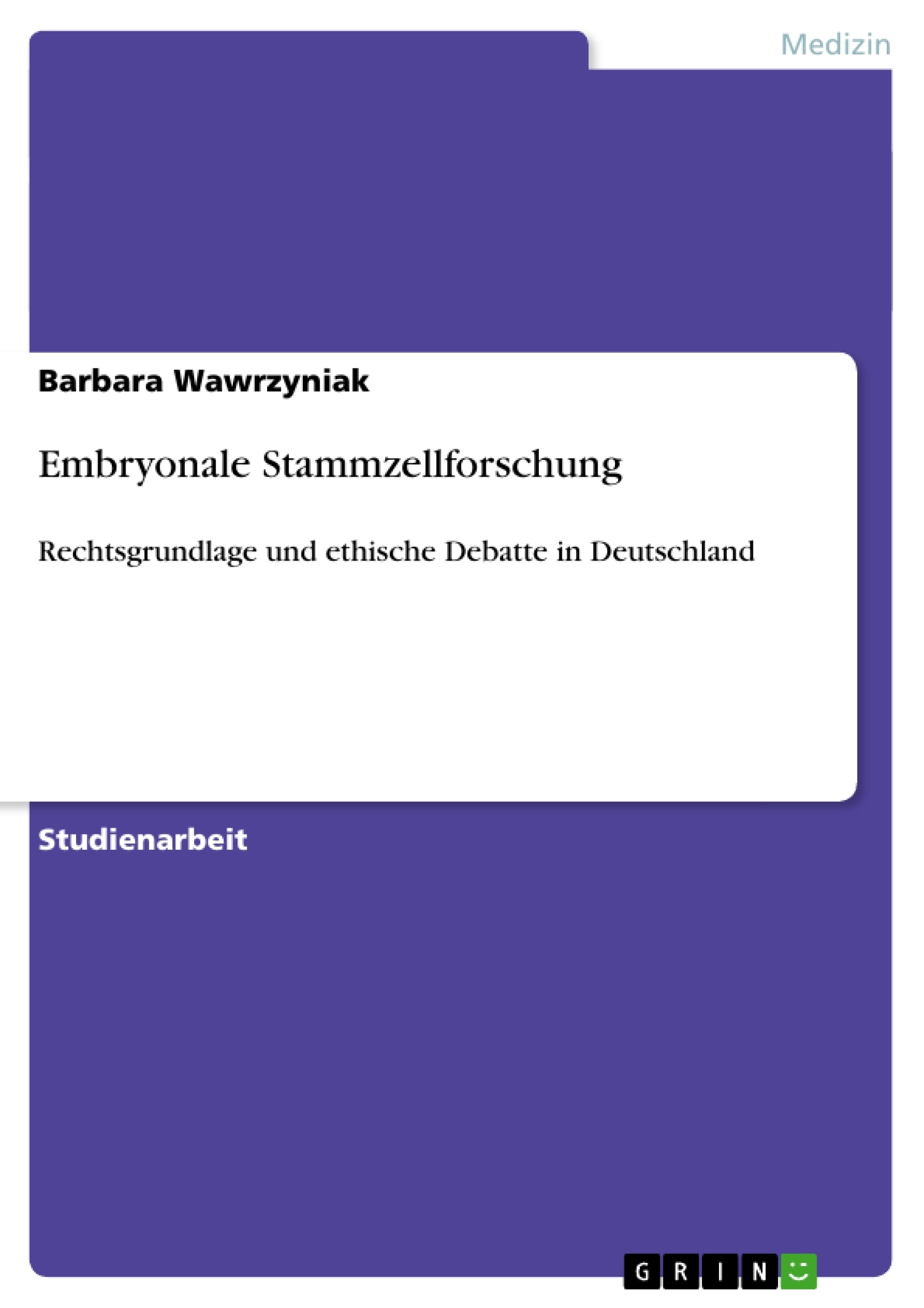Embryonale Stammzellforschung ist ein umstrittenes und heiß diskutiertes Thema. Ob auf dem politischen Parkett oder im philosophischen Kontext, einen Konsens mit allen argumentierenden Parteien zu finden scheint unmöglich zu sein. Zu sehr gehen die Meinungen über den moralischen Status des Embryos auseinander: Würde und damit Lebensschutz oder Forschungsgegenstand und damit neue Heilungschancen? Erst kürzlich erlangte das Thema wieder Brisanz als Präsident George W. Bush sein Veto gegen ein neues Gesetz zur Stammzellforschung, die mit Bundesmitteln vorangetrieben werden sollte, einlegte. Während sich der amerikanische Präsident den heilvollen Versprechen der embryonalen Stammzellforschung entzieht, sichert das Europäische Parlament dieser Forschungsrichtung 50 Millionen Euro zu. Gespalten sind die Reaktionen in Deutschland, wo die embryonale Stammzellforschung verboten ist.
Wie genau die rechtliche Lage des Embryos hierzulande aussieht, ist Teil dieser Hausarbeit. Ein kurzer Vergleich über die rechtliche Lage in anderen Ländern, soll Aufschluss darüber geben, wie andere Nationen mit diesem heiklen Thema umgehen. Darüber hinaus soll ein kurzer Einblick in die medizinischen Vorteile gegeben werden, die sich gegenüber den adulten Stammzellen ergeben und welche Heilungschancen damit in Verbindung stehen könnten. Im Anschluss wird auf die bioethische Debatte in Deutschland eingegangen, die für die Rechtssetzung eine relevante Rolle spielt. Begriffe wie Würde, Person und Lebensrecht sind nur einige Schlagwörter, die diesen bioethischen Diskurs bestimmen. Insbesondere die SKIP-Argumente, die für einen Schutz des Embryos stehen, sollen hier näher erläutert werden. Allerdings ist es nicht möglich einen gesamten und uneingeschränkten Überblick über die Diskussion der embryonalen Stammzellforschung zu geben, da dieses Vorhaben das Maß einer Hausarbeit weit überschreiten würde.
Eine gute Grundlage für die ethische Auseinandersetzung mit dem moralischen Status menschlicher Embryonen bietet der Sammelband von DAMSCHEN und SCHÖNECKER (2002). Mit einer ausführlichen Darstellung der Hauptargumente in dieser Debatte, bietet der Band einen übersichtlichen Einstieg in diese Thematik. Ebenso empfehlenswert ist MERKELs (2002a) Arbeit zu dieser Materie, die nicht nur in die ethische Diskussion einführt, sondern auch ausführlich auf rechtliche Belange eingeht. Darüber hinaus bietet das Internet zahlreiche Möglichkeiten sich über Kommissionen und aktuelle Standpunkte zu informieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rechtlicher Status des Embryos
- Vom Embryonenschutzgesetz zum Stammzellgesetz
- Der Embryo im Ausland - Ein Überblick
- Gremien und Kommissionen
- Enquete-Kommission,,Recht und Ethik der modernen Medizin“
- Nationaler Ethikrat
- Zentrale Kommission zur Wahrung ethischer Grundsätze in der Medizin und ihren Grenzgebieten (Zentrale Ethikkommission)
- Embryonale Stammzellforschung aus medizinischer Perspektive
- Adulte Stammzellen contra embryonale Stammzellen
- Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
- Der moralische Status menschlicher Embryonen
- Der Personenbegriff
- Pro und Contra der SKIP-Argumente
- Das Speziesargument
- Pro:
- Contra:
- Das Kontinuumsargument
- Pro:
- Contra:
- Das Identitätsargument
- Pro:
- Contra:
- Das Potentialitätsargument
- Pro:
- Contra:
- Das Speziesargument
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem umstrittenen Thema der embryonalen Stammzellforschung in Deutschland. Sie untersucht die rechtliche Lage des Embryos und die ethische Debatte, die diese Forschung begleitet. Ziel ist es, einen Einblick in die verschiedenen Argumentationslinien und die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen zu geben.
- Rechtlicher Status des Embryos in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern
- Ethische Debatte um den moralischen Status des Embryos
- Medizinische Vorteile und Heilungspotenzial embryonaler Stammzellen
- Rolle von Ethikkommissionen und ihre Bedeutung in der Entscheidungsfindung
- Analyse der SKIP-Argumente und ihrer Bedeutung im Kontext des Embryonenschutzes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der embryonalen Stammzellforschung ein und erläutert die Relevanz der ethischen und rechtlichen Diskussion. Das zweite Kapitel analysiert den rechtlichen Status des Embryos in Deutschland, beginnend mit dem Embryonenschutzgesetz und dem Stammzellgesetz. Es beleuchtet auch die Rechtslage in anderen Ländern, um einen internationalen Vergleich zu ermöglichen.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den relevanten Gremien und Kommissionen, die sich mit Fragen der ethischen und rechtlichen Aspekte der Stammzellforschung beschäftigen. Dazu gehören die Enquete-Kommission, der Nationale Ethikrat und die Zentrale Ethikkommission.
Kapitel vier beleuchtet die embryonale Stammzellforschung aus medizinischer Perspektive. Es stellt die Unterschiede zwischen adulten und embryonalen Stammzellen dar und erläutert die potentiellen Heilungschancen, die mit embryonalen Stammzellen verbunden sind.
Kapitel fünf untersucht den moralischen Status menschlicher Embryonen. Es analysiert den Personenbegriff und die verschiedenen Argumente für und gegen den Schutz des Embryos, wie z.B. das Spezies-, Kontinuums-, Identitäts- und Potentialitätsargument.
Schlüsselwörter
Embryonale Stammzellforschung, Embryonenschutzgesetz, Stammzellgesetz, ethische Debatte, moralischer Status des Embryos, Personenbegriff, SKIP-Argumente, medizinische Vorteile, Heilungspotenzial, Ethikkommissionen.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Barbara Wawrzyniak (Author), 2006, Embryonale Stammzellforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82082