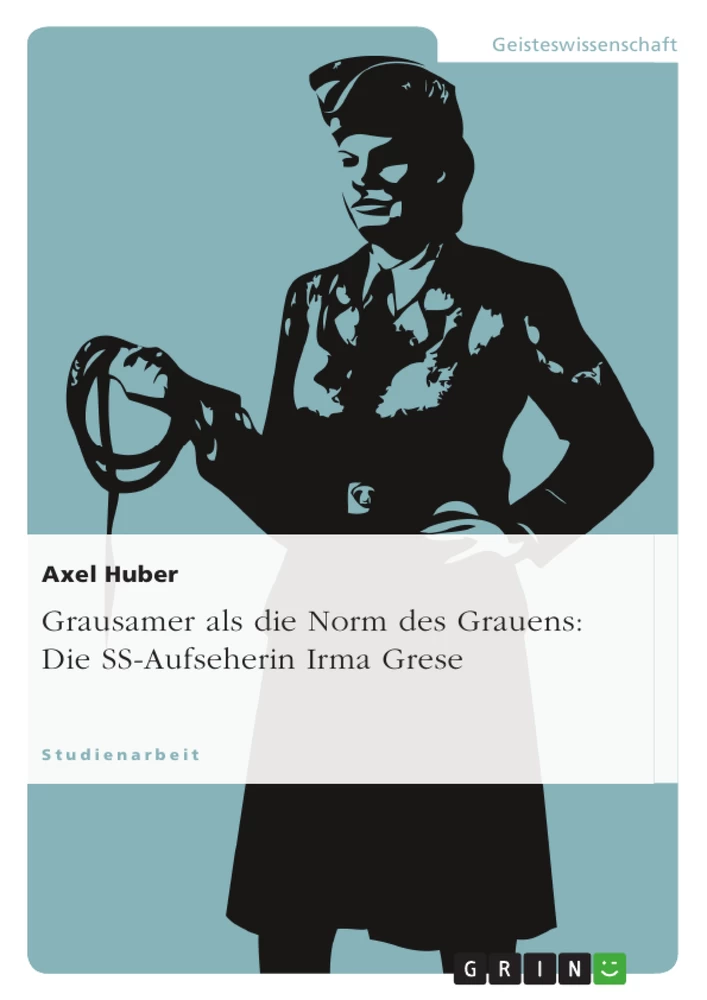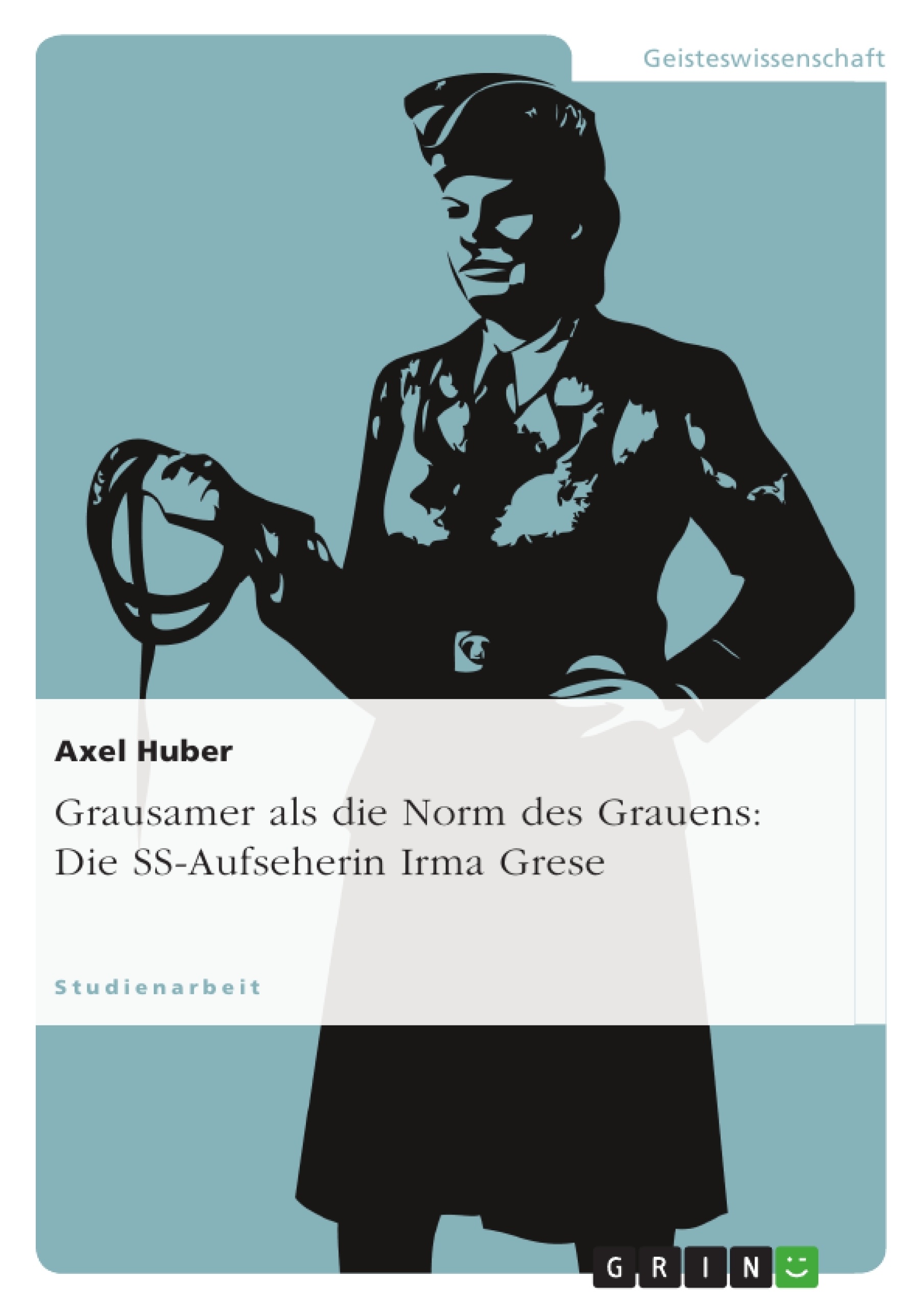„Schnell“ lautete das letzte Wort von Irma Grese. Sie sagte es am 13. Dezember 1945 um 10.03 Uhr in Anwesenheit ihres Henkers Albert Pierrepoint, der ihr in diesem Moment den Strick um den Hals legte. Sekunden später öffnete sich die Klappe und der Körper der 22-Jährigen baumelte leblos am Galgen. 20 Minuten später nahmen der britischer Berufshenker und seine Helfer den Leichnam ab und legten ihn in einen der vorbereiteten Särge. An diesem Tag starben weitere zwölf verurteilte NS-Verbrecher.
Ort dieses Schauspiels des Todes war das Zuchthaus von Hameln. Der Stadt, die bis in die Gegenwart hinein bekannt ist als Opfer eines Rattenfängers, der die Kinder der Bürger mit seinem lieblichen Musikspiel für immer entführte, als er für seine Dienste nicht bezahlt worden war. Stellte Irma Grese letztlich auch das Opfer eines Rattenfängers in Form das nach Ende des Zweiten Weltkriegs oft dämonisierten Adolf Hitlers dar? Die junge Frau war noch nicht einmal 20, als sie kurz nach ihrer Ausbildung zur SS-Aufseherin nach Auschwitz versetzt wurde. Mit 20 Jahren gaben ihr die Umstände Verfügungsgewalt über bis zu 30000 Frauen im Frauenlager von Auschwitz. Überlebende berichteten in der Gerichtsverhandlung 1945 als Zeugen und bis heute in Büchern von kaum vorstellbaren Grausamkeiten.
In einem Kommentar der Lüneburger Post vom 14. September 1945 stellte der Autor die Frage, „wieso eine hübsche Frau mit ebenmäßigen Zügen in die Gesellschaft Kramers [ihr direkter Vorgesetzter in Auschwitz-Birkenau und in Belsen, d.V.] kommt und als Hüterin eines Abgrundes auftreten konnte, dessen Enthüllung die ganze Welt entsetzte“. Faszination Gewalt? Zwang? Oder doch Verführung? Wo liegen die Ursachen?
Schon 1945 verkehrten die Täter die Realität ins Gegenteil und schufen einen Mythos des Opfertums: „Der bereits von der Verteidigung in Nürnberg behauptete Befehlsnotstand als juristische und zunehmend auch populäre Rechtfertigungsfigur verbreitete die Vorstellung, daß dem Terror nach außen ein Terror nach innen entsprochen habe, ein Zwang zum Mitmachen und eine stete Bedrohung an Leib und Leben im Falle der Verweigerung.“ Im gleichen Jahr erschien das Buch Der SS-Staat von Eugen Kogon, der eine erste Typisierung der SS-Angehörigen vornahm und welche „die kollektive Wahrnehmung prägte: das der sozial deklassierten und unter Minderwertigkeitskomplexen leidenden Männer, die eigentlich mit der deutschen Gesellschaft nichts zu tun hatten“.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Irma Grese – Ein kurzes Leben
- 2.1. Realitäten
- 2.2. Mythos
- 3. Die Konstruktion von Sinn im Handeln von Irma Grese
- 3.1. Die Entmenschlichung des Anderen
- 3.2. Gehorsam
- 3.3. Gestaltungen
- 3.4. Sex
- 3.5. Die Entscheidung zum Töten
- 4. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das abweichende Handeln der SS-Aufseherin Irma Grese und versucht, die Sinnzuschreibungen hinter ihren Taten zu rekonstruieren. Im Fokus steht die Frage, ob und wie sich gängige Erklärungsmuster für männliche NS-Täter auf das Handeln einer Frau übertragen lassen. Die Arbeit berücksichtigt dabei sowohl die biographischen Realitäten als auch den Mythos, der sich um Grese gebildet hat.
- Die Konstruktion von Sinn im abweichenden Handeln
- Die Rolle von Entmenschlichung und Gehorsam
- Der Einfluss von Geschlecht auf die Ausübung von Gewalt
- Die Biographischen Hintergründe von Irma Grese
- Die Konstruktion eines Mythos um Irma Grese
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor, indem sie den Tod Irmas Grese beschreibt und die Frage nach den Ursachen ihres grausamen Handelns aufwirft. Sie verweist auf bestehende Forschungsliteratur zu männlichen NS-Tätern und stellt die Frage, inwieweit diese Erklärungsmuster auch auf das Handeln einer Frau wie Irma Grese angewendet werden können. Die Arbeit zielt darauf ab, die Sinnzuschreibungen hinter Grese's Taten zu untersuchen und eine differenzierte Analyse ihres abweichenden Verhaltens zu liefern.
2. Irma Grese – Ein kurzes Leben: Dieses Kapitel beschreibt die Lebensgeschichte Irmas Grese, beginnend mit ihrer Kindheit in Mecklenburg bis hin zu ihrer Tätigkeit als SS-Aufseherin. Es differenziert zwischen den biographischen Realitäten, die ein relativ unauffälliges Aufwachsen in bescheidenen Verhältnissen zeigen, und dem Mythos, der sich um sie gebildet hat. Die Quellenlage wird als lückenhaft dargestellt, die Ausführungen basieren auf wenigen schriftlichen Quellen und vielen Zeugenaussagen und Erinnerungen, die im Kontext der Geschichtsforschung kritisch bewertet werden müssen. Der Fokus liegt auf dem Kontrast zwischen dem scheinbar normalen Leben und dem extremen Handeln im Kontext des Holocaust.
Schlüsselwörter
Irma Grese, SS-Aufseherin, Auschwitz, abweichendes Handeln, Sinnkonstruktion, Entmenschlichung, Gehorsam, Geschlecht, Gewalt, Holocaust, NS-Verbrechen, Mythos, Biographie, Täterforschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Irma Grese – Eine Analyse ihres abweichenden Handelns
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht das abweichende Handeln der SS-Aufseherin Irma Grese und versucht, die Beweggründe und Sinnzuschreibungen hinter ihren Taten zu rekonstruieren. Ein besonderer Fokus liegt auf der Übertragbarkeit gängiger Erklärungsmuster für männliche NS-Täter auf das Handeln einer Frau.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Konstruktion von Sinn im abweichenden Handeln, die Rolle von Entmenschlichung und Gehorsam, den Einfluss des Geschlechts auf die Ausübung von Gewalt, die biographischen Hintergründe Irmas Grese und die Konstruktion eines Mythos um ihre Person. Sie betrachtet sowohl die biographischen Realitäten als auch den Mythos, der sich um Irma Grese gebildet hat.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über das Leben Irmas Grese (unterteilt in Realitäten und Mythos), ein Kapitel über die Sinnkonstruktion in ihrem Handeln (mit Unterkapiteln zu Entmenschlichung, Gehorsam, Gestaltung, Sex und der Entscheidung zum Töten) und eine Schlussbetrachtung. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer Kombination aus schriftlichen Quellen und Zeugenaussagen und Erinnerungen. Die Quellenlage wird als lückenhaft beschrieben, und die Ausführungen werden im Kontext der Geschichtsforschung kritisch bewertet.
Welche zentralen Fragen werden gestellt?
Die zentrale Frage der Arbeit ist, ob und wie sich gängige Erklärungsmuster für männliche NS-Täter auf das Handeln einer Frau wie Irma Grese übertragen lassen. Weiterhin wird untersucht, welche Sinnzuschreibungen hinter Grese's Taten standen und wie ihr abweichendes Verhalten differenziert analysiert werden kann.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Irma Grese, SS-Aufseherin, Auschwitz, abweichendes Handeln, Sinnkonstruktion, Entmenschlichung, Gehorsam, Geschlecht, Gewalt, Holocaust, NS-Verbrechen, Mythos, Biographie, Täterforschung.
Was ist das Fazit der Arbeit (in Kürze)?
Die Arbeit zielt darauf ab, eine differenzierte Analyse des abweichenden Verhaltens Irmas Grese zu liefern, indem sie sowohl biographische Fakten als auch den um sie gebildeten Mythos berücksichtigt und die Frage nach den Beweggründen ihres Handelns im Kontext der NS-Zeit untersucht.
- Quote paper
- BA Axel Huber (Author), 2006, Grausamer als die Norm des Grauens: Die SS-Aufseherin Irma Grese, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82070