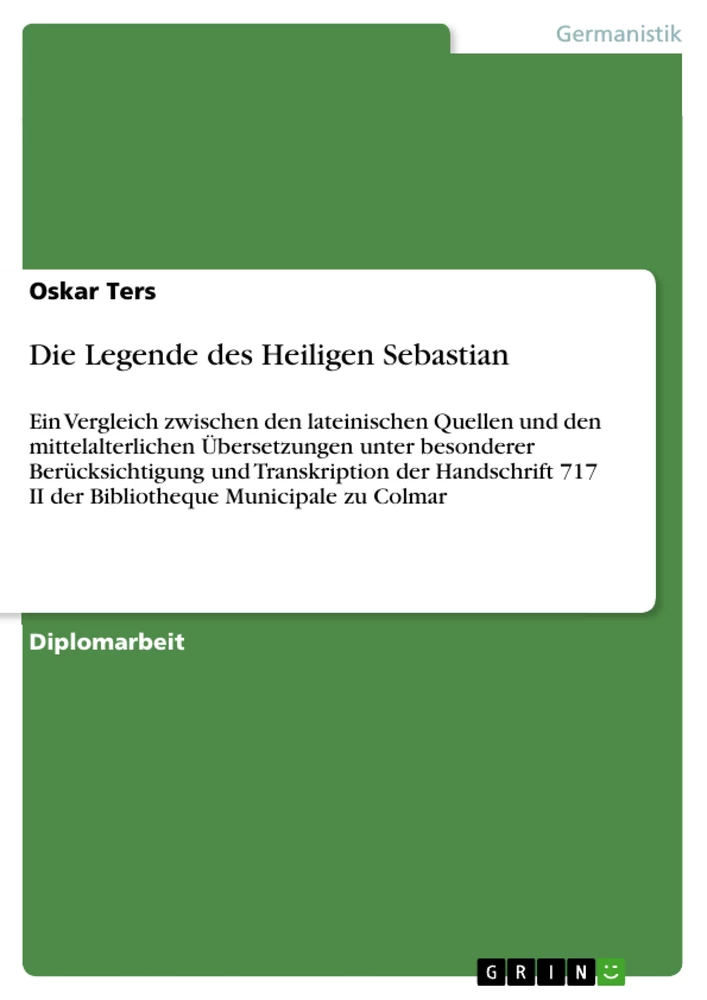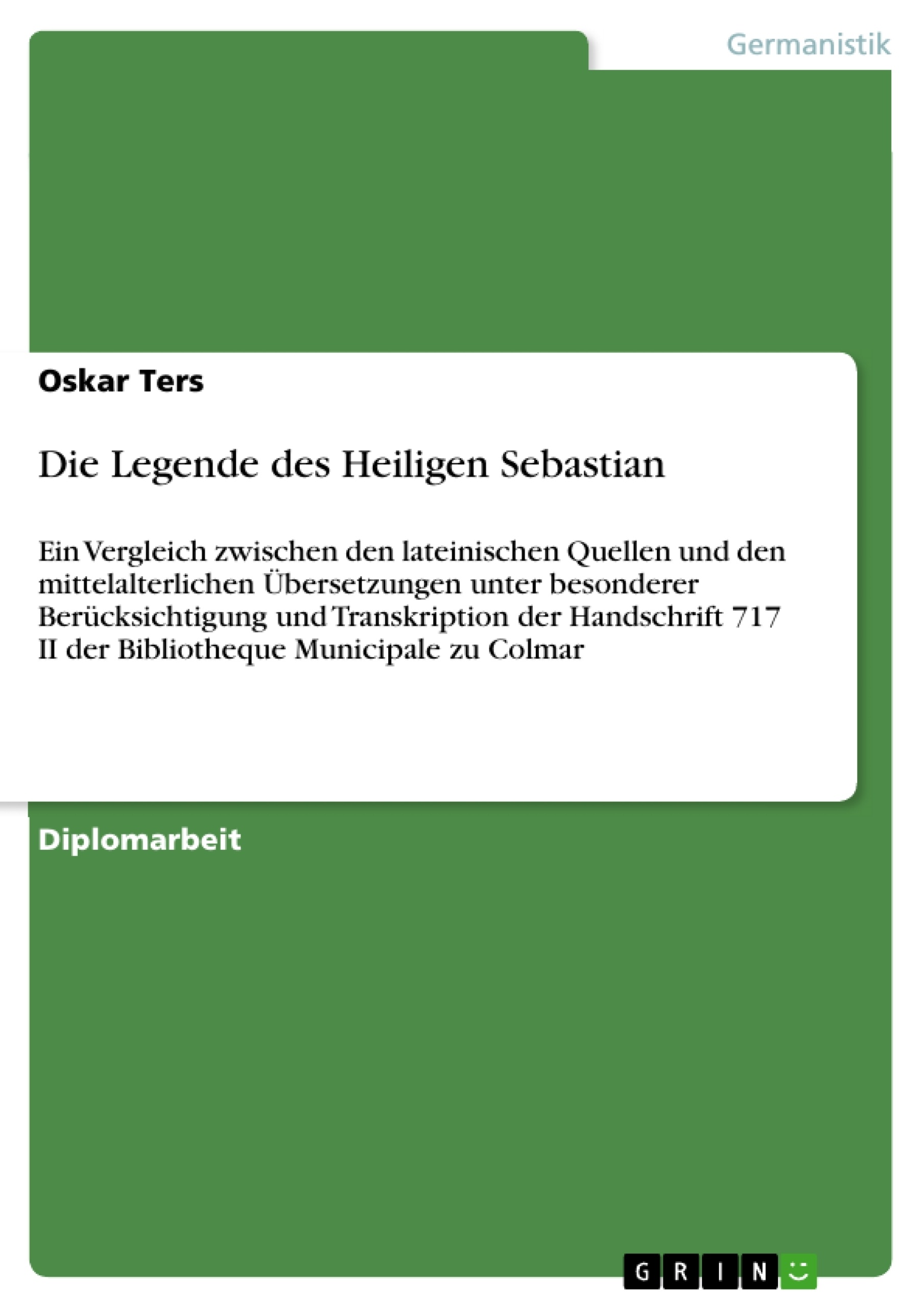Die Arbeit bietet die erstmalige vollständige Transkripierung und kritische Bearbeitung der Legende des Heiligen Sebastian, aufgeschrieben von Dorothea von Kippenheim 1425 in Colmar. Außerdem wird in der Arbeit ein allgemeiner Überblick über christliche Heiligenlegenden, besonders Märtyrerlegenden, sowie eine Beschäftigung mit der Legendentheorie im Allgemeinen abgehandelt.
Die Person des Heiligen Sebastian wird in der Geschichte zum ersten Mal in dem Schriftstück erwähnt, das seit Theodor Mommsen den Titel ,,Chronograph vom Jahre 354" trägt. Dass Sebastian ein Heiliger ist, der bis heute nichts an seinem Bekanntheitsgrad verloren hat, liegt jedoch weniger an den literarischen Aufzeichnungen als vielmehr an seiner kunstgeschichtlichen Rezeption.
Ab dem Ende der Frührenaissance finden sich vermehrt Bilder, die Sebastian als nackten Jüngling darstellen, der, an einen Baum gefesselt und von Pfeilen durchbohrt, teilnahmslos in den Himmel blickt. Im Barock erlebte die bildnerische Darstellung dann ihre Hochblüte und ist auch in den folgenden Jahrhunderten nicht verebbt. Im 20. Jahrhundert avancierte Sebastian beginnend mit dem Fin de Siècle zum inoffiziellen Heiligen der Homosexuellen, besonders der schwulen Männer.
Die längste Übersetzung einer lateinischen Quelle der Sebastianlegende ist die Handschrift 717II der Bibliotheque Municipale in Colmar, die von der Nonne Dorothea von Kippenheim zu Beginn des 15. Jahrhunderts geschrieben wurde. Die vorliegende Arbeit soll vor allem eine abgedruckte Form der in dieser Handschrift enthaltenen Sebastianlegende liefern und gleichzeitig einen Interpretationsvorschlag für die unterschiedlichen Abweichungen zum lateinischen Original bieten.
Als lateinischer Urtext wurde die Legende der Acta Sanctorum (AS) verwendet, da die Originallegende des Arnobius als verschollen gilt. Die Untersuchungen befassen sich vor allem mit den inhaltlichen Aspekten der Legende, und es wurde weniger auf die Übersetzungstechnik geachtet, da dies in das Fachgebiet eines Altphilologen gehören würde. Demnach ist die Arbeit in drei Schwerpunkte aufgegliedert; ein Vergleich der mittelalterlichen Legendare mit dem lateinischen Original, eine Interpretation des Inhaltes, der Übersetzung und der Gliederung der Handschrift 717II und schließlich die Transkription derselben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zum Begriff Legende
- 2.1. Die Entstehung des Begriffs Legende
- 2.2. Sprachliche Verbreitung und Unterschiede
- 2.3. Verschiedene Legendentheorien
- 2.3.1. Legendentheorien am Ausgang des 19. Jahrhunderts
- 2.3.2. Legendentheorien zu Beginn des 20. Jahrhunderts
- 2.3.3. Legendentheorien ab 1945
- 3. Der inhaltliche Aufbau der Legende
- 3.1. Teil 1: Beginn bis Taufe im Haus des Nicostratus
- 3.1.1. Personen des ersten Teiles
- 3.1.2. Unterschiede zwischen den Acta und den mittelalterlichen Legendaren
- 3.2. Teil 2 Die Götzenzerstörung im Hause Chromatius
- 3.2.1. Personen des zweiten Teiles
- 3.2.2. Unterschiede zwischen den Acta und den mittelalterlichen Legendaren
- 3.2.2.1. Der Dialog zwischen Römern und Christen
- 3.2.2.2. Beschreibung der Kammer zur Vorhersagung der Zukunft
- 3.2.2.3. Die Flucht der Christen aus Rom
- Teil 3 Das Martyrium der Christen
- 3.3.1. Personen des dritten Teiles
- 3.3.2. Unterschiede zwischen den Acta und den mittelalterlichen Legendaren
- 3.4. Zusammenfassung
- 4. Die Handschrift 717 der Bibliothèque Municipale, Colmar
- 4.1. Unterschiede zwischen Acta Sanctorum und Handschrift 717
- 4.1.1. Auslassungen der Sebastianlegende verglichen mit der Acta Sanctorum
- 4.1.1.1. Auslassungen im ersten Teil der Legende
- 4.1.1.2. Auslassungen im zweiten Teil der Legende
- 4.1.1.3. Auslassungen im dritten Teil der Legende
- 4.1.1.4. Zusammenfassung der Auslassungen innerhalb der Legende
- 4.1.2. Die inhaltlichen Zusätze und Abänderungen im Sebastiantext der Handschrift 717
- 4.1.2.1. Gliederung des Textes im ersten Teil der Legende
- 4.1.2.2. Gliederung des Textes im zweiten Teil der Legende
- 4.1.2.3. Gliederung des Textes im Zwischenkapitel der Legende
- 4.1.2.4. Gliederung des Textes im dritten Teil der Legende
- 4.1.2.5. Zusammenfassender Blick auf die Gliederung des Textes der Handschrift 717
- 5. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit verfolgt das Ziel, die Legende des Heiligen Sebastian anhand eines Vergleichs lateinischer Quellen und mittelalterlicher Übersetzungen zu untersuchen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Handschrift 717 der Bibliothèque Municipale in Colmar, inklusive Transkription. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des Legendenbegriffs, analysiert den inhaltlichen Aufbau der Legende und untersucht Unterschiede zwischen den verschiedenen Versionen.
- Entwicklung des Legendenbegriffs im historischen Kontext
- Inhaltliche Analyse der Sebastian-Legende und ihrer verschiedenen Fassungen
- Vergleich der lateinischen Quellen mit mittelalterlichen Übersetzungen
- Detaillierte Untersuchung der Handschrift 717 aus Colmar
- Identifizierung von Auslassungen, Zusätzen und Abänderungen in den verschiedenen Versionen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die historische Figur des Heiligen Sebastian vor, basierend auf dem "Chronograph vom Jahre 354". Sie diskutiert die Schwierigkeit, die historische Authentizität von Heiligen zu belegen und referenziert die Klassifizierung von Hippolyte Delehaye, der Heilige in authentisch historische, historisch unsichere und fiktive Figuren unterteilt. Die Einleitung betont die Bedeutung von Sebastians kunstgeschichtlicher Rezeption, besonders im Zusammenhang mit Pestepidemien und der Darstellung Sebastians als nackten Märtyrer in der Renaissance und dem Barock.
2. Zum Begriff Legende: Dieses Kapitel untersucht den Begriff "Legende" selbst. Es beleuchtet die Entstehung des Begriffs, seine sprachliche Verbreitung und Unterschiede in der Verwendung. Ein wichtiger Teil des Kapitels befasst sich mit verschiedenen Legendentheorien, die über die Zeit hinweg entwickelt wurden, gegliedert nach verschiedenen Epochen (Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts und ab 1945).
3. Der inhaltliche Aufbau der Legende: Dieses Kapitel analysiert den inhaltlichen Aufbau der Sebastian-Legende, unterteilt in drei Teile: den Beginn bis zur Taufe, die Götzenzerstörung und das Martyrium. Es vergleicht die Handlungselemente und die Figuren in den verschiedenen Versionen (Acta und mittelalterliche Legenden) und hebt die Unterschiede hervor. Die Analyse beinhaltet detaillierte Beschreibungen der jeweiligen Szenen und deren Interpretation.
4. Die Handschrift 717 der Bibliothèque Municipale, Colmar: Dieses Kapitel konzentriert sich auf eine spezifische Handschrift der Sebastian-Legende. Es vergleicht diese Handschrift mit der Acta Sanctorum und analysiert Auslassungen, Zusätze und Abänderungen im Text. Die Analyse ist detailliert gegliedert nach den drei Teilen der Legende und bietet eine umfassende Beschreibung der Unterschiede und Besonderheiten der Handschrift 717.
Schlüsselwörter
Heiliger Sebastian, Legende, lateinische Quellen, mittelalterliche Übersetzungen, Handschrift 717, Bibliothèque Municipale Colmar, Legendentheorien, Acta Sanctorum, vergleichende Textanalyse, kunstgeschichtliche Rezeption, Märtyrer.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Die Legende des Heiligen Sebastian
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Legende des Heiligen Sebastian anhand eines detaillierten Vergleichs lateinischer Quellen und mittelalterlicher Übersetzungen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Handschrift 717 der Bibliothèque Municipale in Colmar, inklusive Transkription.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entwicklung des Legendenbegriffs im historischen Kontext zu beleuchten, den inhaltlichen Aufbau der Sebastian-Legende und ihrer verschiedenen Fassungen zu analysieren, lateinische Quellen mit mittelalterlichen Übersetzungen zu vergleichen und die Handschrift 717 aus Colmar detailliert zu untersuchen. Dabei werden Auslassungen, Zusätze und Abänderungen in den verschiedenen Versionen identifiziert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Zum Begriff Legende (inkl. verschiedener Legendentheorien), Der inhaltliche Aufbau der Legende (mit Unterteilung in drei Teile), Die Handschrift 717 der Bibliothèque Municipale, Colmar (inkl. Vergleich mit Acta Sanctorum und detaillierter Analyse von Auslassungen und Zusätzen) und Schlussbemerkung. Jedes Kapitel beinhaltet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Thematik.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf dem Vergleich lateinischer Quellen (u.a. Acta Sanctorum) und mittelalterlicher Übersetzungen der Sebastian-Legende. Der Hauptfokus liegt auf der Handschrift 717 der Bibliothèque Municipale in Colmar.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Die zentralen Themen sind die Entwicklung des Legendenbegriffs, die inhaltliche Analyse der Sebastian-Legende in ihren verschiedenen Versionen, der Vergleich zwischen lateinischen Quellen und mittelalterlichen Übersetzungen, die detaillierte Untersuchung der Handschrift 717 und die Identifizierung von Auslassungen, Zusätzen und Abänderungen im Text.
Welche Aspekte der Legende werden im Detail untersucht?
Die Arbeit analysiert den inhaltlichen Aufbau der Legende, unterteilt in drei Teile: den Beginn bis zur Taufe, die Götzenzerstörung und das Martyrium. Es werden die Handlungselemente und Figuren in den verschiedenen Versionen verglichen und Unterschiede hervorgehoben. Die Analyse beinhaltet detaillierte Beschreibungen der jeweiligen Szenen und deren Interpretation.
Wie wird die Handschrift 717 untersucht?
Die Handschrift 717 wird im Vergleich zur Acta Sanctorum untersucht. Die Analyse konzentriert sich auf Auslassungen, Zusätze und Abänderungen im Text, detailliert gegliedert nach den drei Teilen der Legende. Die Arbeit bietet eine umfassende Beschreibung der Unterschiede und Besonderheiten dieser Handschrift.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Heiliger Sebastian, Legende, lateinische Quellen, mittelalterliche Übersetzungen, Handschrift 717, Bibliothèque Municipale Colmar, Legendentheorien, Acta Sanctorum, vergleichende Textanalyse, kunstgeschichtliche Rezeption, Märtyrer.
Welche Bedeutung hat die kunstgeschichtliche Rezeption des Heiligen Sebastian?
Die Einleitung der Arbeit betont die Bedeutung von Sebastians kunstgeschichtlicher Rezeption, insbesondere im Zusammenhang mit Pestepidemien und der Darstellung Sebastians als nackten Märtyrers in der Renaissance und dem Barock.
Wie wird die historische Authentizität des Heiligen Sebastian behandelt?
Die Einleitung diskutiert die Schwierigkeit, die historische Authentizität von Heiligen zu belegen und referenziert die Klassifizierung von Hippolyte Delehaye, der Heilige in authentisch historische, historisch unsichere und fiktive Figuren unterteilt.
- Quote paper
- Mag. Oskar Ters (Author), 2000, Die Legende des Heiligen Sebastian, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81