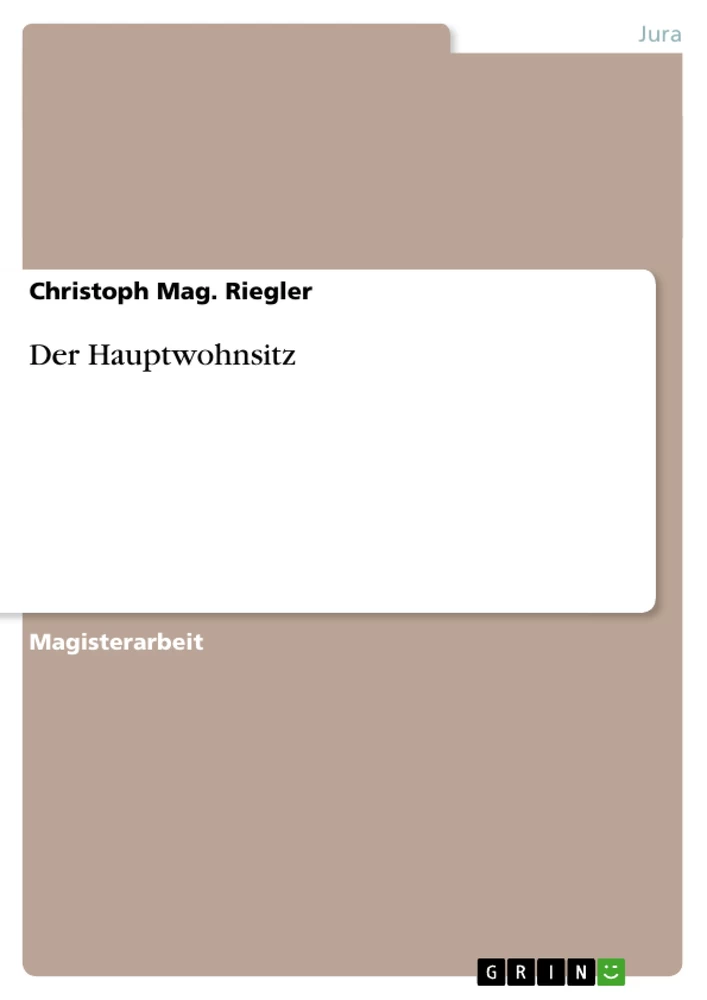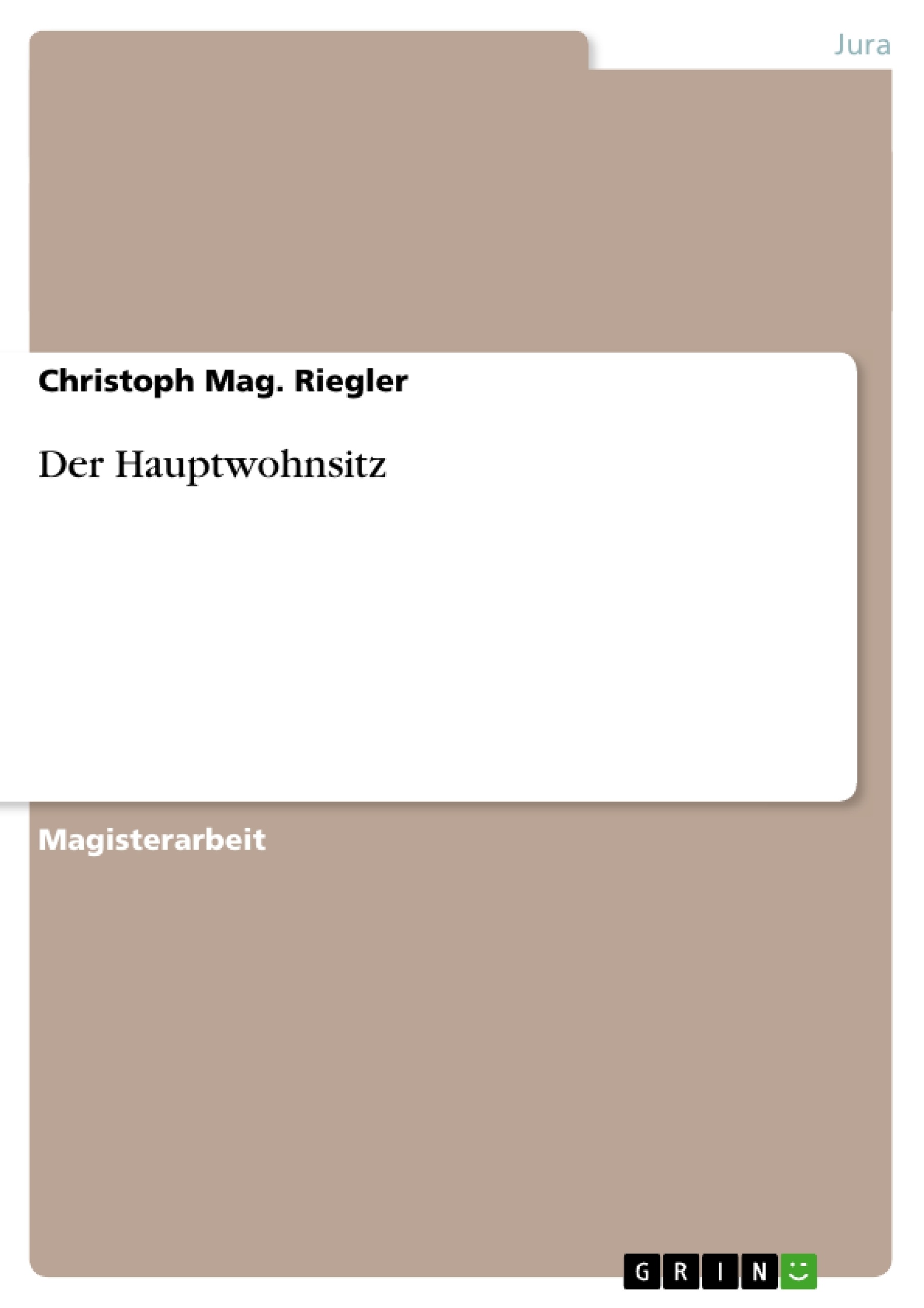Der Wohnsitz eines Menschen, sein ständiger oder nur vorübergehender Aufenthalt an einem bestimmten Ort in diesem Land, ist von entscheidender, rechtlicher und faktischer Bedeutung für den Einzelnen wie auch für das staatliche Gesamtgefüge. Mit der Entscheidung sich an einem Ort niederzulassen, dort seiner Arbeit nachzugehen oder familiäre und gesellschaftliche Beziehungen zu pflegen, sind zahlreiche Rechte und Pflichten verbunden. Zur Umsetzung vieler Ansprüche und Verpflichtungen eines Bürgers bedarf es aber eines feststehenden, örtlichen Bezugspunktes. So kann die Ausübung des Wahlrechts, der Bezug wirtschaftlicher Begünstigungen, die Inanspruchnahme regionaler Behörden und Einrichtungen, aber auch die Verpflichtung zur Entrichtung von steuerlichen Abgaben, die Vornahme der Meldepflicht und vieles andere mehr nur dann ordnungsgemäß wahrgenommen werden, wenn eine territoriale Zuordnung jedes Bürgers gegeben ist.
Diesen örtlichen Anknüpfungspunkt eines Bürgers stellte über lange Zeit hinweg der "ordentliche" Wohnsitz dar. Dieses Wohnsitzkonzept bewährte sich aber in vielen Fällen nicht und führte zu zahlreichen Anwendungsschwierigkeiten, welche zuweilen auch mit missbräuchlichen Folgen verbunden waren. Gerade die jedem Bürger zustehende Möglichkeit an mehreren Orten seiner Wahl Aufenthalt zu nehmen, war eines der zentralen Probleme dieser Regelung. Um die Entwicklung vom ordentlichen Wohnsitz hin zu einem neuen Wohnsitzkonzept nachvollziehen zu können und um ein besseres Verständnis für die Wohnsitzproblematik im allgemeinen zu gewinnen, soll das bisherige Konzept zumindest in seinen Grundzügen in diese Arbeit einfließen.
Mit dem Hauptwohnsitzgesetz und einer gleichzeitigen Novellierung der österreichischen Bundesverfassung wird schließlich eine neue Ära in der Wohnsitzfrage eingeleitet, die zugleich den vorläufigen Abschluss einer jahrzehntelangen Diskussion über die Lösung der Wohnsitzproblematik bildet. Es gilt im Rahmen dieser Arbeit das neue Wohnsitzkonzept eingehend zu durchleuchten, die tatsächlichen Vor- und Nachteile zu analysieren und die Bedeutung des Hauptwohnsitzes in vielen Bereichen des staatlichen Zusammenlebens darzustellen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Vorbemerkungen zu Inhalt und Aufbau
- Kapitel 1: Vom ordentlichen Wohnsitz zum Hauptwohnsitz
- 1.1 Der ordentliche Wohnsitz
- 1.1.1 Die Problematik des ordentlichen Wohnsitzes
- 1.1.2 Der Begriff des ordentlichen Wohnsitzes
- 1.1.2.1 Die Elemente des ordentlichen Wohnsitzbegriffes
- 1.1.3 Die Möglichkeit mehrerer ordentlicher Wohnsitze
- 1.1.3.1 Schwierigkeiten aufgrund von Mehrfachwohnsitzen
- 1.2 Einführung des Hauptwohnsitzgesetzes
- 1.2.1 Überblick der Gesetzesänderungen durch das HauptwohnsitzG
- 1.1 Der ordentliche Wohnsitz
- Kapitel 2: Das Hauptwohnsitzgesetz BG 8.7.1994 BGBI 505
- 2.1 Der Hauptwohnsitz
- 2.1.1 Der Begriff des Hauptwohnsitzes
- 2.1.2 Die Bedeutung des Hauptwohnsitzes
- 2.1 Der Hauptwohnsitz
- Kapitel 3: Der Hauptwohnsitz im Meldewesen
- 3.1 Begriffstrias „Unterkunft - Wohnsitz – Hauptwohnsitz“
- 3.2 Bedeutung der Meldung für das Vorliegen eines Hauptwohnsitzes
- 3.2.1 Anhaltspunkte für eine konstitutive Wirkung der Meldung
- 3.2.2 Problemfall: Hauptwohnsitz bei mehreren Lebensmittelpunkten ohne Meldung
- 3.3 Bedeutende Änderungen im MeldeG 1991 durch das HauptwohnsitzG
- 3.3.1 Einführung des Reklamationsverfahrens
- 3.3.2 Realisierung des Zentralen Melderegisters
- 3.3.3 Wanderungsstatistik
- 3.4 Weitere bedeutende Änderungen im MeldeG 1991 durch die MeldeGNov 2001
- Kapitel 4: Der Hauptwohnsitz im Volkszählungswesen
- 4.1 Ziel und Bedeutung der Volkszählung
- 4.2 Auswirkungen des „Volkszählungserkenntnisses“
- 4.3 Bedeutende Änderungen im VolksZählG 1980 durch das HauptwohnsitzG
- 4.4 Weitere Änderungen im VolksZählG 1980 durch die MeldeGNov 2001
- 4.5 Die Volkszählung der Zukunft
- Kapitel 5: Die Bundesverfassungsgesetz-Novelle 1994 BGBI 1994/505
- 5.1 Ziele und Gründe der B-VGNov 1994
- 5.2 Der Hauptwohnsitz im B-VG
- 5.2.1 Übergangsvorschriften der B-VGNov 1994
- 5.3 Die Landesbürgerschaft
- 5.3.1 Auswirkungen auf das Wahlrecht zum Landtag
- 5.3.2 Auswirkungen auf das Wahlrecht zum Gemeinderat
- Kapitel 6: Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Rechtsbegriff des Hauptwohnsitzes im österreichischen Rechtssystem. Ziel ist es, die Entwicklung des Begriffs vom ordentlichen Wohnsitz zum Hauptwohnsitz nachzuvollziehen und dessen Bedeutung in verschiedenen Rechtsbereichen zu analysieren.
- Entwicklung des Rechtsbegriffs „Wohnsitz“
- Einführung und Auswirkungen des Hauptwohnsitzgesetzes
- Bedeutung des Hauptwohnsitzes im Meldewesen und der Volkszählung
- Relevanz des Hauptwohnsitzes im Bundesverfassungsgesetz
- Zusammenspiel verschiedener Rechtsgebiete im Kontext des Hauptwohnsitzes
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Vom ordentlichen Wohnsitz zum Hauptwohnsitz: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Wohnsitzbegriffs im österreichischen Recht. Es analysiert die Problematik des ordentlichen Wohnsitzes, seine Elemente und die Schwierigkeiten, die sich aus mehreren ordentlichen Wohnsitzen ergeben können. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit der Gesetzesänderung und der Einführung des Hauptwohnsitzgesetzes als Reaktion auf die Komplexität des bisherigen Systems. Die Diskussion der Problematik des Mehrfachwohnsitzes und die daraus resultierenden juristischen Herausforderungen bilden einen zentralen Aspekt dieses Kapitels. Die Einführung des Hauptwohnsitzgesetzes wird als Lösungsansatz für diese Probleme vorgestellt.
Kapitel 2: Das Hauptwohnsitzgesetz BG 8.7.1994 BGBI 505: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Hauptwohnsitzgesetz von 1994. Es definiert den Begriff des Hauptwohnsitzes präzise und untersucht dessen Bedeutung in verschiedenen juristischen Kontexten. Die Analyse konzentriert sich auf die zentralen Bestimmungen des Gesetzes und deren Auswirkungen auf die Rechtspraxis. Es werden die wichtigsten Neuerungen und Änderungen im Vergleich zum vorherigen Rechtszustand ausführlich dargestellt. Der Schwerpunkt liegt auf der Klärung der rechtlichen Definition und der Interpretation des Hauptwohnsitzes sowie seiner Implikationen für die Rechtsanwendung.
Kapitel 3: Der Hauptwohnsitz im Meldewesen: Dieses Kapitel untersucht die Rolle des Hauptwohnsitzes im österreichischen Meldewesen. Es analysiert die Beziehung zwischen Unterkunft, Wohnsitz und Hauptwohnsitz und die Bedeutung der Meldung für das Vorliegen eines Hauptwohnsitzes. Besondere Aufmerksamkeit wird der konstitutiven Wirkung der Meldung gewidmet und Problemfälle, wie der Hauptwohnsitz bei mehreren Lebensmittelpunkten ohne Meldung, werden detailliert betrachtet. Die tiefgreifenden Änderungen im Meldegesetz durch das Hauptwohnsitzgesetz, einschließlich der Einführung des Reklamationsverfahrens und des Zentralen Melderegisters, werden umfassend diskutiert. Das Kapitel analysiert den Einfluss des Hauptwohnsitzgesetzes auf die Effizienz und Genauigkeit des Melderegisters.
Kapitel 4: Der Hauptwohnsitz im Volkszählungswesen: In diesem Kapitel wird die Bedeutung des Hauptwohnsitzes im Kontext des Volkszählungswesens untersucht. Es werden Ziel und Bedeutung der Volkszählung analysiert und die Auswirkungen des „Volkszählungserkenntnisses“ auf die Datenerhebung und -auswertung beleuchtet. Der Fokus liegt auf den Änderungen im Volkszählungsgesetz, die durch das Hauptwohnsitzgesetz und nachfolgende Novellen hervorgerufen wurden. Die Diskussion der zukünftigen Volkszählungen und der damit verbundenen Herausforderungen rundet das Kapitel ab, wobei der Einfluss des Hauptwohnsitzes auf die Genauigkeit und Aussagekraft der Volkszählungsdaten im Vordergrund steht.
Kapitel 5: Die Bundesverfassungsgesetz-Novelle 1994 BGBI 1994/505: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Auswirkungen der Bundesverfassungsgesetz-Novelle von 1994 auf den Hauptwohnsitz. Es beleuchtet die Ziele und Gründe der Novelle und analysiert die neue Bedeutung des Hauptwohnsitzes im Bundesverfassungsgesetz. Die Übergangsvorschriften werden ebenso wie die Auswirkungen auf das Wahlrecht zum Landtag und zum Gemeinderat detailliert erläutert. Die Analyse konzentriert sich auf die verfassungsrechtlichen Implikationen der Definition und Bedeutung des Hauptwohnsitzes und die damit verbundenen Änderungen im Wahlrecht.
Schlüsselwörter
Hauptwohnsitz, ordentlicher Wohnsitz, Meldewesen, Volkszählung, Bundesverfassungsgesetz, Rechtsentwicklung, Gesetzesänderungen, Rechtsprechung, Mehrfachwohnsitz, Meldepflicht, Wahlrecht.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Hauptwohnsitz im österreichischen Recht
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Rechtsbegriff des Hauptwohnsitzes im österreichischen Rechtssystem. Sie untersucht dessen Entwicklung vom ordentlichen Wohnsitz zum Hauptwohnsitz und analysiert dessen Bedeutung in verschiedenen Rechtsbereichen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Rechtsbegriffs "Wohnsitz", die Einführung und Auswirkungen des Hauptwohnsitzgesetzes, die Bedeutung des Hauptwohnsitzes im Meldewesen und der Volkszählung, die Relevanz des Hauptwohnsitzes im Bundesverfassungsgesetz sowie das Zusammenspiel verschiedener Rechtsgebiete im Kontext des Hauptwohnsitzes.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Kapitel 1 behandelt die Entwicklung vom ordentlichen Wohnsitz zum Hauptwohnsitz. Kapitel 2 analysiert das Hauptwohnsitzgesetz von 1994. Kapitel 3 untersucht den Hauptwohnsitz im Meldewesen. Kapitel 4 befasst sich mit dem Hauptwohnsitz im Volkszählungswesen. Kapitel 5 analysiert die Bundesverfassungsgesetz-Novelle von 1994. Kapitel 6 enthält Schlussbemerkungen.
Was sind die zentralen Ergebnisse von Kapitel 1?
Kapitel 1 beleuchtet die historische Entwicklung des Wohnsitzbegriffs und die Problematik des ordentlichen Wohnsitzes, insbesondere die Schwierigkeiten bei Mehrfachwohnsitzen. Es zeigt die Notwendigkeit der Gesetzesänderung und Einführung des Hauptwohnsitzgesetzes als Reaktion auf die Komplexität des vorherigen Systems.
Welche Aspekte werden in Kapitel 2 zum Hauptwohnsitzgesetz behandelt?
Kapitel 2 definiert den Begriff des Hauptwohnsitzes präzise und untersucht seine Bedeutung in verschiedenen juristischen Kontexten. Es analysiert die zentralen Bestimmungen des Gesetzes und deren Auswirkungen auf die Rechtspraxis. Der Fokus liegt auf der Klärung der rechtlichen Definition und Interpretation des Hauptwohnsitzes.
Was ist der Schwerpunkt von Kapitel 3 zum Meldewesen?
Kapitel 3 analysiert die Beziehung zwischen Unterkunft, Wohnsitz und Hauptwohnsitz und die Bedeutung der Meldung für das Vorliegen eines Hauptwohnsitzes. Es befasst sich mit der konstitutiven Wirkung der Meldung und Problemfällen (z.B. Hauptwohnsitz bei mehreren Lebensmittelpunkten ohne Meldung). Die Änderungen im Meldegesetz durch das Hauptwohnsitzgesetz werden umfassend diskutiert.
Worauf konzentriert sich Kapitel 4 zur Volkszählung?
Kapitel 4 untersucht die Bedeutung des Hauptwohnsitzes im Kontext des Volkszählungswesens. Es analysiert Ziel und Bedeutung der Volkszählung, die Auswirkungen des „Volkszählungserkenntnisses“ und die Änderungen im Volkszählungsgesetz durch das Hauptwohnsitzgesetz und nachfolgende Novellen. Der Einfluss des Hauptwohnsitzes auf die Genauigkeit der Volkszählungsdaten steht im Vordergrund.
Welche Aspekte der Bundesverfassungsgesetz-Novelle werden in Kapitel 5 behandelt?
Kapitel 5 konzentriert sich auf die Auswirkungen der Bundesverfassungsgesetz-Novelle von 1994 auf den Hauptwohnsitz. Es beleuchtet die Ziele und Gründe der Novelle, die Bedeutung des Hauptwohnsitzes im Bundesverfassungsgesetz, die Übergangsvorschriften und die Auswirkungen auf das Wahlrecht zum Landtag und Gemeinderat.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hauptwohnsitz, ordentlicher Wohnsitz, Meldewesen, Volkszählung, Bundesverfassungsgesetz, Rechtsentwicklung, Gesetzesänderungen, Rechtsprechung, Mehrfachwohnsitz, Meldepflicht, Wahlrecht.
Wo finde ich den vollständigen Inhalt der Diplomarbeit?
Der vollständige Inhalt der Diplomarbeit ist nicht in diesem FAQ enthalten. Dieses FAQ dient lediglich als Zusammenfassung und Überblick über die wichtigsten Punkte.
- Quote paper
- Christoph Mag. Riegler (Author), 2002, Der Hauptwohnsitz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8188