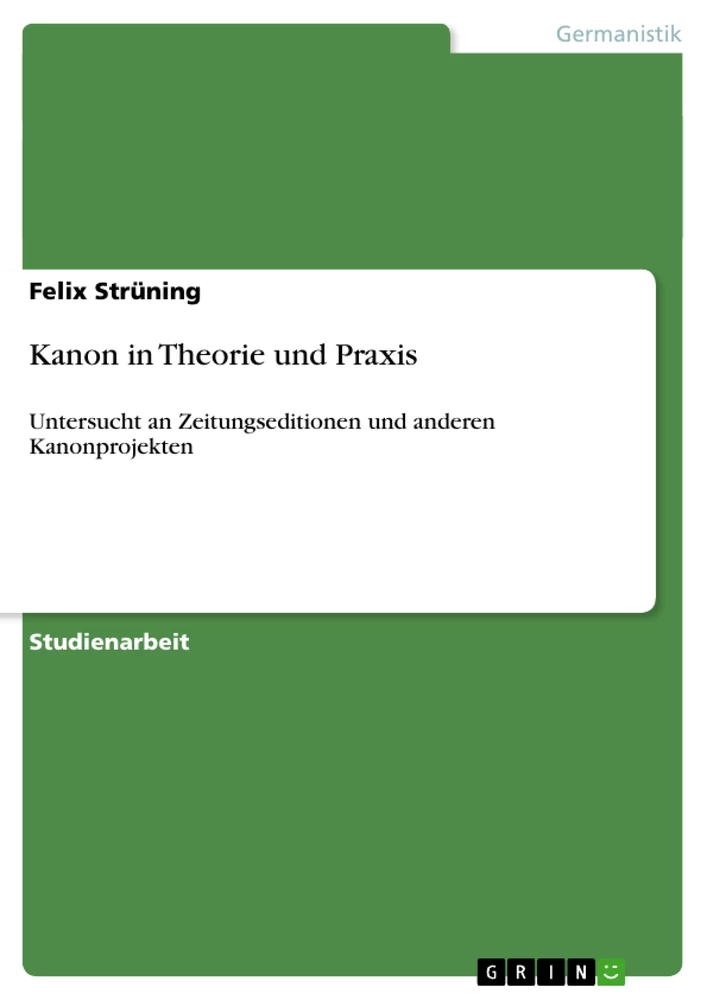Ist ein Kanon heutzutage noch das richtige Modell, um Schülern, Studenten, Lehrern und allgemein Lesern zu sagen, was man lesen sollte? Oder gar gelesen haben muss, um von sich behaupten zu können, Allgemeinbildung zu haben? Literaturkenntnis ist schließlich kein entscheidender Faktor für das alltägliche Leben. Einerseits werden Leselisten vor allem von Studenten sehr gerne angenommen, da bei vollen Lehrplänen und umfangreichen Lektüreanforderungen die Zeit sehr kostbar wird. Sie mit ‚dem falschen’ Buch zu verbringen, wäre töricht. Auch scheint es in Zeiten von Multiple Choice Tests und „Wer wird Millionär?“-Sendungen immer mehr darauf hinauszulaufen, ein genau definiertes Kulturwissen anzustreben, eben einen Kanon, bei dem man weiß, wenn man ihn liest, hat man das Wichtigste ausgewählt. Bildung wird oft nicht mehr als offen und ständig zu erweiternd verstanden, sondern auf ‚key values’ reduziert. Am besten ist es, Wissen auf eine Auswahl aus einer beschränkten Anzahl von Möglichkeiten zu komprimieren. Wie Volker Hage und Johannes Saltzwedel im Spiegel schon 2001 konstatierten: „Kultur hat es leichter, wenn sie vermessen wurde; als durchgerechnete Gegenwelt zur chaotischen Gegenwart und Zukunft.“ Besten- und Empfehlungslisten haben bekanntlich eine lange Tradition, die ersten wurden schon in der Antike angefertigt. So z.B. durch die große Bibliothek von Alexandria und ihre Gelehrten, die nur drei Autoren in ihrem Mindestkanon auflisteten: Aischylos, Sophokles und Euripides. Aufgrund der massiven Ausschlussfunktion dieser antiken Bestimmungen, wurden nur sehr wenige Autoren und Texte tradiert und überliefert. Grund genug, dass heutige Kanonmacher ihre Listen meist nur als Vorschläge verstanden wissen wollen. Kanones vermitteln „Orientierung und ‚subjektive Sicherheit’“ , außerdem das Gefühl, Kultur zu besitzen und sie zu kennen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- A. Kanon-Begriff, -Theorie und -Diskussion
- A.1 Kanonbegriff
- A.2 Kanonisierungsprozesse und Kanon-Macher
- A.3 Kanonarten
- A.3.1 Materialer Kanon
- A.3.2 Deutungskanon
- A.3.3 Negativkanon
- A.3.4 Gegenkanon
- A.3.5 Akuter Kanon
- A.4 Funktionsweisen von Kanon
- A.4.1 Selbstbild
- A.4.2 Kanon als Wertsprache für Literatur
- A.4.3 Abgrenzung des Kanons
- B. Kanon-„Praxis“
- B.1 Die „Zeit“-Bibliothek der 100 Bücher
- B.2 Die „Zeit“-Schülerbibliothek
- B.3 Marcel Reich-Ranickis Kanonprojekte
- B.3.1 Marcel Reich-Ranickis Literaturliste im Spiegel
- B.3.2 Marcel Reich-Ranickis Kanon-Buchpakete
- B.4 Die „SZ-Bibliothek“
- B.5 Die „Bild Bestseller Bibliothek“
- B.6 Die „Brigitte-Edition“
- B.7 Die „Spiegel-Edition – Die Bestseller“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Praxis des Kanons anhand von Zeitungseditionen und anderen Kanonprojekten. Ziel ist es, Kriterien für die Konstruktion eines Kanons zu entwickeln und diese auf ausgewählte Projekte anzuwenden. Dabei wird nicht primär die Kanonisierbarkeit einzelner Werke, sondern der Aufbau und die Funktionsweise von Kanonen im Allgemeinen betrachtet.
- Der Kanonbegriff und seine verschiedenen Ausprägungen
- Kanonisierungsprozesse und die Rolle von „Kanonmachern“
- Analyse verschiedener Kanonprojekte (Zeit-Bibliotheken, Reich-Ranicki-Kanon, Zeitungseditionen)
- Der wirtschaftliche Erfolg von Kanonprojekten trotz abnehmender Kanonakzeptanz
- Kriterien für die Beurteilung der „Kanontauglichkeit“ von Editionen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung diskutiert die aktuelle Relevanz des Kanonbegriffs im Kontext von Bildung und Allgemeinbildung. Sie stellt die Frage nach der Notwendigkeit von Leselisten und deren Akzeptanz in einer Zeit, die von Multiple-Choice-Tests und fragmentiertem Wissen geprägt ist. Die Einleitung führt in die Thematik ein und leitet über zur Untersuchung konkreter Kanonprojekte, die im weiteren Verlauf der Arbeit analysiert werden. Der Fokus liegt auf der Ambivalenz des Kanons: einerseits die Sehnsucht nach Orientierung und Sicherheit, andererseits die Ablehnung von verbindlichen Vorgaben und die Frage nach den Kriterien für eine sinnvolle Lektüreauswahl.
A. Kanon-Begriff, -Theorie und -Diskussion: Dieses Kapitel befasst sich umfassend mit dem Kanonbegriff, seinen verschiedenen Ausprägungen (materialer, Deutungs-, Negativ-, Gegen- und akuter Kanon) und den Prozessen seiner Entstehung. Es analysiert die Funktionsweisen des Kanons, seine Rolle als Selbstbild der Kultur, als Wertsprache für Literatur und als Instrument der Abgrenzung. Der Abschnitt legt den theoretischen Grundstein für die spätere Analyse der konkreten Kanonprojekte.
B. Kanon-„Praxis“: Dieser Teil präsentiert eine detaillierte Analyse verschiedener Kanonprojekte, darunter die „Zeit“-Bibliotheken, die Kanonprojekte von Marcel Reich-Ranicki (seine Literaturliste im Spiegel und seine Buchpakete) und verschiedene Zeitungseditionen (SZ-Bibliothek, Bild Bestseller Bibliothek, Brigitte-Edition und Spiegel-Edition). Jeder dieser Projekte wird einzeln untersucht und hinsichtlich seines Kanonanspruchs und seiner "Kanontauglichkeit" bewertet, wobei die unterschiedlichen Herangehensweisen und Zielsetzungen der jeweiligen Projekte herausgestellt werden.
Schlüsselwörter
Kanon, Kanonbegriff, Kanonisierung, Literaturkanon, Zeitungseditionen, Marcel Reich-Ranicki, „Zeit“-Bibliothek, „SZ-Bibliothek“, „Bild Bestseller Bibliothek“, „Brigitte-Edition“, „Spiegel-Edition“, Allgemeinbildung, Literaturvermittlung, Leselisten, Kultur, Wertsprache.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Kanon-Praxis in Zeitungseditionen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Praxis des Kanons anhand von Zeitungseditionen und anderen Kanonprojekten. Der Fokus liegt dabei nicht auf der Kanonisierbarkeit einzelner Werke, sondern auf dem Aufbau und der Funktionsweise von Kanonen im Allgemeinen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel ist die Entwicklung von Kriterien für die Konstruktion eines Kanons und deren Anwendung auf ausgewählte Projekte. Es wird der wirtschaftliche Erfolg von Kanonprojekten trotz abnehmender Kanonakzeptanz untersucht und Kriterien zur Beurteilung der „Kanontauglichkeit“ von Editionen entwickelt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Kanonbegriff und seine verschiedenen Ausprägungen, Kanonisierungsprozesse und die Rolle der „Kanonmacher“, die Analyse verschiedener Kanonprojekte (Zeit-Bibliotheken, Reich-Ranicki-Kanon, Zeitungseditionen) sowie die Frage nach der Notwendigkeit von Leselisten in der heutigen Zeit.
Welche Kanonprojekte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert detailliert verschiedene Kanonprojekte, darunter die „Zeit“-Bibliotheken (inkl. der Schülerbibliothek), die Kanonprojekte von Marcel Reich-Ranicki (seine Literaturliste im Spiegel und seine Buchpakete) und verschiedene Zeitungseditionen wie die „SZ-Bibliothek“, „Bild Bestseller Bibliothek“, „Brigitte-Edition“ und „Spiegel-Edition – Die Bestseller“.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zum Kanonbegriff, seinen Theorien und Diskussionen, einem Kapitel zur Kanon-Praxis mit der Analyse der oben genannten Projekte und einem Fazit. Die Einleitung thematisiert die Relevanz des Kanonbegriffs im Kontext von Bildung und Allgemeinbildung.
Welche Arten von Kanonen werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen materiellem Kanon, Deutungskanon, Negativkanon, Gegenkanon und akutem Kanon.
Welche Rolle spielen „Kanonmacher“?
Die Arbeit untersucht die Rolle der „Kanonmacher“ im Prozess der Kanonisierung und deren Einfluss auf die Auswahl und Präsentation von literarischen Werken.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist im gegebenen Text nicht explizit zusammengefasst, aber die Arbeit bewertet die untersuchten Projekte hinsichtlich ihres Kanonanspruchs und ihrer "Kanontauglichkeit", wobei die unterschiedlichen Herangehensweisen und Zielsetzungen herausgestellt werden.)
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Kanon, Kanonbegriff, Kanonisierung, Literaturkanon, Zeitungseditionen, Marcel Reich-Ranicki, „Zeit“-Bibliothek, „SZ-Bibliothek“, „Bild Bestseller Bibliothek“, „Brigitte-Edition“, „Spiegel-Edition“, Allgemeinbildung, Literaturvermittlung, Leselisten, Kultur, Wertsprache.
- Quote paper
- Felix Strüning (Author), 2007, Kanon in Theorie und Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81888