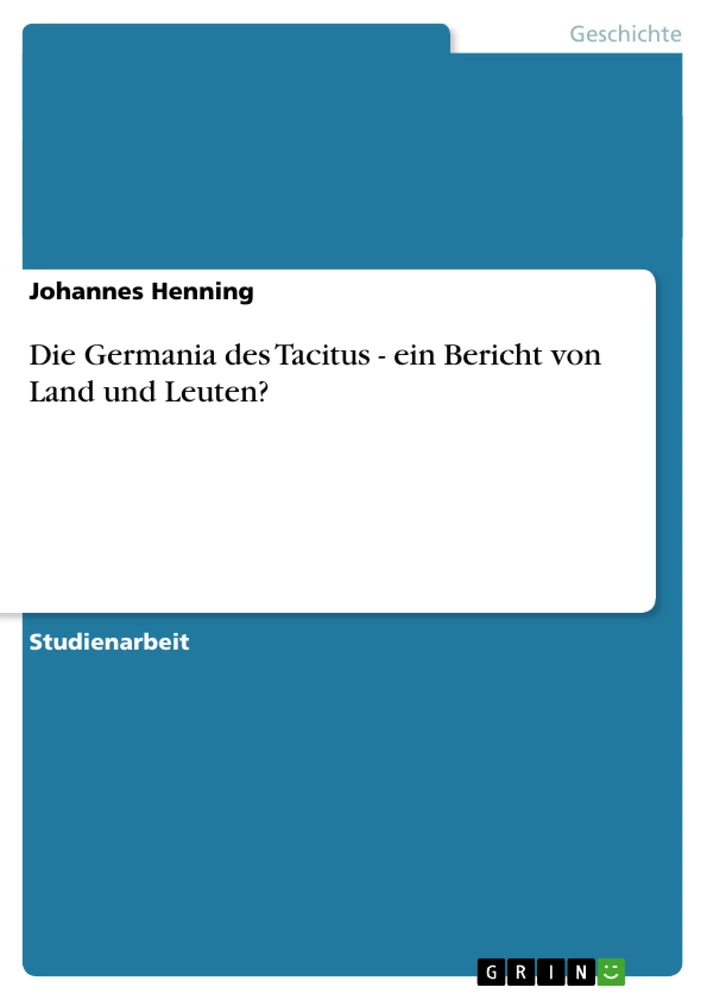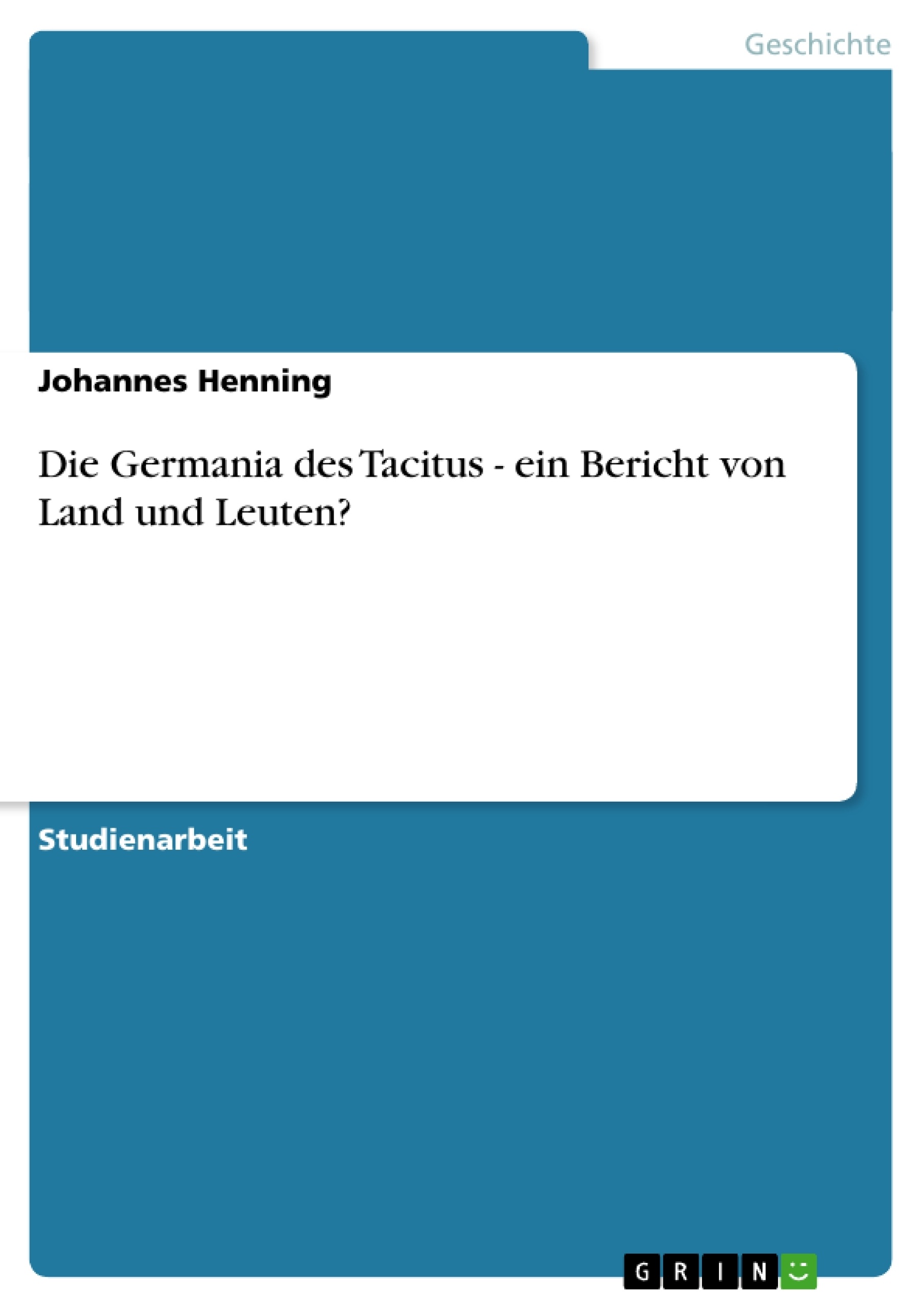Es dürfte wohl kaum einen Schüler geben, der Tacitus’ Germania nicht kennt. Im Geschichtsunterricht nimmt die Behandlung der römischen Geschichte einen zentralen Platz ein. In Verbindung mit der „Germania“ heißt dies vor allem die Erörterung der Beziehungen zwischen Römern und germanischen Volksstämmen. In vielen Fällen verweisen Lehrer auf Tacitus, lassen ihn zitieren und schöpfen für die Schüler aus der „Germania“ viele Sachinformationen für den möglichst lebendigen Unterricht. Allerdings geschieht dies in der Regel – oftmals dem Umstand zu geringer Zeit und fachlicher Überforderungen der Jungen und Mädchen geschuldet – ohne die Umstände, Hintergründe und Einwände zu dieser Schrift des römischen Gelehrten mit der gebotenen Sorgfalt zu betrachten. Aus diesem Grund will die vorliegende Misszelle in knapper Form versuchen darüber aufzuklären, inwieweit Tacitus’ Germania der tatsächliche Bericht von Land und Leuten ist, als der er landläufig aufgefasst wird. Dies geschieht ohne eine detaillierte Beschreibung des Werkes und ohne innere quellenkritische Betrachtung, inwiefern die einzelnen Angaben von anderen antiken Autoren abweichen oder übereinstimmen. Stattdessen steht der ethnographische Charakter der „Germania“ ausschließlich im Zentrum.
Inhaltsverzeichnis
- 1.1 Vorbemerkung
- 3.2 Allgemeines zu Publius(?) Cornelius Tacitus
- 4.3 Die „Germania“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Tacitus' „Germania“ und hinterfragt deren Darstellung der Germanen als objektiven Bericht von Land und Leuten. Die Arbeit konzentriert sich auf die Frage, inwieweit Tacitus' Schilderungen ein tatsächliches Abbild der germanischen Gesellschaft darstellen oder ob sie durch seine eigene Perspektive und die damalige römische Sichtweise geprägt sind.
- Tacitus' Biographie und seine Intentionen bei der Verfassung der Germania
- Vergleich zwischen der römischen und germanischen Gesellschaft in der Germania
- Analyse der Darstellung der Germanen und der kritische Umgang mit den Quellen
- Idealbild der Germanen im Kontrast zum Sittenverfall Roms
- Die Frage der Objektivität in der ethnographischen Darstellung
Zusammenfassung der Kapitel
1.1 Vorbemerkung: Diese Einleitung erläutert den Kontext der Arbeit und die Fragestellung. Sie verdeutlicht die gängige Rezeption der „Germania“ im Schulunterricht und betont die Notwendigkeit, die Arbeit Tacitus' kritisch zu betrachten, ohne dabei auf eine detaillierte Inhaltsanalyse oder Quellenkritik einzugehen. Der Fokus liegt auf der Frage, ob Tacitus' Werk tatsächlich ein objektiver Bericht ist oder ob es von subjektiven Interpretationen geprägt ist.
3.2 Allgemeines zu Publius(?) Cornelius Tacitus: Dieser Abschnitt bietet einen knappen Überblick über das Leben und Werk des römischen Geschichtsschreibers Tacitus. Es werden seine wichtigsten politischen Ämter, seine Beziehungen zu anderen wichtigen Persönlichkeiten der Zeit und seine wichtigsten Schriften, darunter die „Germania“, die „Historiae“ und die „Annales“, erwähnt. Der Abschnitt betont die Bedeutung von Tacitus' Werk für die senatorische Geschichtsschreibung und seine tendenziell einseitig-negativen Urteile, trotz seines Anspruchs auf Unparteilichkeit.
4.3 Die „Germania“: Dieses Kapitel analysiert Tacitus' „Germania“ als erstes ethnographisches Werk seiner Art. Es wird hervorgehoben, dass Tacitus die Germanen idealisiert und im Kontrast zum Sittenverfall Roms stellt. Der Abschnitt diskutiert die Quellenlage und stellt heraus, dass Tacitus' Kenntnis der Germanen nicht auf eigener Anschauung beruhte, sondern auf literarischen Quellen. Die Arbeit analysiert, wie die germanische Gesellschaft im Vergleich zur römischen dargestellt wird und wie diese Darstellung ein verzerrtes Spiegelbild der Gesellschaft des Beobachters darstellt. Die „Rückschrittlichkeit“ der Germanen im technischen und kulturellen Bereich wird mit der „Ursprünglichkeit“ und den vermeintlich „natürlichen Moralvorstellungen“ verglichen. Die ambivalenten Charakterisierungen der Germanen als sowohl impulsiv und aggressiv als auch ursprünglich und moralisch werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Tacitus, Germania, Germanen, Römisches Reich, Ethnographie, Quellenkritik, Idealbild, Sittenverfall, Geschichtschreibung, Römisch-Germanische Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit über Tacitus' Germania
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit analysiert Tacitus' "Germania" und untersucht, inwieweit die Darstellung der Germanen als objektiver Bericht verstanden werden kann. Der Fokus liegt auf der Frage, ob Tacitus' Schilderungen ein tatsächliches Abbild der germanischen Gesellschaft darstellen oder ob sie durch seine eigene Perspektive und die damalige römische Sichtweise geprägt sind.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Tacitus' Biographie und seine Intentionen, einen Vergleich zwischen römischer und germanischer Gesellschaft, die Analyse der Darstellung der Germanen und den kritischen Umgang mit den Quellen, das Idealbild der Germanen im Kontrast zum Sittenverfall Roms sowie die Frage der Objektivität in der ethnographischen Darstellung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit beinhaltet eine Vorbemerkung, die den Kontext und die Fragestellung erläutert. Ein Kapitel widmet sich Tacitus' Leben und Werk, ein weiteres Kapitel analysiert die "Germania" selbst, hervorhebend Tacitus' Idealsierung der Germanen und den Vergleich mit dem Sittenverfall Roms. Die Quellenlage und die Abhängigkeit Tacitus' von literarischen Quellen werden diskutiert. Die ambivalenten Charakterisierungen der Germanen werden ebenfalls thematisiert.
Wie wird Tacitus' "Germania" in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die "Germania" als erstes ethnographisches Werk seiner Art und untersucht kritisch die Objektivität von Tacitus' Darstellung. Es wird herausgestellt, dass Tacitus' Kenntnis der Germanen nicht auf eigener Anschauung, sondern auf literarischen Quellen beruht und seine Darstellung von subjektiven Interpretationen geprägt ist. Die "Rückschrittlichkeit" der Germanen wird mit ihrer "Ursprünglichkeit" und vermeintlichen "natürlichen Moralvorstellungen" verglichen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Tacitus, Germania, Germanen, Römisches Reich, Ethnographie, Quellenkritik, Idealbild, Sittenverfall, Geschichtschreibung, Römisch-Germanische Beziehungen.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt, insbesondere für die Analyse von Themen im Kontext der antiken Geschichte und der Ethnographie.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Tacitus' "Germania" kritisch zu untersuchen und die Frage nach der Objektivität seiner Darstellung der Germanen zu beleuchten. Sie soll dazu beitragen, die gängige Rezeption der "Germania" im Schulunterricht zu hinterfragen und eine differenziertere Betrachtung des Werks zu ermöglichen.
- Quote paper
- Johannes Henning (Author), 2003, Die Germania des Tacitus - ein Bericht von Land und Leuten?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81786