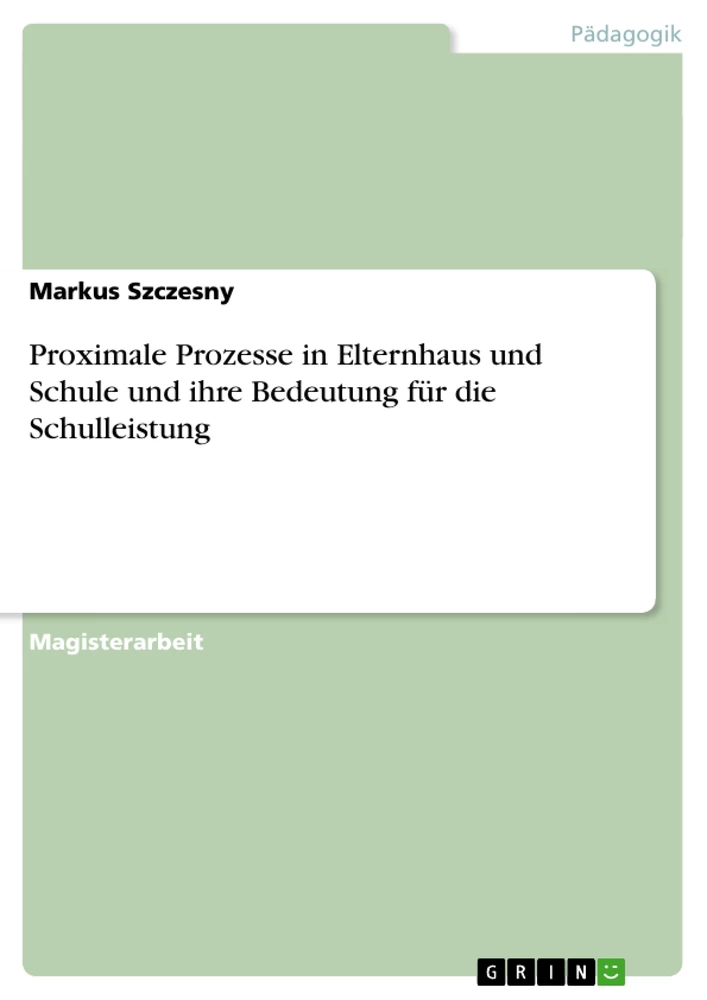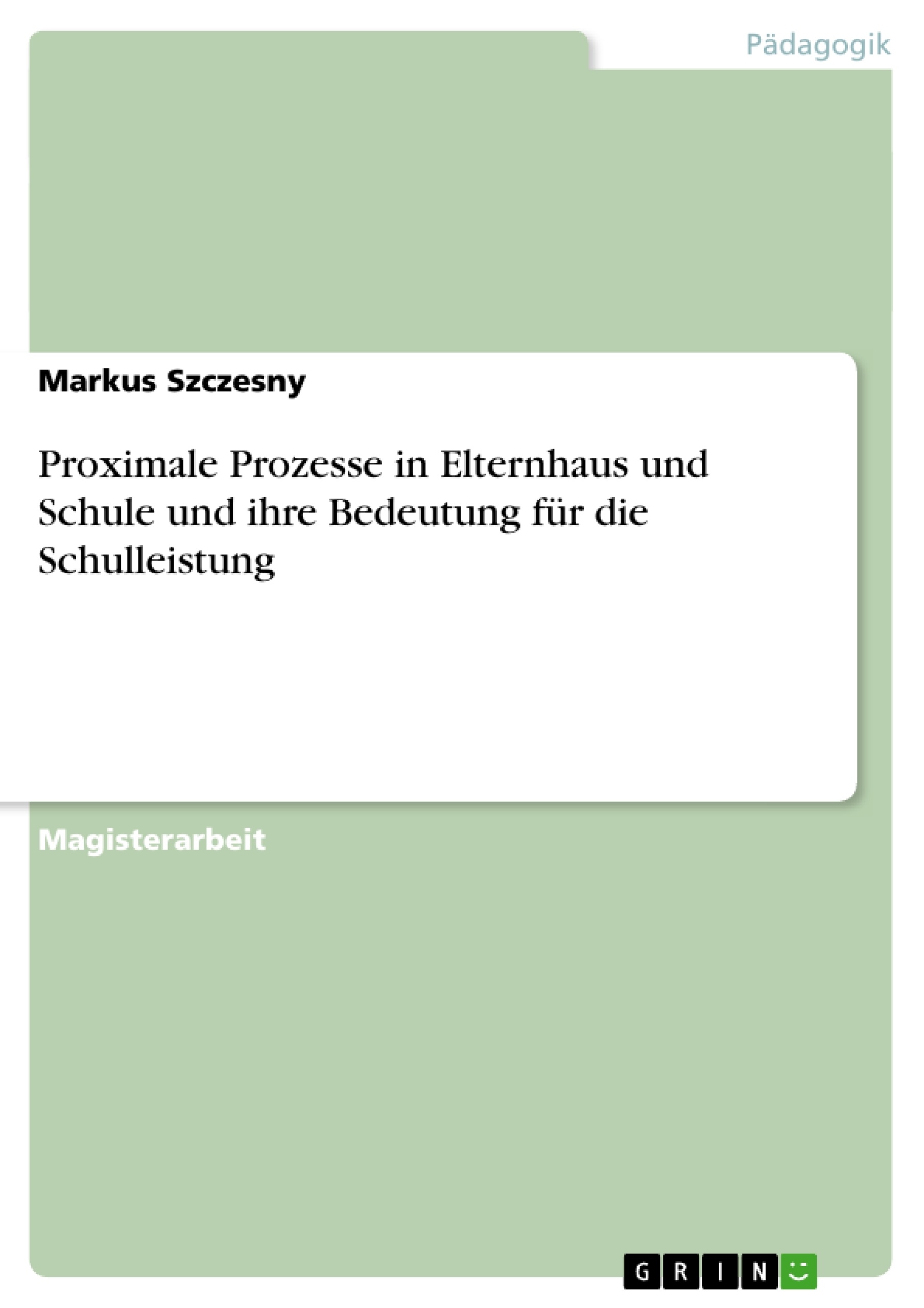Aktuelle Schulleistungsuntersuchungen wie PISA beziehen sich in ihrem theoretischen Hintergrund auf ökonomische Theorien wie Bourdieus Kapitaltheorie oder Boudons Theorie primärer und sekundärer Herkunftseffekte.
Wie in dieser Arbeit gezeigt wird, erschwert die empirische Schulforschung durch die Verwendung einer nicht-pädagogischen Semantik die Diskussion mit breiten Teilen der Pädagogik: Lehrer und Pädagogen stehen Untersuchungen kritisch gegenüber, die sich aufgrund der gewählten Ausgangstheorie nicht "zum Anwalt des Kindes" (Nohl) machen können.
Im Nachvollzug der historischen Genese des Schulleistungsprinzips (nach Klafki) soll in dieser Arbeit gezeigt werden, dass einerseits PISA eine gut zu begründete Theoriebasis verwendet, dass dabei andererseits aber der Kontakt zur Pädagogik verloren zu gehen droht und wichtige Perspektiven unberücksichtigt bleiben.
Als erweiterndes Konzept wird deshalb Urie Bronfenbrenners bio-ökologisches Modell der menschlichen Entwicklung in den Blick genommen, in dem eine Theorie proximaler Prozesse den Bereich der pädagogischen Praxis empirisch operationalisiert, der als blinder Fleck einer ökonomischen Theorie ausgemacht wurde.
Proximale Prozesse, d.h. wiederholt oder über einen längeren Zeitraum stattfindende Interaktionen im Nahbereich von Menschen, modellieren einen theoretischen Rahmen, der als hoch anschlussfähig innerhalb der Pädagogik erscheint, ohne empirische Operationalität einzubüßen.
Deshalb wird Bronfenbrenners Theorie proximaler Prozesse anhand zweier Datensätze (einen, der an der IGS-Göttingen erhoben wurde und dem PISA Datensatz) empirisch (erfolgreich) überprüft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Schulleistung?
- Die Mehrdimensionalität des Schulleistungsbegriffs
- Die Zweideutigkeit von ›Schulleistung‹
- Zur Geschichte der Schulleistung
- Zur Theorie der Bildungsungleichheit
- Das Referenzmodell: die ›Meritokratie‹
- Bourdieus ›Kapital‹ und ›Habitus‹
- Boudons ›Herkunftseffekte‹
- Das Bourdieu-Boudon-Paradigma
- Probleme und Desiderate
- Bronfenbrenners Modell der menschlichen Entwicklung
- Anlage und Umwelt
- Die Ökologie der menschlichen Entwicklung
- Das bio-ökologische Modell des Entwicklungsprozesses
- Proximale Prozesse
- Operationalisierung des bio-ökologischen Modells.
- Zusammenfassung und Ausblick: Bronfenbrenners ökologisches Modell als Theorie proximaler Prozesse
- Empirische Überprüfung des bio-ökologischen Modells
- Problemstellung.
- Forschungsstand
- Ableitung von Forschungshypothesen
- Statistische Verfahren.
- Umgang mit fehlenden Werten
- Analysemethode
- Zentrierung der Prädiktorvariablen
- Mögliche Wirkungen von Interaktionseffekten
- IGS Göttingen-Geismar .
- Stichprobe und Instrumente.
- Ergebnisse .
- Zusammenfassung
- PISA-Studie
- Stichprobe und Instrumente .
- Ergebnisse .
- Zusammenfassung
- Diskussion und Grenzen der Untersuchungen
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit befasst sich mit der Frage, wie proximale Prozesse in Elternhaus und Schule die Schulleistung beeinflussen. Im Mittelpunkt steht das bio-ökologische Modell von Bronfenbrenner, das die Interaktion zwischen Anlage und Umwelt in den Vordergrund stellt. Die Arbeit analysiert empirische Daten, um den Einfluss von proximalen Prozessen auf die Schulleistung zu untersuchen.
- Definition und Bedeutung von Schulleistung
- Theorien der Bildungsungleichheit
- Bronfenbrenners bio-ökologisches Modell der Entwicklung
- Empirische Überprüfung des Modells anhand von Daten aus der IGS Göttingen-Geismar und der PISA-Studie
- Diskussion der Ergebnisse und Grenzen der Untersuchungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel definiert den Begriff der Schulleistung und untersucht seine Mehrdimensionalität und Zweideutigkeit. Es beleuchtet auch die historische Entwicklung des Begriffs.
- Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit Theorien der Bildungsungleichheit. Es werden verschiedene Modelle vorgestellt, darunter die ›Meritokratie‹, Bourdieus ›Kapital‹ und ›Habitus‹ sowie Boudons ›Herkunftseffekte‹.
- Das dritte Kapitel stellt Bronfenbrenners bio-ökologisches Modell der menschlichen Entwicklung vor. Das Modell betont die Interaktion von Anlage und Umwelt und hebt die Bedeutung von proximalen Prozessen für die Entwicklung hervor.
- Das vierte Kapitel präsentiert die empirische Überprüfung des bio-ökologischen Modells anhand von Daten aus der IGS Göttingen-Geismar und der PISA-Studie.
Schlüsselwörter
Schulleistung, Bildungsungleichheit, proximale Prozesse, bio-ökologisches Modell, Bronfenbrenner, Elternhaus, Schule, Interaktion, Anlage, Umwelt, Empirie, IGS Göttingen-Geismar, PISA-Studie
- Citar trabajo
- Magister Artium Markus Szczesny (Autor), 2007, Proximale Prozesse in Elternhaus und Schule und ihre Bedeutung für die Schulleistung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81761