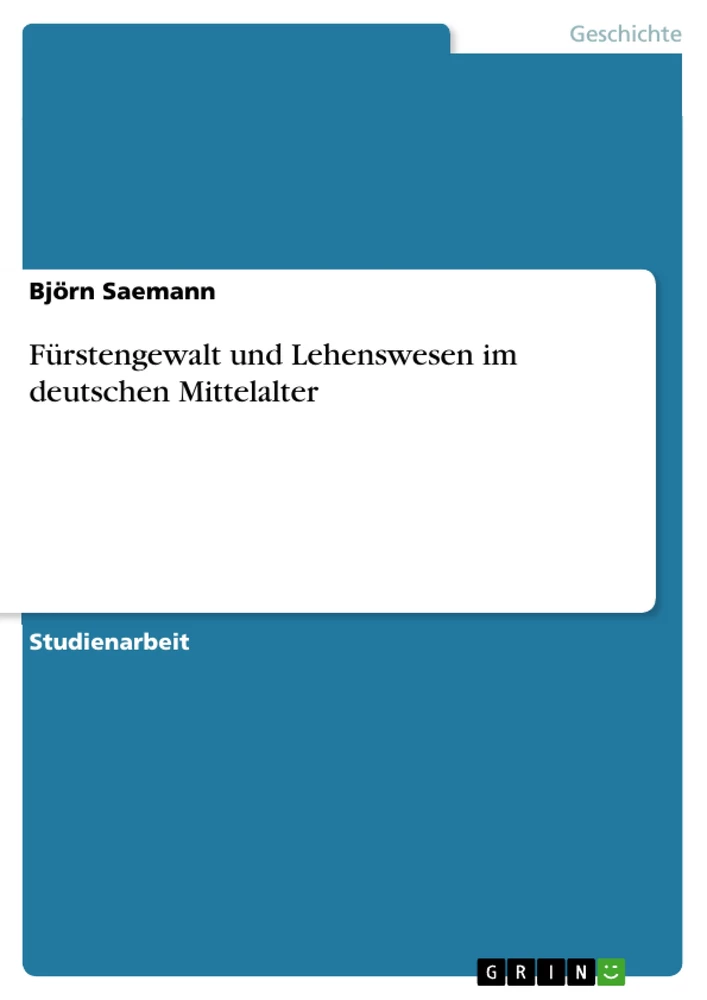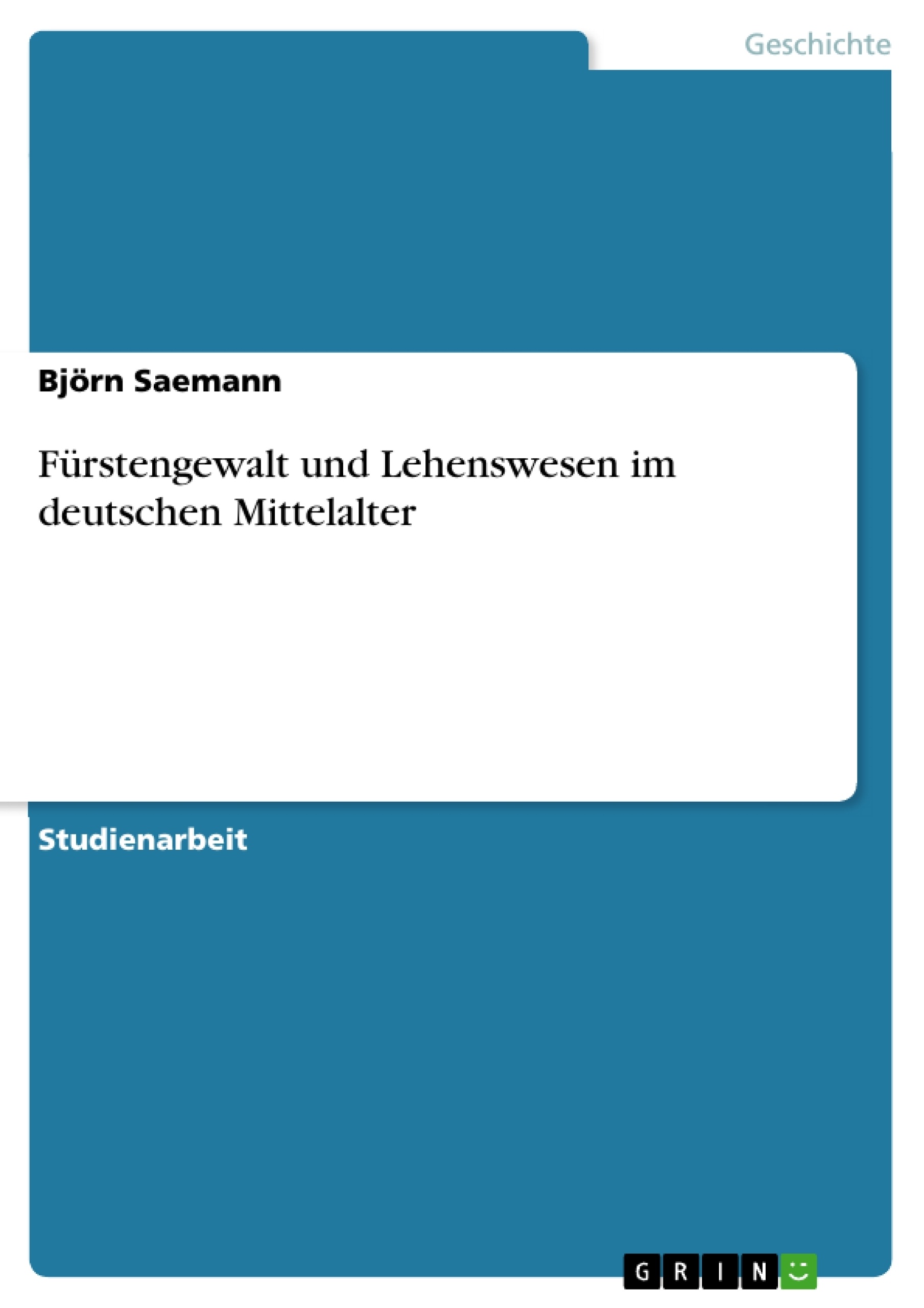Im Verlaufe dieser Arbeit befasse ich mich mit dem Kurfürstentum sowie dem deutschen Lehenwesen, seiner Struktur, seiner Herkunft und seiner Bedeutung. Insbesondere interessiert mich die Fragestellung, in welchem Bezug Lehenswesen und Fürstentum zueinander standen. War das Lehenswesen eine Stärkung oder eine Schwächung der Position der Fürsten gegenüber dem König?
Ursprünglich bezeichnete das Wort Lehen“ lediglich „etwas Geliehenes“. Abgeleitet ist es von dem althochdeutschen „Lehan“ oder dem mittelhochdeutschem „lehen, lên, leyn“ (leihen). Oft wird es auch „Lehnswesen“ geschrieben. Die lateinische Entsprechung ist einigen Quellen nach „feudum, beneficium, praedium“. Der Ursprung des Wortes „feudum“ ist strittig: Entweder kommt es, wie schon erwähnt, aus dem Lateinischen von dem dem lat. „fides“ (Treue) oder von dem althochdeutschem „feo“ (Vieh, Gut). Andere Quellen besagen, dass es mit dem althochdeutschen Wort „fihu“ verwandt sei. Demnach würde es ursprünglich nicht den Grundbesitz bezeichnen, sondern lediglich bewegliche Güter. Vom Wort „Feudum“ wird die Bezeichnung „Feudalismus“ abgeleitet. Feudalismus ist ein weiteres – insbesondere in der marxistischen Geschichtstheorie gebräuchlichen- Synonym für Lehenswesen. Abgeleitet von dem Wort „beneficium“ war im 19. Jahrhundert auch die Bezeichnung „Benefizialwesen“ gebräuchlich.
Inhaltsverzeichnis
- I.) Einleitung
- II.) Lehenswesen
- II.a.) Wortherkunft und Wortverwandtschaft
- II.b.) Die Anfänge des Lehenswesens
- II.c.) Die Kommendation
- II.d.) Das Karolingische Lehenswesen
- II.e.) Rangerhöhung der Vasallen
- II.f.) Die Lehensordnung des Karolingischen Lehenswesens
- III.) Fürsten
- III.a.) Fürstenarten
- III.b.) Kurfürsten
- III.c.) Die goldene Bulle
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das deutsche Lehenswesen im Mittelalter und dessen Verhältnis zum Fürstenwesen. Das zentrale Anliegen ist die Klärung der wechselseitigen Beeinflussung und die Bewertung der Frage, ob das Lehenswesen die Position der Fürsten gegenüber dem König stärkte oder schwächte.
- Wortherkunft und Entwicklung des Lehenswesens
- Die Anfänge des Lehenswesens im merowingischen Reich
- Das karolingische Lehenswesen und seine Ordnung
- Die verschiedenen Arten von Fürsten
- Die Bedeutung der goldenen Bulle
Zusammenfassung der Kapitel
I.) Einleitung: Die Einleitung skizziert den Fokus der Arbeit: die Untersuchung des deutschen Lehenswesens, seiner Struktur, Herkunft und Bedeutung im Kontext des Verhältnisses zum Fürstenwesen. Zentral ist die Frage nach der Stärkung oder Schwächung der Fürstenposition durch das Lehenswesen.
II.) Lehenswesen: Dieses Kapitel beleuchtet umfassend das Lehenswesen. Es beginnt mit der etymologischen Untersuchung des Wortes „Lehen“, verfolgt seine Entwicklung von „etwas Geliehenem“ bis hin zu komplexen Begriffen wie „Feudalismus“ und „Benefizialwesen“. Der Unterschied zum Allodium (freiem Eigentum) wird herausgestellt. Anschließend werden die Anfänge des Lehenswesens im merowingischen Reich beschrieben, mit Fokus auf die Instabilität des Reiches, die Notwendigkeit von Schutz und die Entstehung von Abhängigkeitsverhältnissen zwischen Freien und Mächtigen. Diese Abhängigkeiten, gekennzeichnet durch den Begriff „ingenui in obsquito“, bilden den Grundstein für das entstehende Lehenswesen.
Schlüsselwörter
Lehnswesen, Fürsten, Mittelalter, Feudalismus, Merowinger, Karolingisch, Kommendation, Allodium, Kurfürsten, Goldene Bulle, König, Vasallen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Das deutsche Lehenswesen im Mittelalter
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht das deutsche Lehenswesen im Mittelalter und dessen komplexes Verhältnis zum Fürstenwesen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich das Lehenswesen auf die Position der Fürsten gegenüber dem König auswirkte – stärkte oder schwächte es sie?
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die Wortherkunft und Entwicklung des Lehenswesens, seine Anfänge im merowingischen Reich, das karolingische Lehenswesen und seine Ordnung, die verschiedenen Arten von Fürsten, und die Bedeutung der Goldenen Bulle. Sie beleuchtet auch den Unterschied zwischen Lehen und Allodium (freiem Eigentum).
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, ein Kapitel über das Lehenswesen (inkl. Wortherkunft, Anfänge, Kommendation, karolingisches Lehenswesen, Rangerhöhung der Vasallen und die Lehensordnung), ein Kapitel über Fürsten (inkl. Fürstenarten, Kurfürsten und die Goldene Bulle), und abschließend ein Fazit.
Was sind die zentralen Aspekte des Kapitels über das Lehenswesen?
Das Kapitel zum Lehenswesen untersucht detailliert die etymologische Entwicklung des Begriffs „Lehen“, verfolgt dessen Entwicklung vom „Geliehenen“ zum komplexen System des Feudalismus und Benefizialwesens. Es beschreibt die Anfänge im merowingischen Reich mit dem Fokus auf die Instabilität des Reiches, die Notwendigkeit von Schutz und die daraus resultierenden Abhängigkeitsverhältnisse, die den Grundstein für das Lehenswesen legten.
Welche Bedeutung hat die Goldene Bulle in der Hausarbeit?
Die Goldene Bulle wird im Kapitel über die Fürsten behandelt und spielt eine wichtige Rolle im Verständnis der Machtstrukturen und der Beziehungen zwischen Kaiser und Kurfürsten im Heiligen Römischen Reich.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Lehnswesen, Fürsten, Mittelalter, Feudalismus, Merowinger, Karolingisch, Kommendation, Allodium, Kurfürsten, Goldene Bulle, König, Vasallen.
Was ist das Fazit der Hausarbeit (ohne Detaillierung des Inhalts)?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen und beantwortet die Forschungsfrage nach der Wirkung des Lehenswesens auf die Position der Fürsten gegenüber dem König.
- Quote paper
- Björn Saemann (Author), 2007, Fürstengewalt und Lehenswesen im deutschen Mittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81730