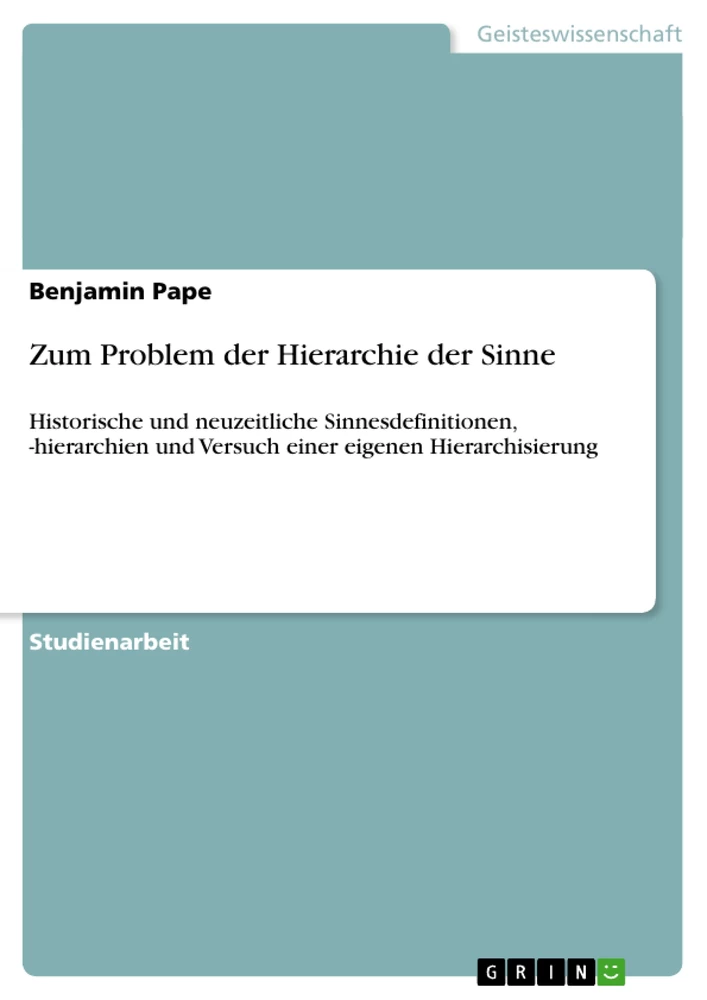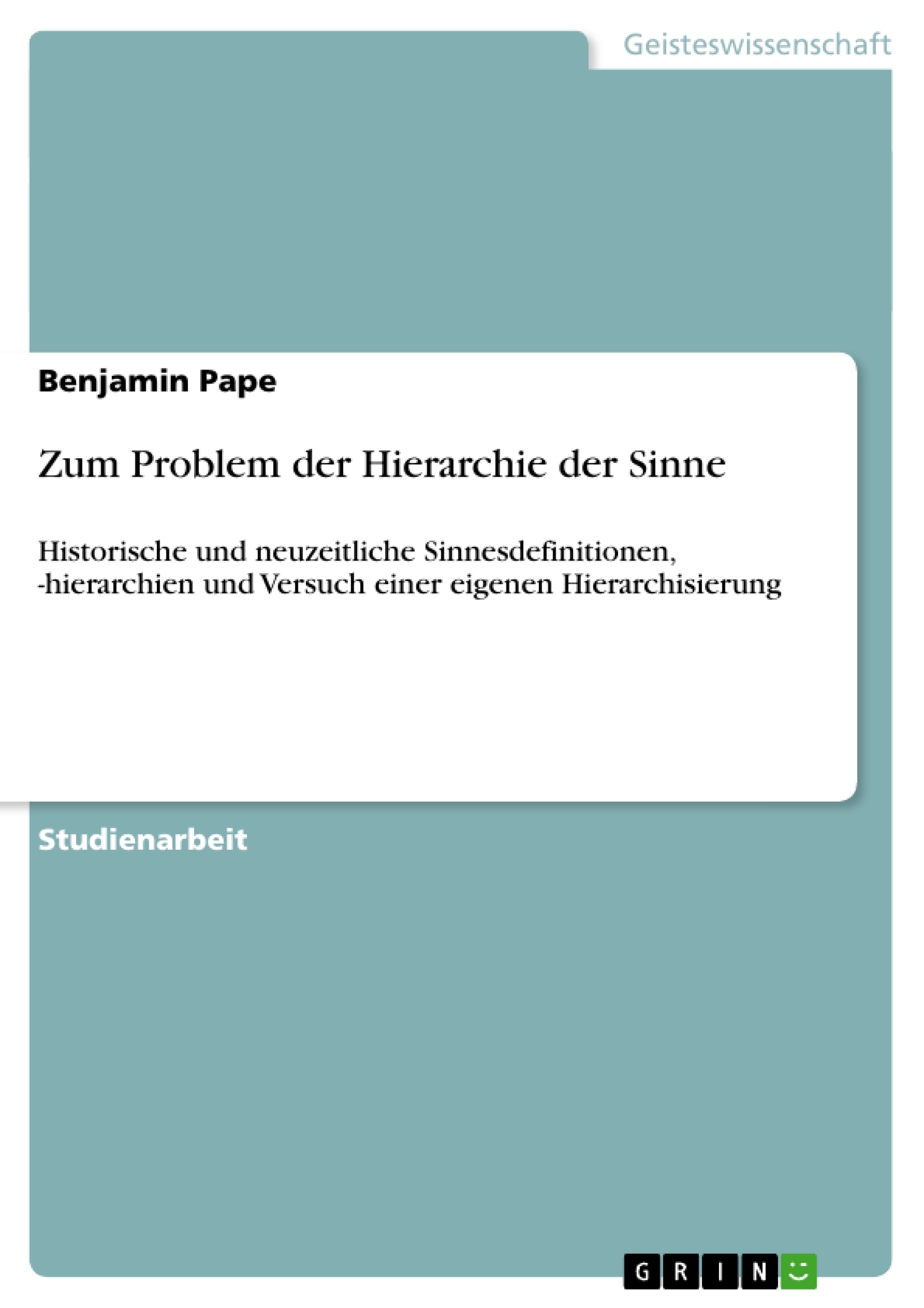In dieser Arbeit soll die Hierarchisierung der Sinneswahrnehmungen des Menschen untersucht und bewertet werden. Das Ziel ist, eine empirisch sinnvolle und möglichst aus allen Richtungen betrachtet akzeptable Gewichtung aller Sinne vorzunehmen. Nach einer Abgrenzung des Begriffs der menschlichen Sinne (Kap. 1.1. und 1.2.) sollen zunächst Hierarchien untersucht werden, die in der Vergangenheit existierten und andere, die auch aktuell existieren (Kap. 2.). Es soll versucht werden, diese in ihren jeweiligen Kontext einzuordnen und in ihrer Motivation zu verstehen. Im Hauptteil soll schließlich eine für die heutige Zeit gültige Hierarchie gefunden werden (Kap. 3.).
Diese Arbeit verzichtet bewusst auf eine reine Auflistung der gegebenen historischen Hierarchisierungen und eine anschließende Aufzählung der Sinne, die jedem einzeln seine Wichtigkeiten und Unwichtigkeiten attestiert. Vielmehr versucht sie, aus den historischen Entwicklungen sowie den wissenschaftlichen Erkenntnissen und vor allem den bisher begangenen Fehlern zu lernen und eine Antwort auf die Frage zu finden, die in anderen Arbeiten zu diesem Thema durch reine Auflistungen und abschließende subjektive Fazite geschickt umschifft wurde: Welche Sinneshierarchie entspricht in der neuzeitlichen westlichen Welt der Realität?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Abgrenzung des Untersuchungsgebiets
- 1.1. Definition der Sinne
- 1.2. Die menschlichen Sinne
- 1.3. Qualität der Wahrnehmung
- 1.4. Abgeleitete Hierarchien
- 2. Historische Hierarchisierungen
- 3. Versuch einer neuzeitlichen Hierarchisierung
- 3.1. Prozesse zwischen Urzeitmensch und Kant
- 3.2. Prozesse im 19. und 20. Jahrhundert
- 3.3. Einheit der Sinne und mögliche Ausfälle
- 3.4. Hierarchisierung nach Anteil an der Wahrnehmung
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht und bewertet die Hierarchisierung der menschlichen Sinneswahrnehmungen mit dem Ziel, eine empirisch sinnvolle und akzeptable Gewichtung aller Sinne zu finden. Sie analysiert historische und aktuelle Sinneshierarchien, ordnet diese in ihren Kontext ein und versucht, daraus eine für die heutige Zeit gültige Hierarchie abzuleiten. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Motivation hinter den verschiedenen Hierarchisierungen und der Vermeidung von subjektiven Einschätzungen.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs der menschlichen Sinne
- Analyse historischer Sinneshierarchisierungen
- Entwicklung einer neuzeitlichen Sinneshierarchie
- Bewertung der Bedeutung einzelner Sinne für die Wahrnehmung
- Einbeziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Vermeidung von Fehlern vorheriger Arbeiten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Abgrenzung des Untersuchungsgebiets: Die Arbeit befasst sich mit der Bewertung der Hierarchisierung menschlicher Sinneswahrnehmungen. Ziel ist die Entwicklung einer empirisch fundierten und breit akzeptierten Gewichtung aller Sinne. Nach der Abgrenzung des Sinnesbegriffs werden historische und aktuelle Hierarchisierungen untersucht, um aus deren Kontext und Motivation eine für die Gegenwart gültige Hierarchie abzuleiten. Im Gegensatz zu rein auflistenden Arbeiten strebt diese Arbeit nach einem tieferen Verständnis der Thematik und Vermeidung subjektiver Schlussfolgerungen.
1.1. Definition der Sinne: Dieser Abschnitt definiert Sinne als die Eingabemechanismen des Körpers, die die Interaktion mit der Umwelt ermöglichen. Die Sinneswahrnehmung, insbesondere der über größere Entfernungen wahrnehmenden Sinne, findet über Medien statt (Luft, Licht etc.). Der Vergleich mit der Informationsverarbeitung in Computern (Tastatur, Maus als Eingaben, Monitor, Drucker als Ausgaben) verdeutlicht das Prinzip. Die Vielfalt von Sinnen im Tierreich wird dargestellt, wobei die Arbeit explizit übersinnliche Wahrnehmungen ausschließt.
1.2. Die menschlichen Sinne: Der Mensch besitzt fünf unstrittige Sinne (Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken), wobei die Physiologie weitere Sinne, insbesondere den Gleichgewichtssinn, differenziert. Die Diskussion über die evolutionäre Entwicklung der Sinne und ihre Abhängigkeit von der Hautoberfläche wird beleuchtet. Obwohl der Gleichgewichtssinn als sechster Sinn betrachtet wird, wird er aufgrund seiner kulturellen Unwichtigkeit und Ersetzbarkeit in der heutigen Zeit in dieser Arbeit nicht gesondert behandelt. Weitere Sinne wie kinästhetische Wahrnehmung und Temperatur-/Schmerzempfinden werden kurz erwähnt, aber nicht detailliert untersucht.
Schlüsselwörter
Sinneswahrnehmung, Sinneshierarchie, historische Sinnesdefinitionen, neuzeitliche Sinneshierarchisierung, menschliche Sinne, Wahrnehmung, Empirie, Evolution.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Hierarchisierung der menschlichen Sinneswahrnehmungen
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit der Untersuchung und Bewertung der Hierarchisierung menschlicher Sinneswahrnehmungen. Das Hauptziel ist die Entwicklung einer empirisch fundierten und breit akzeptierten Gewichtung aller Sinne, die sowohl historische als auch aktuelle Perspektiven berücksichtigt.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert historische und aktuelle Sinneshierarchien, ordnet diese in ihren Kontext ein und versucht, daraus eine für die heutige Zeit gültige Hierarchie abzuleiten. Es wird die Motivation hinter den verschiedenen Hierarchisierungen untersucht und der Fokus liegt auf der Vermeidung subjektiver Einschätzungen. Die Arbeit umfasst die Definition und Abgrenzung des Begriffs der menschlichen Sinne, die Analyse historischer Sinneshierarchisierungen, die Entwicklung einer neuzeitlichen Sinneshierarchie und die Bewertung der Bedeutung einzelner Sinne für die Wahrnehmung.
Wie wird der Begriff „Sinn“ definiert?
Sinne werden als die Eingabemechanismen des Körpers definiert, die die Interaktion mit der Umwelt ermöglichen. Die Sinneswahrnehmung, insbesondere bei den Sinnen mit größerer Reichweite, erfolgt über Medien wie Luft oder Licht. Der Vergleich mit der Informationsverarbeitung in Computern wird zur Veranschaulichung herangezogen. Übersinnliche Wahrnehmungen werden explizit ausgeschlossen.
Welche Sinne werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf die fünf allgemein anerkannten Sinne (Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken). Der Gleichgewichtssinn wird aufgrund seiner kulturellen Unwichtigkeit und Ersetzbarkeit in der heutigen Zeit nicht gesondert behandelt, obwohl seine physiologische Bedeutung anerkannt wird. Weitere Sinne wie kinästhetische Wahrnehmung und Temperatur-/Schmerzempfinden werden kurz erwähnt, aber nicht detailliert untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung mit Abgrenzung des Untersuchungsgebiets, einen Abschnitt zu historischen Hierarchisierungen, einen Abschnitt zur Entwicklung einer neuzeitlichen Hierarchisierung (inkl. Prozessen in verschiedenen Epochen und der Berücksichtigung der Einheit der Sinne und möglicher Ausfälle), und schliesslich ein Fazit. Die Kapitel enthalten detaillierte Analysen und Diskussionen der jeweiligen Themen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Sinneswahrnehmung, Sinneshierarchie, historische Sinnesdefinitionen, neuzeitliche Sinneshierarchisierung, menschliche Sinne, Wahrnehmung, Empirie, Evolution.
Was ist das Ziel der neuzeitlichen Sinneshierarchisierung?
Das Ziel ist die Entwicklung einer empirisch sinnvollen und akzeptablen Gewichtung aller Sinne, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert und Fehler vorheriger Arbeiten vermeidet. Es geht darum, ein tieferes Verständnis der Thematik zu erreichen und subjektive Schlussfolgerungen zu vermeiden.
Wie wird die historische Entwicklung der Sinneshierarchisierungen behandelt?
Die Arbeit analysiert die historischen Sinneshierarchisierungen, um deren Kontext und die dahinterliegende Motivation zu verstehen. Sie untersucht die Entwicklung des Denkens über die Sinne von der Urzeit bis ins 20. Jahrhundert und ordnet die verschiedenen Ansätze in ihren jeweiligen historischen und philosophischen Kontext ein.
- Quote paper
- Benjamin Pape (Author), 2006, Zum Problem der Hierarchie der Sinne, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81677