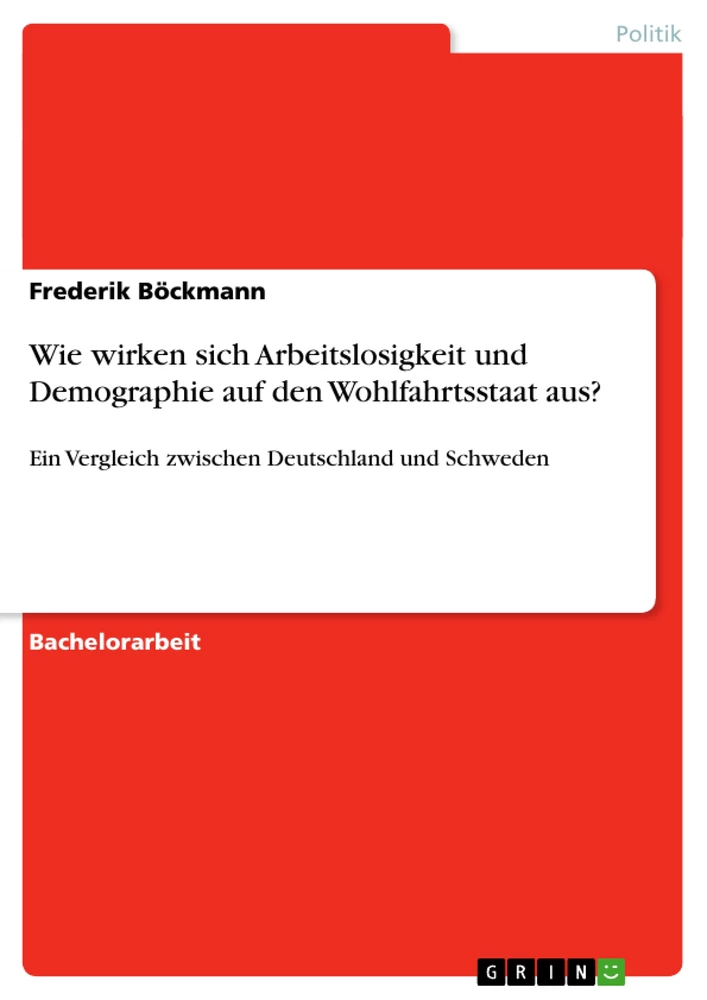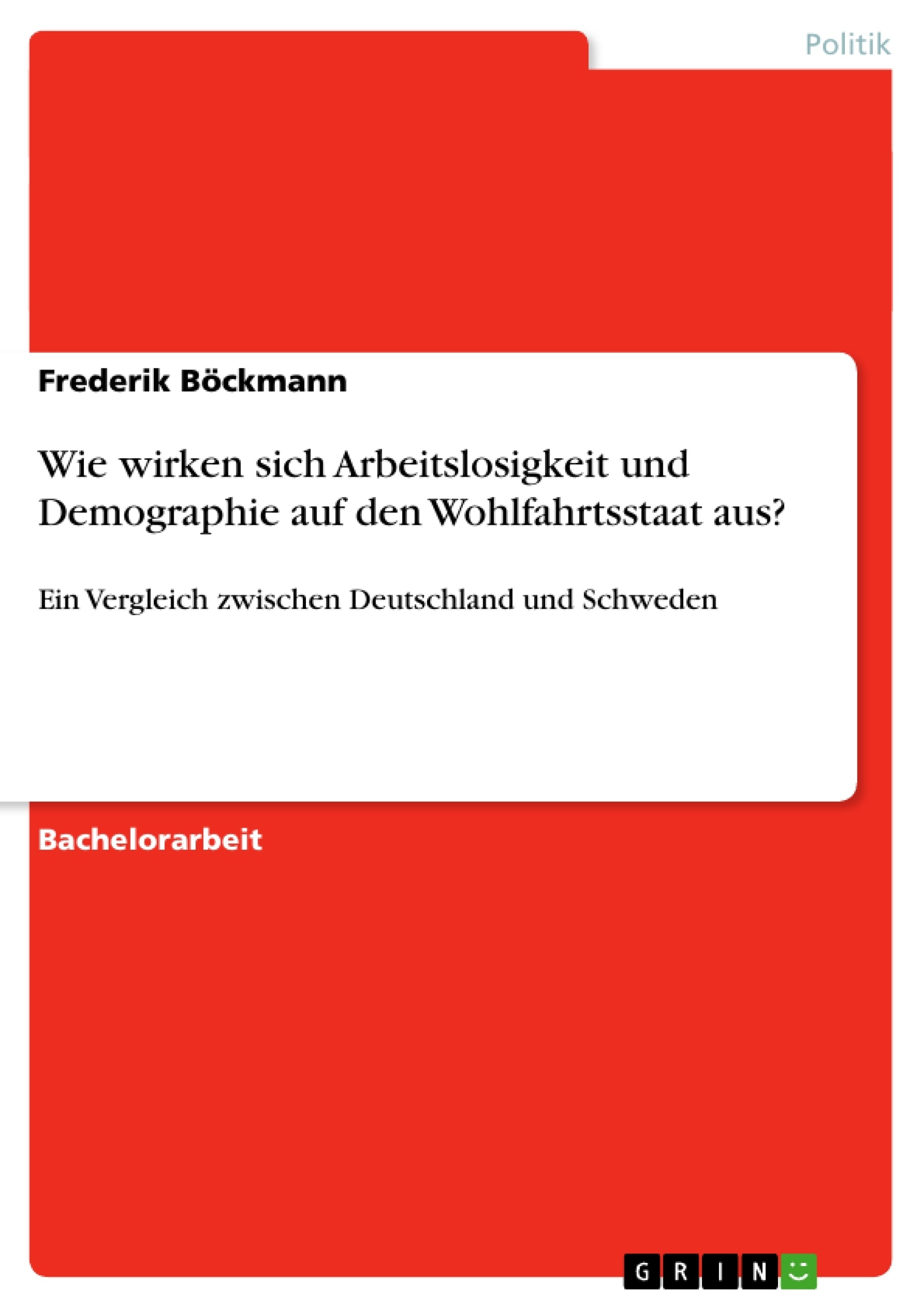Der Wohlfahrtsstaat hatte sich in den letzten Jahren zu einem regelrechten „Renner“ in den Medien gemausert. Auch wenn diese „Euphorie“ von Zeit zu Zeit etwas abebbt, bringen große Wirtschaftsblätter bei aktuellen Anlässen wie der EU-Ratspräsidentschaft in Deutschland noch immer lange Reportagen über EU-Mitglieder wie Dänemark, Schweden, Finnland oder den Niederlanden und überregionale Zeitungen platzieren ganze Serien über Umbauten oder geplante Renovierungen im Gebäudes des Sozialstaats. Denn im Zeichen des Wandels von Wirtschaft und Gesellschaft sind Zukunftsfragen aus guten Gründen zur Diskussion geworden, da Prozesse wirtschaftlichen Wandels selten alle gleich treffen. Mit dem Ausbau des Wohlfahrtsstaates wurden soziale Probleme verringert, der Problemdruck sank. Gleichzeitig wurde sichtbar, dass der Wohlfahrtsstaat neue Ungleichheiten und Schieflagen hervorruft, wenn er seine sozialen, politischen und wirtschaftlichen Ziele verfolgt. Zweifelsohne steht auch der Wohlfahrtsstaat in Deutschland vor gravierenden Herausforderungen, ebenso wie der Wohlfahrtsstaat in Schweden. Schweden war lange Zeit der „Promi“ unter den Wohlfahrtsstaaten, wurde dann jedoch auf Grund von explodierenden Staatsschulden und einer steigenden Inflation als „kranker Mann Europas“ (Schmid 1989) tituliert und sein Ende als Wohlfahrtsstaat prognostiziert. Doch ob Sozial- oder Christdemokraten – in Deutschland wird Schweden mittlerweile immer wieder als Reformbild gepriesen. Ein Modelland zum Erhalt des Sozialstaats sei es; und zum Beleg wird gern die Arbeitslosenquote von vergleichsweise geringen 4,9% angeführt. Aber ist Schweden auch wirklich ein Vorbild für Deutschland?
In meiner Bachelor’s Thesis wird dieser Frage nachgegangen. Vordergründig möchte ich jedoch untersuchen, welche Auswirkungen Arbeitslosigkeit und die Demographie auf die beiden Wohlfahrtsstaaten Deutschland und Schweden haben, welche Maßnahmen sich daraus wieder ergeben und untersuchen, ob sich Gemeinsamkeiten respektive Unterschiede zwischen einem konservativ (Deutschland) und sozialdemokratisch (Schweden) geführten Staat heraus kristallisieren lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was sind Wohlfahrtsstaaten?
- Historische Grundlagen
- Deutschland – der konservative Wohlfahrtsstaat
- Schweden – der sozialdemokratische Wohlfahrtsstaat
- Arbeitslosigkeit
- Deutschland
- Verfestigte Arbeitslosigkeit
- Auswirkungen der Arbeitslosigkeit
- Konzepte und Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit
- Schweden
- Aktive Arbeitsmarktpolitik
- Der Abschied vom Ziel Vollbeschäftigung
- Der Umbau des Arbeitsmarktes
- Deutschland
- Demographie
- Deutschland
- Strukturveränderung der Bevölkerung
- Folgen und Maßnahmen des demographischen Wandels
- Schweden
- Strukturveränderung der Bevölkerung
- Vom Zwei- zum Drei-Säulen-Modell
- Deutschland
- Gibt es einen Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Demographie?
- Ist das schwedische Modell ein Vorbild für Deutschland?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit und Demographie auf die beiden Wohlfahrtsstaaten Deutschland und Schweden. Im Mittelpunkt der Analyse stehen die jeweils getroffenen Maßnahmen und die Frage, ob sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen einem konservativ (Deutschland) und sozialdemokratisch (Schweden) geführten Staat herauskristallisieren lassen. Dabei wird zunächst die Definition des Wohlfahrtsstaates und die Entwicklung der beiden Länder in einem kurzen historischen Überblick beleuchtet. Der Fokus liegt im Hauptteil auf den Auswirkungen der Arbeitslosigkeit und des demographischen Wandels. Schließlich wird die Frage beantwortet, ob der schwedische Wohlfahrtsstaat ein Vorbild für Deutschland sein könnte.
- Die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf die Wohlfahrtsstaaten Deutschland und Schweden
- Die verschiedenen Strategien zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in beiden Ländern
- Der Einfluss des demographischen Wandels auf die Wohlfahrtsstaaten Deutschland und Schweden
- Die jeweiligen Rentenreformen in Deutschland und Schweden
- Der mögliche Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Demographie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert einen Überblick über die Forschungsfrage und die Vorgehensweise der Arbeit. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Definition und den verschiedenen Typen des Wohlfahrtsstaates. Kapitel 3 bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung der Sozialpolitik in Deutschland und Schweden. Die Kapitel 4 und 5 analysieren die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit und Demographie auf die beiden Länder sowie die dazu getroffenen Maßnahmen. Kapitel 6 untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Demographie besteht. Das abschließende Kapitel 7 beantwortet die Frage, ob das schwedische Modell ein Vorbild für Deutschland sein könnte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Wohlfahrtsstaat, Arbeitslosigkeit, Demographie, Sozialpolitik, Rentenreform, aktiver Arbeitsmarktpolitik und Vergleichende Wohlfahrtsanalyse. Im Kontext dieser Themen werden wichtige Konzepte wie konservative und sozialdemokratische Staatsmodelle, Generationenvertrag, Frühverrentung, Strukturwandel, Vollbeschäftigung und das Zwei- und Drei-Säulen-Modell der Rentenversicherung beleuchtet. Die Analyse konzentriert sich auf Deutschland und Schweden, wobei die beiden Länder anhand ihrer jeweiligen politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen im internationalen Vergleich betrachtet werden.
- Quote paper
- Frederik Böckmann (Author), 2007, Wie wirken sich Arbeitslosigkeit und Demographie auf den Wohlfahrtsstaat aus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81654