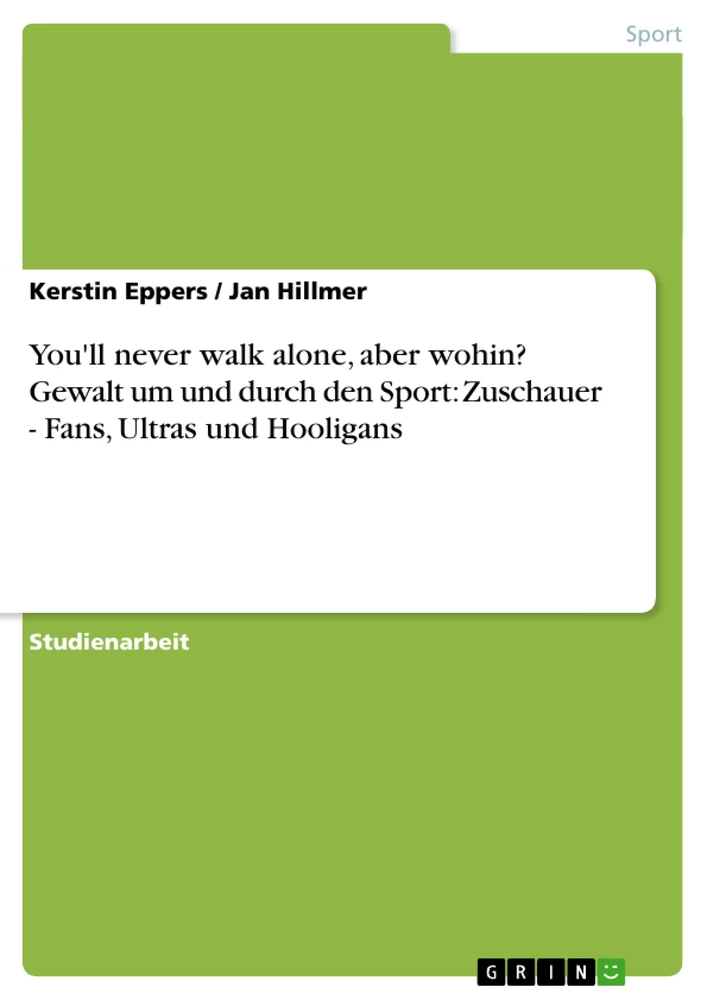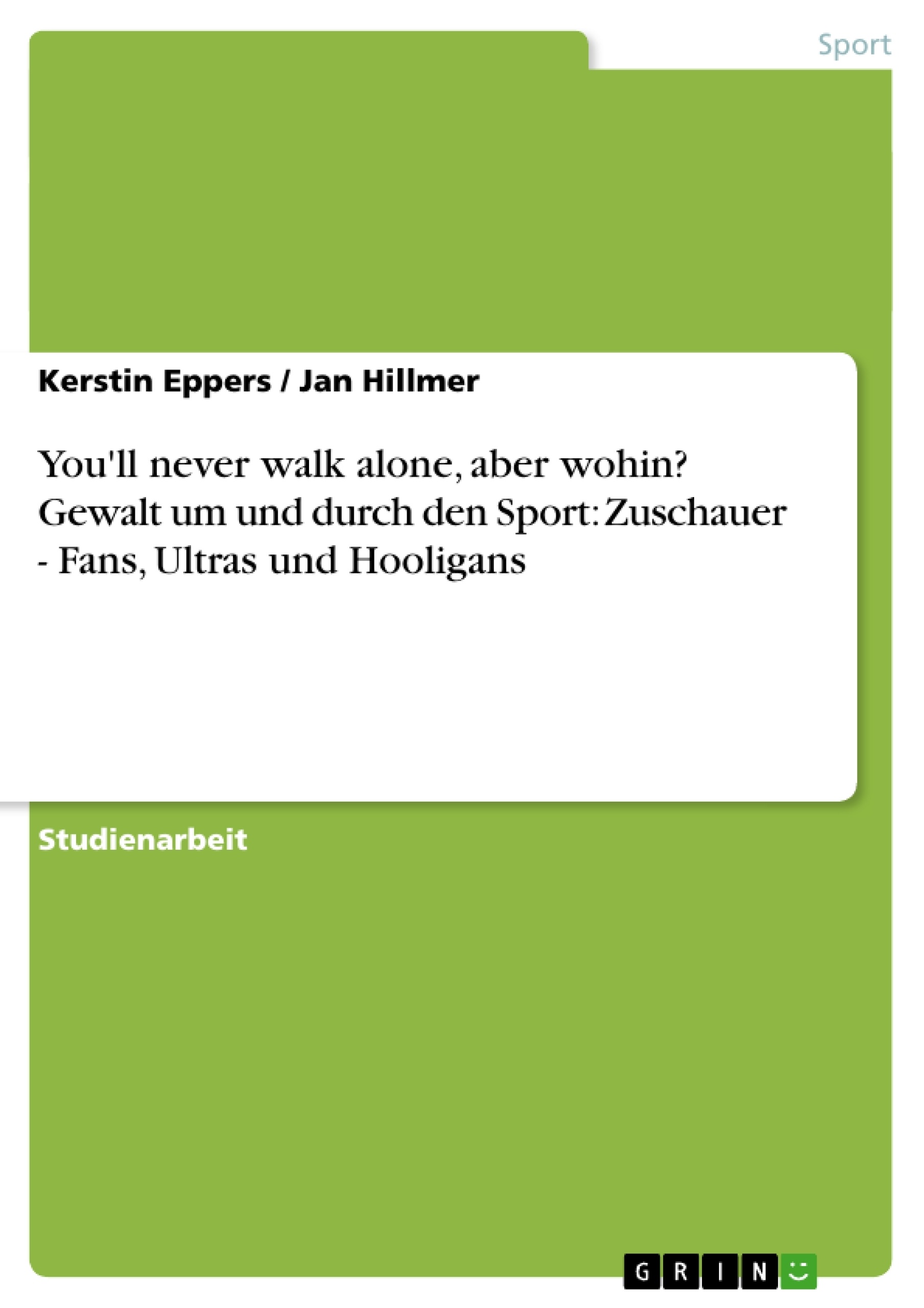Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und vielen außereuropäischen Ländern ist der Fußballsport diejenige Sportart, die die meisten Zuschauer anzieht. Jedes Wochenende strömen Millionen von Menschen in die Fußballstadien. Für viele von ihnen hat die Beschäftigung mit dem Fußballsport, die
schicht-, alters- und zunehmend auch geschlechtsunspezifisch erfolgt, die Bedeutung einer regelmäßigen oder sogar der wichtigsten Freizeitbetätigung.
Auch in Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen nimmt die Berichterstattung einen breiten Raum ein. Für spektakulären Stoff sorgen dabei nicht nur die aktiven Spieler auf dem Rasen, sondern auch die Gruppe der Fußballfans. Sie stehen besonders dann im Blickpunkt der Öffentlichkeit, wenn es um eines der bedeutendsten Probleme des Sports geht: um die gewalttätigen Zuschauerausschreitungen.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung zum Thema
- Begriffsabgrenzung
- Begriffsabgrenzung nach Heitmeyer und Peter
- Der konsumorientierte Fan
- Der fußballzentrierte Fan
- Der erlebnisorientierte Fan
- Begriffsbestimmung des Fans in bezug auf das Gewaltpotential
- Kategorie A
- Kategorie B
- Kategorie C
- Hooligans
- Begriffsherkunft
- Historische Entwicklung
- Auftreten der Hooligans
- Hooligans in Deutschland
- Hooligans in Europa
- Britische Hooligans
- Italienische Hooligans
- Belgische Hooligans
- Veränderung der Hooliganszene
- Ultras
- Selbstverständnis der Ultras
- Ultras in Italien
- Diskussionsergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Gewalt unter Fußballzuschauern. Ziel ist es, verschiedene Fan-Typen zu differenzieren und deren jeweiliges Gewaltpotential zu beleuchten. Der Fokus liegt auf Hooligans und Ultras als besonders gewaltbereite Gruppen.
- Kategorisierung von Fußballfans nach ihrem Gewaltpotential
- Charakterisierung von Hooligans und ihrer historischen Entwicklung
- Analyse des Selbstverständnisses und des Verhaltens von Ultras
- Untersuchung der Gewaltproblematik im Fußball im europäischen Kontext
- Diskussion möglicher Lösungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Hinführung zum Thema: Die Einleitung beschreibt die immense Popularität des Fußballs in Europa und die damit verbundene Problematik gewalttätiger Zuschauer. Sie kündigt die Struktur der Arbeit an, welche die Begriffsabgrenzung von Fußballfans, die Auseinandersetzung mit Hooligans und Ultras sowie die Präsentation von Diskussionsergebnissen und Lösungsansätzen umfasst. Die Bedeutung von Gewalt bei Fußballspielen wird hervorgehoben und als zentrale Fragestellung der Arbeit positioniert.
Begriffsabgrenzung: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Typen von Fußballfans, basierend auf dem Schema von Heitmeyer und Peter. Es unterscheidet zwischen konsumorientierten, fußballzentrierten und erlebnisorientierten Fans, die sich durch ihr Verhältnis zum Fußball, ihre Vereinsbindung und ihr Gewaltpotential unterscheiden. Konsumorientierte Fans sehen Fußball als reine Unterhaltung, fußballzentrierte Fans identifizieren sich stark mit ihrem Verein, und erlebnisorientierte Fans suchen vor allem nach Spannung und sozialen Kontakten. Die Bedeutung dieser Unterscheidung für das Verständnis von Gewalt im Fußball wird herausgestellt, wobei betont wird, dass es sich um fließende Übergänge und Mischformen handelt.
Hooligans: Dieses Kapitel behandelt die Hooligan-Szene, ihre historischen Wurzeln, ihr Auftreten, und ihre Entwicklung in Deutschland und Europa. Es beleuchtet die britische, italienische und belgische Hooligan-Szene als Beispiele für unterschiedliche Ausprägungen. Die Entstehung und Veränderung der Hooligan-Kultur wird erörtert, wobei kulturelle, soziale und politische Faktoren berücksichtigt werden. Der Fokus liegt auf dem gewalttätigen Verhalten und den Ursachen dafür, inklusive der Entwicklung über die Jahre.
Ultras: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Selbstverständnis und der Kultur der Ultras. Es untersucht deren Rolle in der italienischen Fußballszene als Beispiel für eine besonders organisierte und gewaltbereite Fangemeinde. Der Fokus liegt auf der Gruppendynamik, der politischen Ausrichtung und der Gewaltausübung der Ultras. Der Unterschied zu Hooligans wird vermutlich thematisiert, wobei Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Verhalten und der Motivation hervorgehoben werden.
Schlüsselwörter
Fußballgewalt, Fußballfans, Hooligans, Ultras, Fan-Kategorisierung, Gewaltpotential, Vereinstreue, Erlebnisorientierung, Soziale Identifikation, Gewaltprävention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Gewalt unter Fußballzuschauern"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Gewalt unter Fußballzuschauern. Sie differenziert verschiedene Fan-Typen und beleuchtet deren jeweiliges Gewaltpotential, mit einem Fokus auf Hooligans und Ultras als besonders gewaltbereite Gruppen.
Welche Fan-Typen werden unterschieden?
Die Arbeit kategorisiert Fußballfans nach ihrem Gewaltpotential, basierend auf dem Schema von Heitmeyer und Peter. Es werden konsumorientierte, fußballzentrierte und erlebnisorientierte Fans unterschieden, die sich in ihrem Verhältnis zum Fußball, ihrer Vereinsbindung und ihrem Gewaltpotential unterscheiden. Die Arbeit betont jedoch, dass es fließende Übergänge und Mischformen gibt.
Was sind Hooligans und wie werden sie in der Arbeit behandelt?
Das Kapitel über Hooligans behandelt die Hooligan-Szene, ihre historischen Wurzeln, ihr Auftreten und ihre Entwicklung in Deutschland und Europa. Es beleuchtet verschiedene nationale Szenen (britisch, italienisch, belgisch) und erörtert die Entstehung und Veränderung der Hooligan-Kultur unter Berücksichtigung kultureller, sozialer und politischer Faktoren. Der Fokus liegt auf dem gewalttätigen Verhalten und seinen Ursachen.
Was sind Ultras und wie werden sie in der Arbeit behandelt?
Das Kapitel über Ultras befasst sich mit dem Selbstverständnis und der Kultur der Ultras, insbesondere in der italienischen Fußballszene. Es untersucht deren Rolle als besonders organisierte und gewaltbereite Fangemeinde, die Gruppendynamik, die politische Ausrichtung und die Gewaltausübung. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu Hooligans werden herausgestellt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Kategorisierung von Fußballfans nach ihrem Gewaltpotential, die Charakterisierung von Hooligans und ihrer historischen Entwicklung, die Analyse des Selbstverständnisses und des Verhaltens von Ultras, die Untersuchung der Gewaltproblematik im europäischen Kontext und die Diskussion möglicher Lösungsansätze.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu: Hinführung zum Thema, Begriffsabgrenzung (inkl. Unterteilung nach Heitmeyer und Peter), Hooligans (inkl. internationaler Vergleiche), Ultras und Diskussionsergebnisse.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fußballgewalt, Fußballfans, Hooligans, Ultras, Fan-Kategorisierung, Gewaltpotential, Vereinstreue, Erlebnisorientierung, Soziale Identifikation, Gewaltprävention.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Hinführung zum Thema, gefolgt von einer Begriffsabgrenzung verschiedener Fan-Typen. Anschließend werden Hooligans und Ultras ausführlich behandelt, bevor die Arbeit mit Diskussionsergebnissen und möglichen Lösungsansätzen abschließt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, verschiedene Fan-Typen zu differenzieren und deren jeweiliges Gewaltpotential zu beleuchten. Sie soll dazu beitragen, die Gewaltproblematik im Fußball besser zu verstehen und mögliche Lösungsansätze zu diskutieren.
- Quote paper
- Kerstin Eppers (Author), Jan Hillmer (Author), 2002, You'll never walk alone, aber wohin? Gewalt um und durch den Sport: Zuschauer - Fans, Ultras und Hooligans, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81650