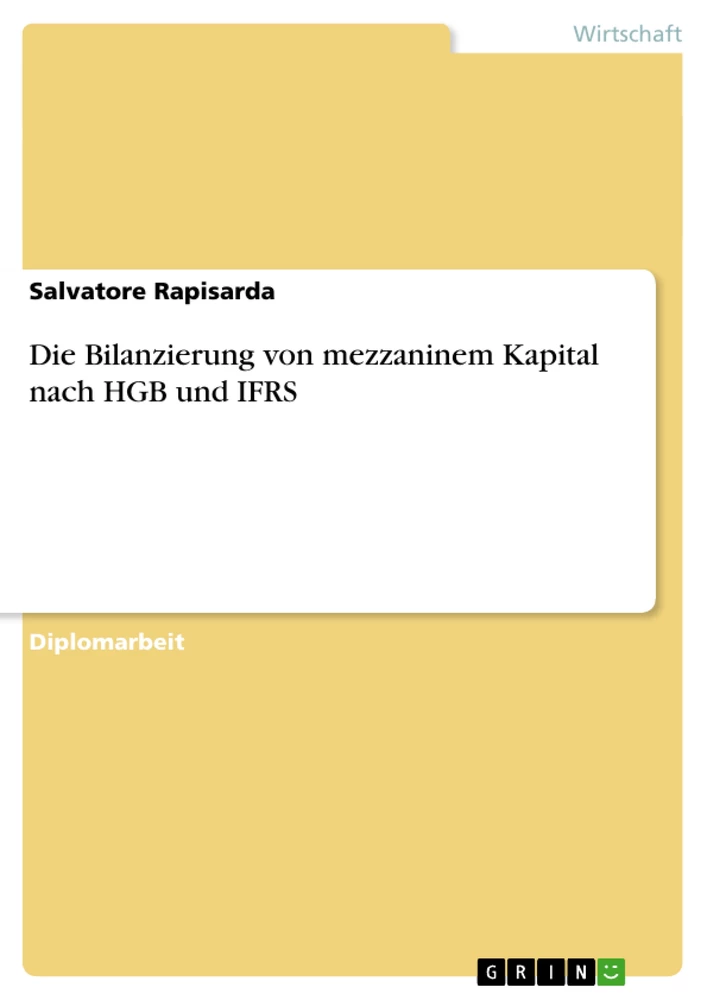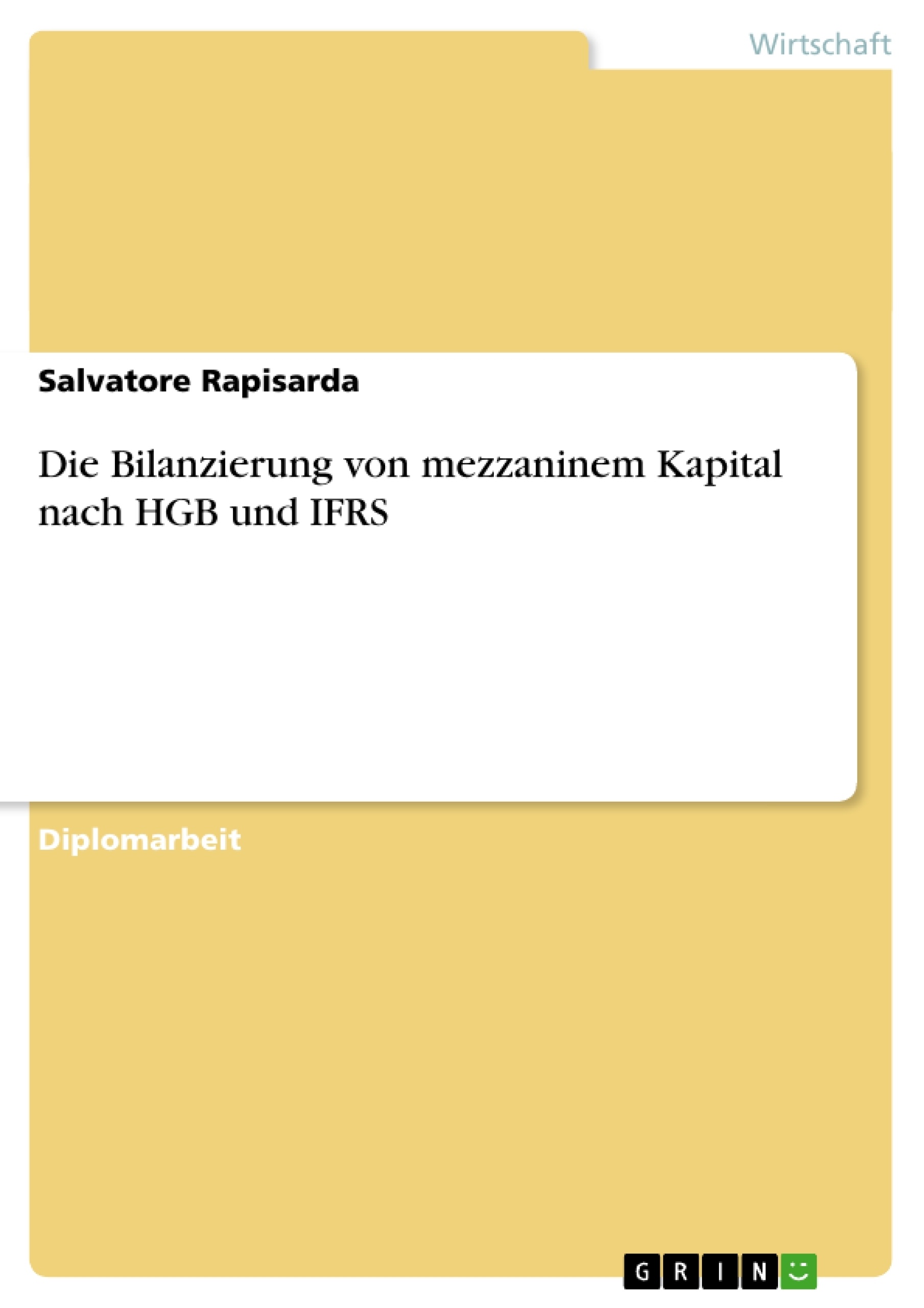Mit den mezzaninen Finanzierungsinstrumenten wird einem Unternehmen von außen Kapital zugeführt, das zwar bilanziell nicht immer, wirtschaftlich und damit im Rating-Prozess aber schon, wie Eigenkapital anzusehen ist. Die vorliegende Arbeit widmet sich der Frage, ob mezzanines Kapital nach HGB und IAS als Eigenkapital oder Fremdkapital in der Bilanz anzusetzen ist. Hierfür wird in Kapitel 2 auf das Wesen von mezzaninem Kapital, welches auch Mezzanine-Kapital genannt wird, eingegangen. Da-bei wird sowohl ein grundlegendes Verständnis für den in der Arbeit verwendeten Beg-riff des Mezzanine-Kapital gegeben, als auch die Vielzahl der existierenden Definitio-nen von mezzaninem Kapital und deren historische Entwicklung aufgezeigt, die eine präzise Abgrenzung von mezzaninem Kapital nicht zulassen. Daneben zeigt das Kapitel 2 auch die Vor- und Nachteile von Mezzanine-Kapital und weist auf die Investitionskri-terien sowie die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten von mezzaninem Kapital hin. Das Kapitel 3 stellt die für die Bilanzierung von Mezzanine-Kapital grundlegende Zuordnung von Kapital in Eigen- und Fremdkapital nach idealtypischen Grundsätzen sowie den Regelungen nach HGB und IFRS dar. Dabei werden die jeweiligen Abgren-zungskriterien und die Kapitaldefinitionen sowie die bilanzielle Behandlung in der je-weiligen Rechnungslegungsnorm verdeutlicht und die Problematik der Kapitalabgren-zung aufgezeigt. Aufbauend auf dem in Kapitel 3 gegebenen Verständnis von Eigen- und Fremdkapital wird in Kapitel 4 auf einzelne Finanzierungsinstrumente, die unter dem Begriff Mezzanine-Kapital zu subsumieren sind, eingegangen und deren bilanzielle Behandlung aufgezeigt. Dabei werden die unterschiedlichen Bilanzansätze sowie diver-gierende Meinungen in der Literatur diskutiert und die Problematik im Zusammenhang mit der Abgrenzung von Eigen- und Fremdkapital insbesondere durch die scharfe Ab-grenzung durch IAS 32 verdeutlicht. Abschließend werden die Ergebnisse der Arbeit im Kapitel 5 zusammengefasst und ein Resümee gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Allgemeine Definition von Mezzanine-Kapital
- 2.1 Charakteristika von Mezzanine-Kapital
- 2.1.1 Verpflichtungserklärungen als Bestandteil von Mezzanine-Kapital
- 2.1.2 Vergütungsstruktur der Mezzanine-Finanzierung
- 2.2 Abgrenzung von Mezzanine-Kapital vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung
- 2.2.1 Public-Mezzanine vs. Private-Mezzanine
- 2.2.2 Mezzanine-Kapital im weiteren Sinne vs. Mezzanine-Kapital im engeren Sinne
- 2.3 Die Abgrenzung von Mezzanine-Kapital aus bilanzieller Sicht
- 2.3.1 Mezzanine-Kapital mit Eigenkapitalcharakter
- 2.3.2 Mezzanine-Kapital mit Fremdkapitalcharakter
- 2.3.3 Hybride Formen von Mezzanine-Kapital
- 2.4 Vor- und Nachteile einer Mezzanine-Kapital Finanzierung
- 2.5 Investitionskriterien
- 2.6 Anwendungsgebiete von Mezzanine-Kapital
- 3. Kapitalabgrenzung im Jahresabschluss
- 3.1 Idealtypisches Eigen- und Fremdkapital
- 3.2 Eigen- und Fremdkapital nach HGB
- 3.3.1 Materieller Eigenkapitalbegriff als Abgrenzungskriterium
- 3.3.2 Fremdkapital nach HGB
- 3.3.2.1 Bilanzieller Ausweis von Fremdkapital nach HGB
- 3.3.2.2 Bewertung von Fremdkapital nach HGB
- 3.4 Eigen- und Fremdkapital nach IFRS
- 3.4.1 Abgrenzung von Eigen- und Fremdkapital nach IAS 32
- 3.4.2 Eigenkapital nach IFRS
- 3.4.3 Bilanzieller Ausweis von Eigenkapital nach IFRS
- 3.4.4 Fremdkapital nach IFRS
- 3.4.4.1 Bilanzieller Ausweis von Fremdkapital nach IFRS
- 3.4.4.2 Bewertung von Fremdkapital nach IFRS
- 4. Bewertung und bilanzieller Ansatz von Mezzanine-Kapital
- 4.1 Stille Gesellschaft
- 4.1.1 Rechtsnatur der stillen Gesellschaft
- 4.1.2 Ausgestaltung der atypischen stillen Gesellschaft
- 4.1.3 Bilanzierung nach HGB
- 4.1.3.1 Bilanzielle Abgrenzungskriterien der stillen Einlage
- 4.1.3.2 Passivierung des Einlageguthabens
- 4.1.3.2.1 Passivierung der Einlage von fremdkapitalnahen stillen Gesellschaften ohne Verlustbeteiligung
- 4.1.3.2.2 Passivierung der Einlage von fremdkapitalähnlichen stillen Gesellschaften mit einer Verlustbeteiligung
- 4.1.3.2.3 Passivierung der Einlage von eigenkapitalähnlichen stillen Gesellschaften
- 4.1.3.3 Aktivierung der Einlageleistung des stillen Gesellschafters
- 4.1.3.4 Bilanzielle Behandlung von Gewinnen und Verlusten des stillen Gesellschafters und Abbildung in der GuV nach HGB
- 4.1.3.5 Anhangsangaben im Rahmen einer stillen Gesellschaft
- 4.1.4 Bilanzierung nach IFRS
- 4.1.4.1 Bewertung der stillen Gesellschaft nach IFRS
- 4.1.4.2 Bilanzielle Behandlung von Gewinnen und Verlusten des stillen Gesellschafters und Abbildung in der GuV nach IFRS
- 4.1.4.3 Die stille Gesellschaft als Compound Instrument nach IFRS
- 4.1.4.4 Anhangsangaben der stillen Gesellschaft nach IFRS
- 4.2 Genussrechte
- 4.2.1 Bilanzierung nach HGB
- 4.2.1.1 Anforderungen für die Bilanzierung im Eigenkapital nach HGB
- 4.2.1.2 Bilanzausweis von Genussrechten nach HGB
- 4.2.1.3 Bilanzierung von Genussrechtskapital in einem Sonderposten
- 4.2.1.4 Vergütung und Verlustbeteiligung von Genussrechten und Abbildung in der GuV nach HGB
- 4.2.1.5 Bilanzielle Behandlung von Genussrechtskapital-Emissionen mit Agio- bzw. Disagio
- 4.2.1.6 Anhangsangaben bei Genussrechten nach HGB
- 4.2.2 Bilanzierung nach IFRS
- 4.2.2.1 Kriterien für die bilanzielle Zuordnung von Genussrechtskapital nach IFRS
- 4.2.2.2 Bilanzausweis von Genussrechten nach IFRS
- 4.2.2.3 Zugangs- und Folgebewertung von Genussrechten nach IFRS
- 4.2.2.4 Vergütung und Verlustbeteiligung von Genussrechten und Abbildung in der GuV nach IFRS
- 4.2.2.5 Zusammengesetzte Finanzinstrumente nach IFRS am Beispiel der Genussrechte
- 4.2.2.6 Anhangsangaben bei Genussrechten nach IFRS
- 4.3 Wandelschuldverschreibungen
- 4.3.1 Bilanzierung von Wandelanleihen nach HGB
- 4.3.1.1 Bilanzielle Behandlung eines offenen Agios nach HGB
- 4.3.1.2 Bilanzielle Behandlung eines verdeckten Agios nach HGB
- 4.3.1.3 Bilanzielle Auswirkungen bei Ausübung einer Wandeloption
- 4.3.1.4 Anhangsangaben bei Wandelschuldverschreibungen nach HGB
- 4.3.2 Bilanzierung nach IFRS
- 4.3.2.1 Abgrenzungskriterien nach IFRS
- 4.3.2.2 Bilanzieller Ausweis und Bewertung nach IFRS
- 4.3.2.3 Bilanzieller Ausweis und Bewertung des Wandlungsrechts im Fremdkapital nach IFRS
- 4.3.2.4 Anhangsangaben bei zusammengesetzten Finanzinstrumenten nach IFRS
- 4.4 Nachrangdarlehen, Verkäuferdarlehen und Partiarisches Darlehen
- 4.4.1 Bilanzielle Darstellung von Nachrangdarlehen, Verkäuferdarlehen und Partiarisches Darlehen nach HGB
- 4.4.2 Bilanzieller Darstellung von Nachrangdarlehen, Verkäuferdarlehen und Partiarisches Darlehen nach IFRS
- 5. Zusammenfassung der Ergebnisse und kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Bilanzierung von Mezzanine-Kapital nach HGB und IFRS. Ziel ist es, die unterschiedlichen bilanzrechtlichen Behandlungen dieser hybriden Finanzierungsform zu analysieren und zu vergleichen. Die Arbeit beleuchtet die komplexen Abgrenzungskriterien zwischen Eigen- und Fremdkapital im Kontext von Mezzanine-Finanzierungen.
- Abgrenzung von Mezzanine-Kapital von Eigen- und Fremdkapital
- Bilanzierung von Mezzanine-Kapital nach HGB
- Bilanzierung von Mezzanine-Kapital nach IFRS
- Vergleich der Bilanzierungsmethoden nach HGB und IFRS
- Analyse verschiedener Instrumente des Mezzanine-Kapitals (Stille Gesellschaften, Genussrechte, Wandelanleihen)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Diplomarbeit ein und beschreibt die Relevanz der Bilanzierung von Mezzanine-Kapital im Kontext von Unternehmenfinanzierungen. Es skizziert den Aufbau und die Forschungsfragen der Arbeit.
2. Allgemeine Definition von Mezzanine-Kapital: Dieses Kapitel definiert Mezzanine-Kapital und beschreibt seine charakteristischen Merkmale. Es differenziert zwischen verschiedenen Arten von Mezzanine-Kapital (Public vs. Private, enger vs. weiterer Sinn) und beleuchtet seine Abgrenzung von reinem Eigen- und Fremdkapital aus theoretischer Perspektive. Die unterschiedlichen Ausprägungen und ihre jeweiligen Implikationen für die Bilanzierung werden eingehend betrachtet. Die Kapitelteil zu den Vor- und Nachteilen der Mezzanine-Finanzierung stellt die Vorteile für Unternehmen und Investoren gegenüber und liefert fundierte Argumente für die Wahl dieser Finanzierungsform in bestimmten Situationen. Die Ausführungen zu den Anwendungsgebieten liefern detaillierte Beispiele aus der Praxis.
3. Kapitalabgrenzung im Jahresabschluss: Das Kapitel erläutert die grundlegenden Prinzipien der Eigen- und Fremdkapitalabgrenzung nach HGB und IFRS. Es beschreibt detailliert die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften und deren Anwendung auf die Abgrenzungsproblematik im Jahresabschluss. Der materielle Eigenkapitalbegriff nach HGB und die entsprechenden Kriterien der IAS 32 nach IFRS werden im Detail analysiert. Die Unterschiede in der Abgrenzung und den jeweiligen Ausweisformen in der Bilanz werden hervorgehoben und kritisch bewertet. Die Kapitelteile zu Eigen- und Fremdkapital nach HGB und IFRS stellen die jeweiligen rechtlichen Rahmenbedingungen dar und beleuchten die Unterschiede in der Ausgestaltung und Bewertung.
4. Bewertung und bilanzieller Ansatz von Mezzanine-Kapital: Dieser zentrale Abschnitt widmet sich der konkreten Bilanzierung von Mezzanine-Kapital unter Berücksichtigung verschiedener Finanzinstrumente. Stille Gesellschaften, Genussrechte und Wandelanleihen werden jeweils einzeln analysiert, wobei die bilanzrechtlichen Vorschriften nach HGB und IFRS detailliert dargestellt und verglichen werden. Für jedes Instrument werden die jeweiligen Bewertungsmethoden und Ausweisformen in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erörtert. Die einzelnen Unterkapitel beleuchten die spezifischen Herausforderungen der Bilanzierung der jeweiligen Finanzinstrumente und die Interpretation der rechtlichen Bestimmungen im Kontext von Mezzanine-Kapital. Die Kapitelteile zu den Anhangsangaben unterstreichen die Bedeutung der Transparenz und Vollständigkeit der Informationen für den Jahresabschluss.
Schlüsselwörter
Mezzanine-Kapital, Bilanzierung, HGB, IFRS, Eigenkapital, Fremdkapital, Stille Gesellschaft, Genussrechte, Wandelanleihen, hybride Finanzinstrumente, Abgrenzungskriterien, Bewertung, Jahresabschluss.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Bilanzierung von Mezzanine-Kapital nach HGB und IFRS
Was ist der Gegenstand der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Bilanzierung von Mezzanine-Kapital nach den deutschen Handelsgesetzbuch (HGB) und den International Financial Reporting Standards (IFRS). Sie analysiert und vergleicht die unterschiedlichen bilanzrechtlichen Behandlungen dieser hybriden Finanzierungsform und beleuchtet die komplexen Abgrenzungskriterien zwischen Eigen- und Fremdkapital in diesem Kontext.
Welche Arten von Mezzanine-Kapital werden behandelt?
Die Arbeit untersucht verschiedene Instrumente des Mezzanine-Kapitals, darunter Stille Gesellschaften, Genussrechte und Wandelanleihen. Es wird zwischen Public und Private Mezzanine sowie Mezzanine-Kapital im engeren und weiteren Sinne unterschieden. Die verschiedenen Ausprägungen und ihre Implikationen für die Bilanzierung werden detailliert betrachtet.
Wie wird Mezzanine-Kapital von Eigen- und Fremdkapital abgegrenzt?
Die Arbeit erläutert die Abgrenzung von Mezzanine-Kapital von reinem Eigen- und Fremdkapital sowohl aus theoretischer als auch aus bilanzieller Sicht. Es werden die jeweiligen Abgrenzungskriterien nach HGB und IFRS detailliert beschrieben und verglichen. Die Kapitel zu Eigen- und Fremdkapital nach HGB und IFRS beleuchten die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Unterschiede in der Ausgestaltung und Bewertung.
Wie wird Mezzanine-Kapital nach HGB bilanziert?
Die Diplomarbeit beschreibt die bilanzrechtliche Behandlung von Mezzanine-Kapital nach HGB für Stille Gesellschaften, Genussrechte und Wandelanleihen. Sie erklärt die jeweiligen Bewertungsmethoden, Ausweisformen in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Anforderungen an die Anhangangaben.
Wie wird Mezzanine-Kapital nach IFRS bilanziert?
Ähnlich wie bei HGB, wird die bilanzrechtliche Behandlung von Mezzanine-Kapital nach IFRS für die genannten Finanzinstrumente detailliert dargestellt. Die Arbeit vergleicht die IFRS-Vorschriften mit den HGB-Vorschriften und hebt die Unterschiede hervor. Die Bewertung, der bilanzielle Ausweis und die Anhangangaben nach IFRS werden ebenfalls erläutert.
Welche Rolle spielen Stille Gesellschaften, Genussrechte und Wandelanleihen?
Stille Gesellschaften, Genussrechte und Wandelanleihen werden als zentrale Instrumente des Mezzanine-Kapitals einzeln analysiert. Für jedes Instrument werden die spezifischen Herausforderungen der Bilanzierung und die Interpretation der rechtlichen Bestimmungen im Kontext von Mezzanine-Kapital ausführlich dargestellt.
Was sind die Vor- und Nachteile einer Mezzanine-Kapitalfinanzierung?
Die Arbeit beleuchtet die Vorteile und Nachteile von Mezzanine-Kapital für Unternehmen und Investoren. Es werden fundierte Argumente für die Wahl dieser Finanzierungsform in bestimmten Situationen geliefert und detaillierte Beispiele aus der Praxis vorgestellt.
Welche Anwendungsgebiete von Mezzanine-Kapital werden beschrieben?
Die Diplomarbeit enthält detaillierte Beispiele für die Anwendungsgebiete von Mezzanine-Kapital in der Praxis.
Wie werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und kritisch gewürdigt?
Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und bietet eine kritische Würdigung der unterschiedlichen Bilanzierungsmethoden nach HGB und IFRS für Mezzanine-Kapital.
- Quote paper
- Salvatore Rapisarda (Author), 2007, Die Bilanzierung von mezzaninem Kapital nach HGB und IFRS , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81606