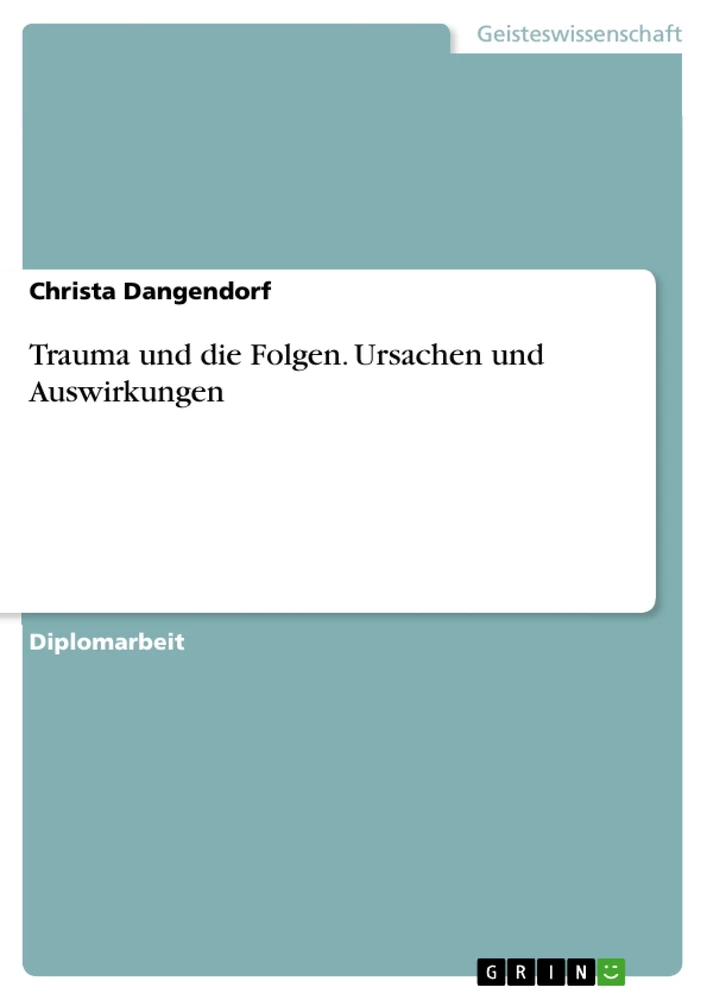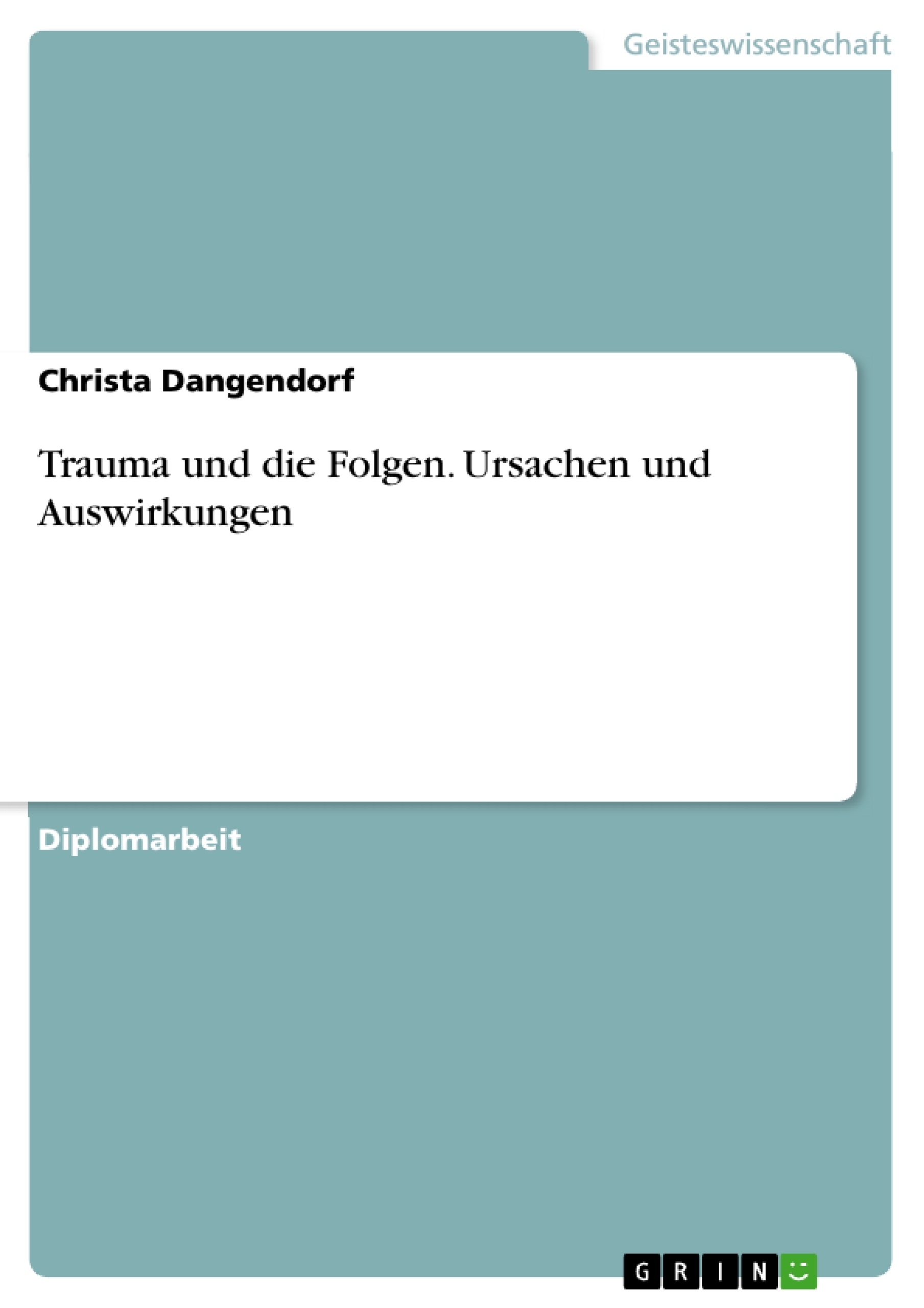Erschütternde Ereignisse wie der Terrorakt auf das World Trade Center in New York führen zu einem großen Mitgefühl und Engagement in der Bevölkerung, die wirklich schwerwiegenden finden jedoch unbeachtet von der Öffentlichkeit in Familien und nahen Beziehungsräumen statt. So zeigen Untersuchungen, dass nur wenige Betroffene des 11. September 2001, jedoch über die Hälfte nach einem sexuellen Mißbrauch ein Trauma entwickelten.
Welche individuellen und Ereignisbezogenen Faktoren schützen bzw. fördern die Entstehung eines Traumas? Wieso entwickelt nicht jeder Betroffene ein Trauma?
Welche Folgen können Traumata haben? Durch die Beantwortung dieser Fragen können Hilfen für die Betroffenen aufgebaut werden.
Eine große Bandbreite von bekannten und weniger bekannten Folgen für die Opfer werden in dieser Publikation dargestellt.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Betrachtung der Auswirkungen auf Partner und Kinder. Dabei wird vor allem beleuchtet, ob und wie Traumata an die nächste Generation weitergegeben werden. Desweiteren werden Auswirkungen auf eine Gesellschaft aufgezeigt. Dies ist besonders im Hinblick auf die weltweiten Krisengebiete interessant.
Zusammenhänge zwischen Traumata und den individuellen, familiären und gesellschaftlichen Folgen zu erkennen hilft neue Ansätze auch außerhalb des therapeutischen Settings zu entwickeln. Dazu ist gesellschaftliches und politisches Handeln erforderlich, diese Hilfen bereitzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung eines Traumas
- Auslösende Faktoren
- Zufällige Ereignisse
- Man-made-desaster
- Prävalenz eines Traumas
- Erleben eines Traumas
- Direkte Traumareaktion
- Traumatischer Prozess
- Auslösende Faktoren
- Risiko und Schutzfaktoren bei der Traumaentstehung
- Risikofaktoren
- Schutzfaktoren
- Neurobiologische Grundlagen
- Neuronale Netzwerke
- Hormonelle Stressreaktion
- Trauma und Gedächtnis
- Kurzfristige Folgen eines Traumas
- Anpassungsstörungen
- Akute Belastungsreaktion
- Langfristige Folgen eines Traumas
- Posttraumatische Belastungsstörung
- Klassifikationssysteme der PTBS
- Sonderformen nach extremer Traumatisierung
- Kritik der PTBS
- Komorbide Störungen
- Depressionen
- Angsterkrankungen
- Suchterkrankungen
- Dissoziative Störungen
- Somatoforme Störungen
- Posttraumatische Belastungsstörung
- Auswirkung auf sekundär Betroffene
- Beziehungsstörungen
- Transgenerationale Weitergabe
- Auswirkungen auf die Gesellschaft
- Therapie der PTBS
- Unterstützungsmöglichkeiten durch die soziale Arbeit
- Psychoedukation
- Angehörigenarbeit
- Krisenintervention
- Beratung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Entstehung, kurz- und langfristigen Folgen sowie die therapeutischen Ansätze bei psychischen Traumata. Das Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der komplexen Zusammenhänge zwischen Traumaerleben, neurobiologischen Prozessen und psychosozialen Auswirkungen zu entwickeln und daraus Handlungsempfehlungen für die soziale Arbeit abzuleiten.
- Entstehung und Auslöser von Traumata
- Neurobiologische Grundlagen der Traumaverarbeitung
- Kurz- und langfristige psychische Folgen von Traumata, einschließlich der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS)
- Auswirkungen auf das soziale Umfeld und sekundär Betroffene
- Therapeutische und sozialarbeiterische Interventionsmöglichkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Psychotraumatologie ein und beleuchtet die Aktualität der Thematik. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die zentralen Forschungsfragen.
Entstehung eines Traumas: Dieses Kapitel analysiert die Entstehung von Traumata, indem es auslösende Faktoren wie zufällige Ereignisse und vom Menschen verursachte Katastrophen (man-made-desaster) differenziert. Es beleuchtet die Prävalenz von Traumata in der Bevölkerung, beschreibt das subjektive Erleben eines Traumas und die unmittelbaren Reaktionen darauf. Der traumatischer Prozess und seine Dynamik werden detailliert dargestellt, unter Einbezug von Modellen und Abbildungen.
Risiko und Schutzfaktoren bei der Traumaentstehung: Dieses Kapitel untersucht die Faktoren, die die Vulnerabilität für eine Traumatisierung erhöhen oder verringern. Es differenziert zwischen Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit einer Traumatisierung erhöhen, und Schutzfaktoren, die diese verringern. Die Wechselwirkung zwischen individuellen und umweltbedingten Faktoren wird beleuchtet.
Neurobiologische Grundlagen: Hier werden die neurobiologischen Prozesse im Zusammenhang mit Traumaerleben und -verarbeitung erörtert. Der Fokus liegt auf neuronalen Netzwerken, der hormonellen Stressreaktion und den Auswirkungen auf das Gedächtnis. Es werden die komplexen neuronalen Mechanismen beschrieben, die zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Traumafolgen beitragen.
Kurzfristige Folgen eines Traumas: Dieses Kapitel behandelt die unmittelbaren Folgen von Traumata, darunter Anpassungsstörungen und akute Belastungsreaktionen. Die verschiedenen Symptome und deren Ausprägung werden beschrieben und in relation zu den vorangegangenen Kapiteln über die Entstehung und die neurobiologischen Grundlagen gesetzt. Es werden auch die diagnostischen Kriterien und Klassifizierungssysteme erläutert.
Langfristige Folgen eines Traumas: Dieser Abschnitt befasst sich ausführlich mit den langfristigen Folgen von Traumata, insbesondere mit der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Die Kapitel analysieren die Klassifikationssysteme der PTBS, besondere Formen nach extremer Traumatisierung und die Kritik an der PTBS-Diagnose. Darüber hinaus werden komorbide Störungen wie Depressionen, Angsterkrankungen, Sucht- und dissoziative Störungen sowie somatoforme Störungen im Kontext der PTBS umfassend behandelt.
Auswirkung auf sekundär Betroffene: Dieses Kapitel befasst sich mit den Folgen von Traumata für Angehörige und das soziale Umfeld der Betroffenen. Es analysiert die Auswirkungen auf Beziehungen, die transgenerationale Weitergabe von Traumafolgen und die gesellschaftlichen Implikationen. Die Komplexität der sekundären Traumatisierung und deren Folgen wird umfassend diskutiert.
Schlüsselwörter
Trauma, Psychotraumatologie, Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), Neurobiologie, Stressreaktion, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Komorbide Störungen, Soziale Arbeit, Therapie, sekundäre Traumatisierung, Transgenerationale Weitergabe.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Psychotraumatologie
Was ist der Inhalt dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Psychotraumatologie. Sie untersucht die Entstehung, die kurz- und langfristigen Folgen sowie die therapeutischen Ansätze bei psychischen Traumata. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Verständnis der komplexen Zusammenhänge zwischen Traumaerleben, neurobiologischen Prozessen und psychosozialen Auswirkungen, mit dem Ziel, Handlungsempfehlungen für die soziale Arbeit abzuleiten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die Entstehung und Auslöser von Traumata (zufällige Ereignisse, man-made-desaster), die neurobiologischen Grundlagen der Traumaverarbeitung (neuronale Netzwerke, hormonelle Stressreaktion, Gedächtnis), die kurz- und langfristigen psychischen Folgen von Traumata (einschließlich der Posttraumatischen Belastungsstörung - PTBS), die Auswirkungen auf das soziale Umfeld und sekundär Betroffene, sowie therapeutische und sozialarbeiterische Interventionsmöglichkeiten (Psychoedukation, Angehörigenarbeit, Krisenintervention, Beratung).
Welche Kapitel umfasst die Diplomarbeit?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Entstehung eines Traumas (Auslöser, Prävalenz, Erleben, Reaktion, Prozess), Risiko- und Schutzfaktoren, Neurobiologische Grundlagen, Kurzfristige Folgen (Anpassungsstörungen, akute Belastungsreaktion), Langfristige Folgen (PTBS, Komorbide Störungen, somatoforme Störungen), Auswirkungen auf sekundär Betroffene (Beziehungsstörungen, transgenerationale Weitergabe, gesellschaftliche Auswirkungen), Therapie der PTBS und Unterstützungsmöglichkeiten durch die soziale Arbeit.
Was sind die zentralen Forschungsfragen der Arbeit?
Die zentralen Forschungsfragen zielen darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Entstehung, der Auswirkungen und der Bewältigung von Traumata zu entwickeln. Konkret geht es um die Analyse der Auslöser, der neurobiologischen Mechanismen, der kurz- und langfristigen Folgen, der Auswirkungen auf das soziale Umfeld und die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die soziale Arbeit im Umgang mit traumatisierten Personen.
Wie wird die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) in der Arbeit behandelt?
Die PTBS wird ausführlich behandelt, einschließlich ihrer Klassifikationssysteme, besonderer Formen nach extremer Traumatisierung und Kritik an der Diagnose. Die Arbeit beleuchtet auch komorbide Störungen, die häufig mit der PTBS auftreten (Depressionen, Angsterkrankungen, Sucht- und dissoziative Störungen, somatoforme Störungen).
Welche Rolle spielt die soziale Arbeit in der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle der sozialen Arbeit in der Unterstützung von traumatisierten Personen und deren Angehörigen. Sie beleuchtet verschiedene Interventionsmöglichkeiten der sozialen Arbeit, wie Psychoedukation, Angehörigenarbeit, Krisenintervention und Beratung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Trauma, Psychotraumatologie, Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), Neurobiologie, Stressreaktion, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Komorbide Störungen, Soziale Arbeit, Therapie, sekundäre Traumatisierung, transgenerationale Weitergabe.
- Quote paper
- Diplom- Sozialpädagogin/ Diplom-Sozialarbeiterin Christa Dangendorf (Author), 2007, Trauma und die Folgen. Ursachen und Auswirkungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81590