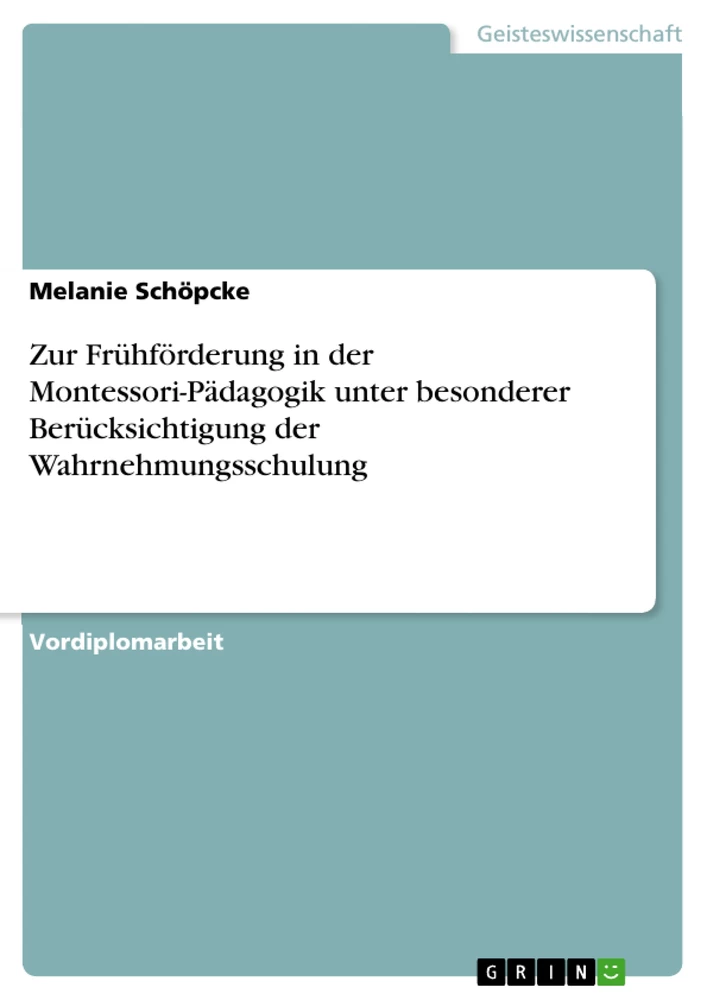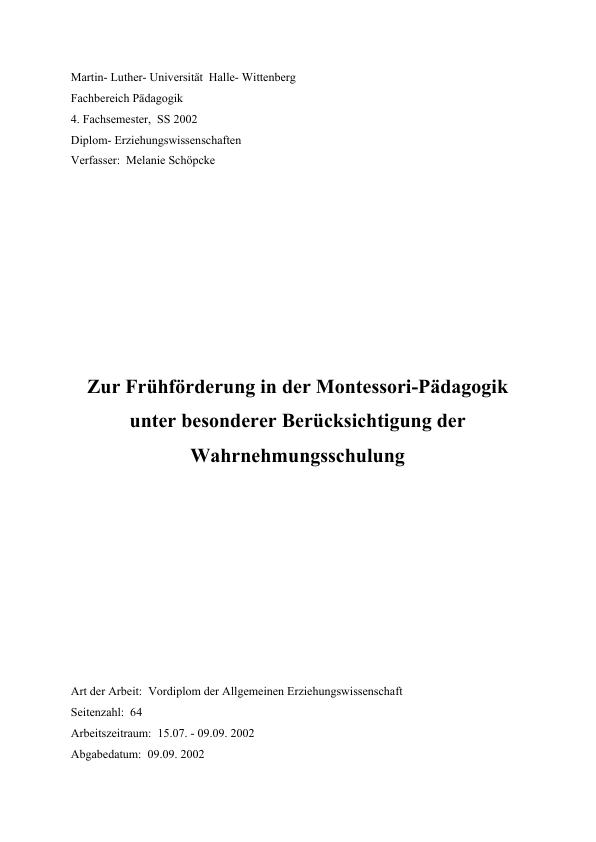Die Idee einen Bericht über die Pädagogik Maria Montessoris zu verfassen rührt aus einem mehrwöchigem Praktikum in einem Montessori- Kinderhaus. Dabei kam ich zum ersten Mal mit diesem Erziehungskonzept in Berührung, es faszinierte mich sehr. Die Gelegenheit zu einer tiefen Auseinandersetzung mit der Montessori- Pädagogik ergab sich während Suche nach einem geeigneten Thema zum Vordiplom.
Dieser Bericht beinhaltet die Bedingungen und Prinzipien einer Erziehung des Kleinkindes in der dafür vorgesehenen Einrichtung, dem Kinderhaus. Der erste Teil der Abhandlung erfolgt auf theoretischen Grundlagen. Der Begriff Früherziehung wird näher erklärt, daraufhin eine kurze Biographie Maria Montessoris erstellt und anschließend ein Überblick über grundlegende Inhalte und Positionen der Pädagogik gegeben. Spricht man von Montessori- Pädagogik, dann fällt häufig der Begriff: Entwicklungsmaterial. Tatsächlich nimmt dieses in der Methodik eine wichtige Stellung ein. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit kommt speziell der Wahrnehmungsschulung mit dem entsprechenden Sinnesmaterial besondere Bedeutung zu. Maria Montessori hat zusammen mit Friedrich Fröbel schon lange vor der modernen Kleinkindpädagogik, die pädagogische Bedeutung der Früherziehung, die Phase des Unbewußten für die Persönlichkeitsentwicklung und die nicht zu unterschätzende Rolle der Eltern/ Erzieher, insbesondere der Liebe und Zärtlichkeit für die Entwicklung von Selbst- und Wertvertrauen -Urvertrauen- erkannt. Ebenfalls bedeutsam war die Erkenntnis über die Bedeutung der frühen sensomotorischen Förderung, was bei Montessori aber eher theoretisch blieb. Sie selbst führte ihre pädagogischen Erfolge auf die Entdeckung der Polarisation der Aufmerksamkeit zurück, welches sie bei einem dreijährigen Kind entdeckt hatte. Durch intensives Beobachten entwickelte sie dann Bedingungen und Materialien, die Konzentration- und Bildungsfähigkeit ermöglichen und erleichtern. In jahrzehntelanger Arbeit entstand schließlich eine neue Pädagogik, eine neue Sicht des Kindes als konzentrationsfähiges, aktives Wesen, das seine Persönlichkeit selbst aufbaut, wenn es eine pädagogisch vorbereitete Umgebung und neuen Erzieher hat, der dem Kind hilft bei der Unabhängigkeit und der Entwicklung erforderlicher Kompetenzen (= Prozeß der "Normalisation").
Der zweite Teil dieser Arbeit geht auf die heutige Bedeutung der Montessori- Pädagogik ein - allgemeine Aussagen und Kritik sowie meine praktischen Erfahrungen fliessen hier ein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Früherziehung der Montessori-Pädagogik
- Anthropologische und pädagogische Grundlagen
- Was ist Frühförderung bzw. Früherziehung?
- Kurzbiographie Maria Montessoris
- "Normalisation" und "Deviation"
- Maria Montessoris Grundpositionen
- Der einheitliche Typus des Kindes
- Prinzipien der Pädagogik
- Vorbereitete Umgebung
- Arbeit und Freie Wahl
- Polarisation der Aufmerksamkeit
- Sensible Perioden
- Herkunft und Theorie
- Pädagogische Bedeutung
- Die Phase von 0-6 Jahren
- 0-3 Jahre
- 3-6 Jahre
- Wahrnehmungsschulung durch das Sinnesmaterial
- pädagogisch-didaktische Funktion
- Ästhetik
- Aktivität
- Begrenzung
- Fehlerkontrolle
- Lehrmittel zur Schulung der Wahrnehmung
- Entdecken von Kontrasten, Identitäten und Abstufungen
- Material visueller und auditiver Unterscheidungsmöglichkeiten
- Konkrete Sinnesübungen mit entsprechenden Materialien
- Tastsinn
- Sensibilität für Farben
- Unterscheidung von Dimensionen
- Der Sinn für Geräusche
- Barischer Sinn
- Temperatursinn
- Geruchssinn
- Geschmackssinn
- pädagogisch-didaktische Funktion
- Die Rolle des Erziehers
- Aufgaben des Erziehers
- Durchführung der Lektionen
- Anthropologische und pädagogische Grundlagen
- Die heutige Bedeutung der Montessori-Pädagogik
- Allgemeine Aussagen und Kritik
- Das Katholische Kinderhaus in Bautzen
- Der Alltag im Kinderhaus
- Das Sinnesmaterial
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Montessori-Pädagogik und ihrer Bedeutung für die Frühförderung, insbesondere im Bereich der Wahrnehmungsschulung. Die Autorin analysiert die anthropologischen und pädagogischen Grundlagen der Montessori-Pädagogik, beleuchtet die Rolle des Sinnesmaterials in der Wahrnehmungsschulung und untersucht die heutige Bedeutung der Montessori-Pädagogik.
- Die anthropologischen und pädagogischen Grundlagen der Montessori-Pädagogik
- Die Rolle des Sinnesmaterials in der Wahrnehmungsschulung
- Die Bedeutung der "sensiblen Perioden" in der Entwicklung
- Die Aufgaben und Rolle des Erziehers in der Montessori-Pädagogik
- Die heutige Relevanz der Montessori-Pädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Autorin stellt die Motivation für ihre Arbeit dar, die durch ein mehrwöchiges Praktikum in einem Montessori-Kinderhaus entstand. Sie skizziert den Aufbau des Berichts und die Bedeutung der Montessori-Pädagogik für die Entwicklung des Kindes.
- Früherziehung in der Montessori-Pädagogik: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Frühförderung/Früherziehung und stellt die wichtigsten pädagogischen Grundlagen der Montessori-Pädagogik vor. Es werden die "sensiblen Perioden" der Entwicklung und die Bedeutung des Sinnesmaterials für die Wahrnehmungsschulung behandelt.
- Die heutige Bedeutung der Montessori-Pädagogik: Dieses Kapitel beleuchtet die aktuelle Relevanz der Montessori-Pädagogik, diskutiert kritische Aspekte und gibt Einblicke in den Alltag eines Montessori-Kinderhauses.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt Themen wie Frühförderung, Montessori-Pädagogik, Sinnesmaterial, Wahrnehmungsschulung, "sensible Perioden", "Normalisation" und "Deviation", Kinderhaus, Erzieherrolle, Bildung und Entwicklung.
- Citar trabajo
- Diplom-Pädagogin Melanie Schöpcke (Autor), 2002, Zur Frühförderung in der Montessori-Pädagogik unter besonderer Berücksichtigung der Wahrnehmungsschulung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81501