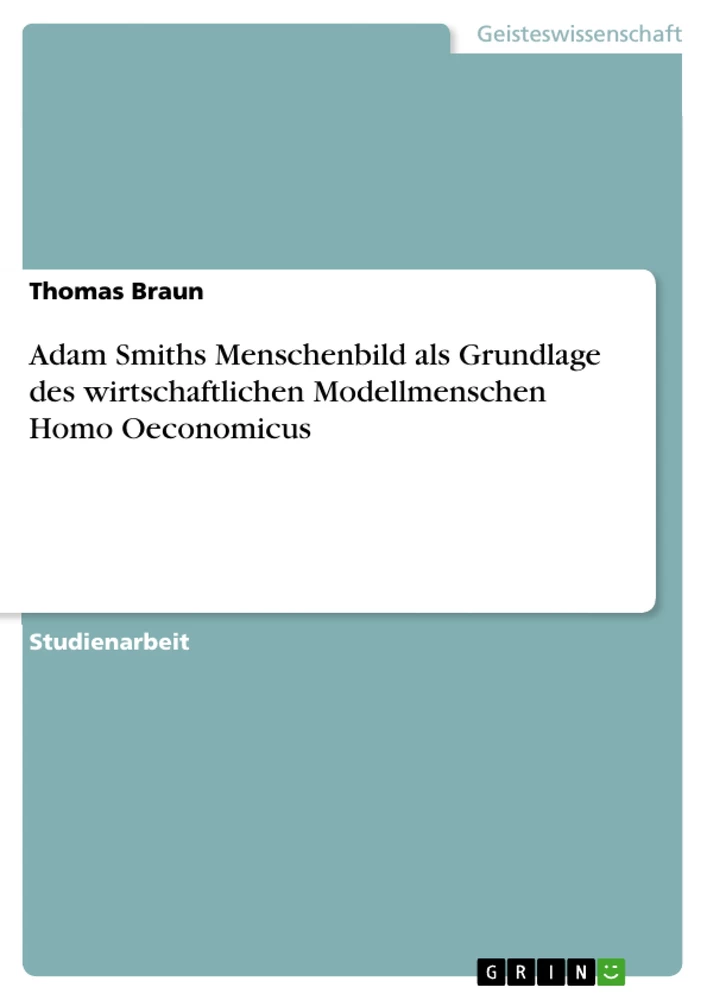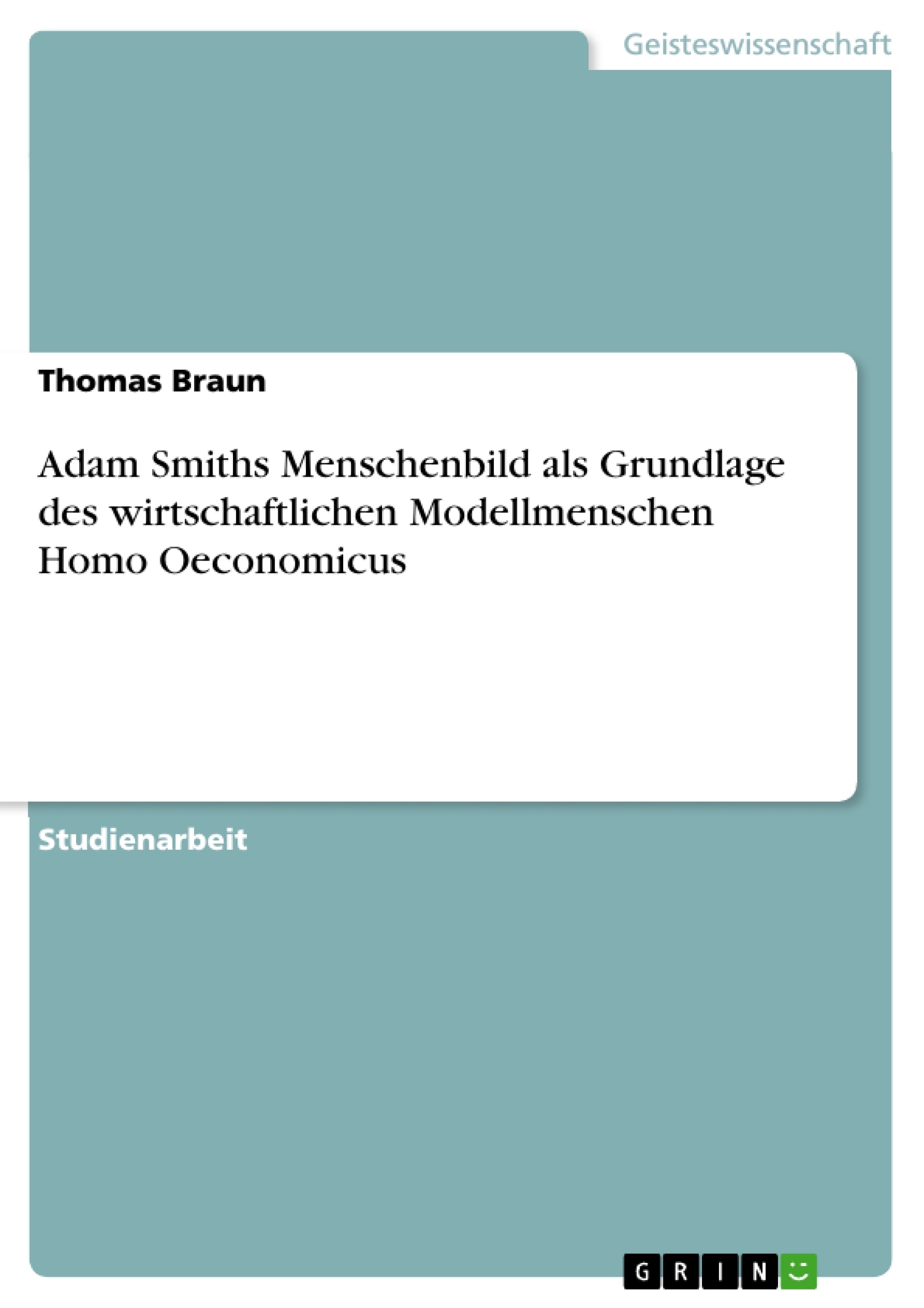Adam Smith (1723-1790) gilt als Begründer der klassischen Nationalökonomie. Mit seinem Hauptwerk „An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations“, welches 1776, im Jahr der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, erschien, legte er den Grundstein für die freie Marktwirtschaft. Smith behandelte in diesem Buch alle fundamentalen Aspekte der klassischen Wirtschaftstheorie, wie Arbeitsteilung, Marktgleichgewicht, die Rolle des Staates oder Eigeninteresse der handelnden Akteure, und wurde so zum Wegbereiter des Wirtschaftsliberalismus. Gerade der Gedanke des Eigennutzes stellt eine wichtige Vorrausetzung in den Überlegungen Smiths dar und ist gleichzeitig eine entscheidende Prämisse für das im Zuge der industriellen Revolution herausgebildete Menschenbild des homo oeconomicus.
In einem anderem wichtigen Werk, „Theory of Moral Sentiments“, das 1759 veröffentlicht wurde und eine moralphilosophische Arbeit darstellt, beschäftigt sich Smith mit „der menschlichen Natur und ihrer Eignung für ein Leben in der Gesellschaft“. Soziologen schätzen an der Publikation vor allem Smiths präzise empirische Beobachtungen. Allerdings ist in diesem Werk das Haupthandlungsmotiv des Menschen, mit anderen zu kooperieren, was nach Ansicht vieler Autoren im Widerspruch zu dem Menschenbild steht, welches Smiths ökonomischem Hauptwerk „Der Wohlstand der Nationen“ zugrunde liegt. „Alle diejenigen, die auch seine moralphilosophischen Anfänge zur Kenntnis genommen haben und das nationalökonomische Hauptwerk vor diesem Hintergrund zu lesen verstehen, versäumen es nie, auf die Aspekte aufmerksam zu machen, die einer solchen Propaganda des freien Marktes nicht nur nicht entsprechen, sondern ihr sogar widersprechen.“ In diesem Zusammenhang wird auch oft vom so genannten „Adam-Smith-Problem“ gesprochen, welches die Gegensätzlichkeit zwischen dem ökonomischem und dem sozialem Menschen Smiths beschreibt.
Das Verhaltenmodell Adam Smiths unterscheidet sich von den Modellannahmen des homo oeconomicus insofern, dass der Mensch bei ihm nicht von der Vernunft sondern von seinen Neigungen und Leidenschaften gelenkt ist. Andererseits verhalten sich auch bei Smith die Mehrheit der Akteure nach den Regeln des gesunden Menschenverstandes. Diese Regeln wiederum beschreibt er mit ökonomischer Rationalität.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Biographisches zu Adam Smith
- Das Modell des Homo Oeconomicus
- Historischer Ursprung
- Wesentliche Verhaltensannahmen des homo oeconomicus
- Adam Smiths Menschenbild
- Die Inkonsistenz seiner Hauptwerke - Das Adam Smith Problem
- Der Mensch als komplexes Wesen - Die Theoriebildung Adam Smiths
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Menschenbild von Adam Smith und dessen Vergleichbarkeit mit dem des Homo Oeconomicus. Ziel ist es, die wichtigsten Aspekte der Werke Smiths und die Grundkonzeption des Homo Oeconomicus darzustellen, um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen.
- Die Entstehung und Grundzüge des Homo Oeconomicus-Modells
- Das Adam-Smith-Problem: Die Diskrepanz zwischen Smiths moralphilosophischem Werk und seinem ökonomischen Hauptwerk
- Smiths multidimensionales Menschenbild: Soziales und wirtschaftliches Handeln sowie wirtschaftliches Handeln
- Die Rolle des Eigeninteresses und der Arbeitsteilung im Denken Smiths
- Smiths Sicht auf den Menschen als soziales Wesen im Kontext des wirtschaftlichen Handelns
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Adam Smith als Begründer der klassischen Nationalökonomie vor und beleuchtet die Bedeutung seines Werkes "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" für die freie Marktwirtschaft. Anschließend wird auf die Relevanz des Gedankens des Eigennutzes für Smiths Überlegungen und dessen Verbindung zum Homo Oeconomicus eingegangen. Das Kapitel behandelt auch das "Adam-Smith-Problem", welches die scheinbare Diskrepanz zwischen Smiths ökonomischem und moralphilosophischem Menschenbild aufzeigt.
Das zweite Kapitel widmet sich der Biographie Adam Smiths und stellt seinen Lebensweg im Kontext des schottischen Handels und Gewerbes im 18. Jahrhundert dar. Es beleuchtet Smiths akademische Ausbildung, seine Zeit an der Universität Glasgow sowie seine Begegnungen mit bedeutenden Persönlichkeiten der Zeit.
Im dritten Kapitel erfolgt eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Modell des Homo Oeconomicus, wobei die historischen Wurzeln und wesentlichen Verhaltensannahmen beleuchtet werden. Es werden wichtige Vertreter der klassischen Nationalökonomie wie Jean-Baptiste Say, David Ricardo, Thomas Robert Malthus und John Stuart Mill vorgestellt.
Das vierte Kapitel befasst sich eingehender mit Adam Smiths Menschenbild, indem es zunächst die Inkonsistenz zwischen seinen beiden Hauptwerken "Theory of Moral Sentiments" und "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" analysiert. Im Anschluss daran werden die Kernaussagen Smiths' über den Menschen als komplexes Wesen dargestellt, wobei die Bedeutung von Selbstinteresse, Arbeitsteilung und sozialem Handeln hervorgehoben werden.
Schlüsselwörter
Adam Smith, Homo Oeconomicus, klassisches Menschenbild, Eigennutz, Arbeitsteilung, "Theory of Moral Sentiments", "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations", Adam-Smith-Problem, Sozialität, Wirtschaftsethik, Rationalität, Neoklassik, Marginalismus, Sozialdarwinismus, Nutzenmaximierung, Anthropologie, Moralphilosophie, Politik, Gerechtigkeit, Ethik.
- Quote paper
- Thomas Braun (Author), 2007, Adam Smiths Menschenbild als Grundlage des wirtschaftlichen Modellmenschen Homo Oeconomicus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81347