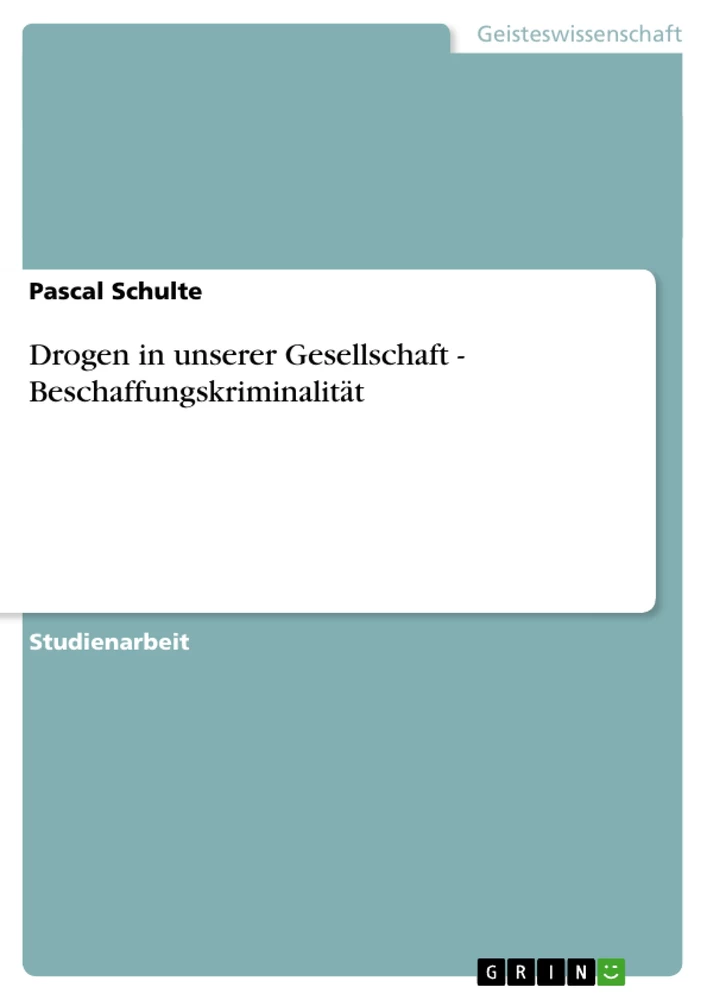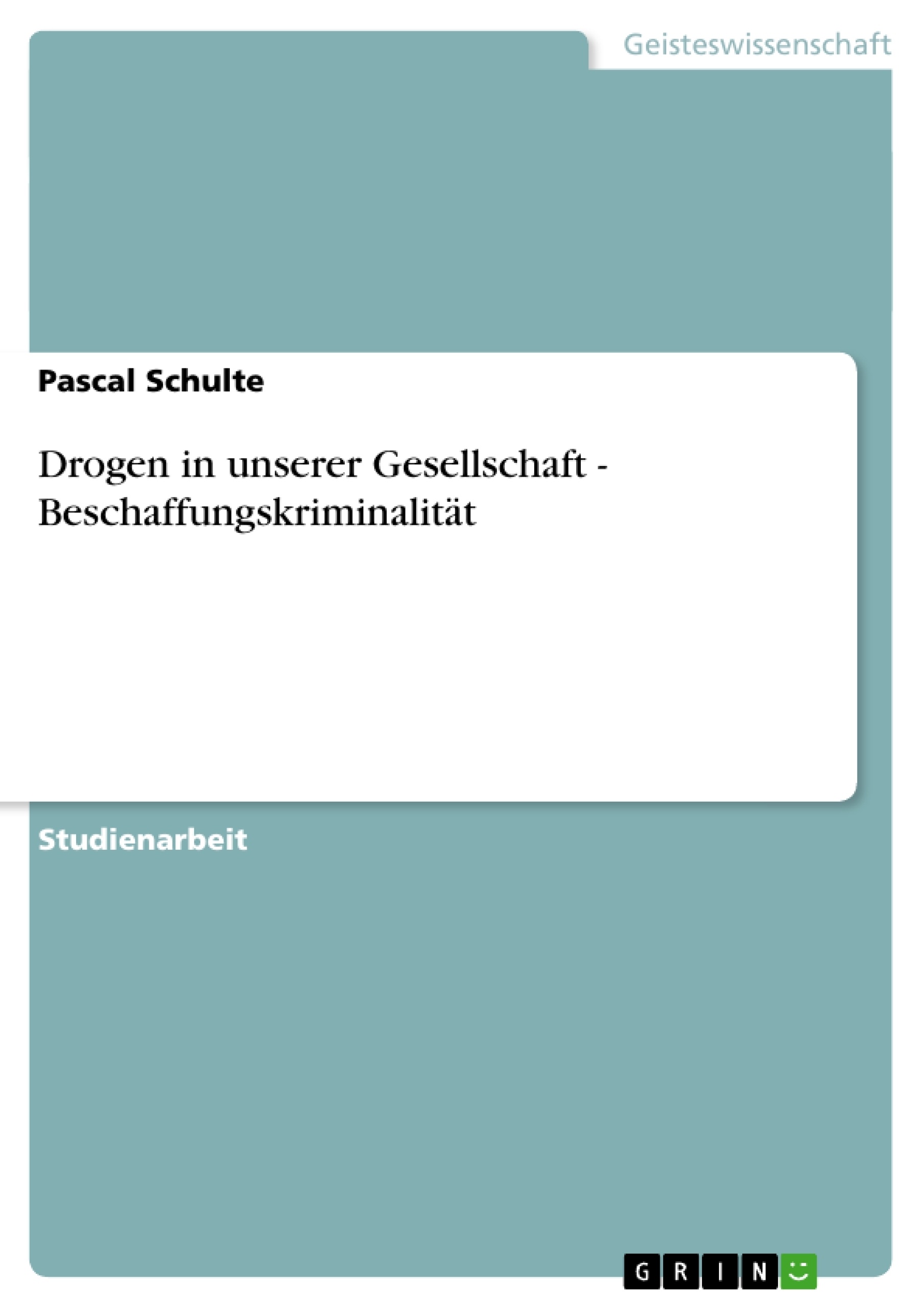Bubikopf, Charleston, boxende Frauen und androgyne Männer - die ‚Goldenen Zwanziger′ setzten neue Trends in Sachen Geschlechterrollen. Alte Moral- und Idealvorstellungen wurden über den Haufen geworfen, die Frauenbewegung erlebte ihren vorläufigen Höhepunkt, Homosexualität war vorübergehend Salonfähig. Und doch bereitete diese glamouröse, aber mit all ihrer Toleranz auch sehr orientierungslose Zeit nach Weltkrieg und Wirtschaftskrise den Boden für den aufkommenden Nationalsozialismus und einen Rückfall in alte Wertvorstellungen und Rollenstereotype.
Warum scheiterte diese - aus heutiger Sicht so fortschrittliche Gesellschaft? Existierte diese Bewegung überhaupt in dem Mass, wie wir es uns vorstellen oder war es vielmehr nur eine kleine intellektuelle Oberschicht einer Generation in den Hauptstädten Zentraleuropas, welche unser heutiges Bild der zwanziger Jahre prägt?
Um die Jahrhundertwende herrschte in den Grossstädten Europas eine Aufbruchstimmung. Die Frauenbewegungen erlebten ihre ersten Erfolge, Jugendbewegungen und Nudisten verzeichneten grossen Zulauf. Es sah so aus, als ob die Geschlechterstereotype durchbrochen würden; eine sanftere Männlichkeit und eine freie Frau wurden propagiert.
Der erste Weltkrieg jedoch, ein maskulines Ereignis par excellence, erstickte diesen Trend im Keim. Jetzt wurden wieder Männer gebraucht, die dem klassischen Stereotyp entsprachen: Stark, mutig, hart opferbereit, mit dem Drang, sich einer höheren, überindividuellen Sache in den Dienst zu stellen. Den Frauen ebnete der Krieg zwar - wenigstens vorübergehend - den Weg zu grösser Unabhängigkeit, Männer erlebten die Frauen im Krieg jedoch hauptsächlich in der gewohnt ‚passiven′ Rolle der Krankenschwester und Prostituierten.
Doch der Krieg löschte das Ideal der anderen, sanfteren Männlichkeit nicht ganz aus. Tatsächlich trat während der zwanziger Jahre ein alternatives Ideal der Männlichkeit für einen kurzen Augenblick den ungleichen Kampf gegen die traditionelle Männlichkeit an. Die Sozialisten hatten während des Ersten Weltkriegs versucht, eine friedlichere Form von Maskulinität zu propagieren, die auf Solidarität gründete, aber jene, die aus dem Krieg zurückkehrten, waren doch, so sehr sie das Gemetzel auf den Schlachtfeldern erschüttert haben mochte, der lebende Beweis für die Stärke des normativen Stereotyps.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Beschaffungskriminalität als Teilbereich der Drogenkriminalität
- Folgekriminalität
- Differenzierung der Versorgungskriminalität
- Ursachen der Beschaffungskriminalität
- verschiedene Typen der Beschaffungskriminalität
- direkte Beschaffungskriminalität
- indirekte Beschaffungskriminalität
- Probleme der Erkennbarkeit
- Aussagekraft der Polizeilichen Kriminalstatistik
- die „Gießener Studie“
- wirtschaftlicher Schaden
- Einfluss von Methadon-Programmen auf die Beschaffungskriminalität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Beschaffungskriminalität im Kontext des Drogenkonsums. Ziel ist es, ein umfassenderes Verständnis dieses Phänomens zu vermitteln, über gängige Missverständnisse aufzuklären und die Schwierigkeiten bei der Erfassung und Quantifizierung aufzuzeigen.
- Definition und Abgrenzung der Beschaffungskriminalität
- Ursachen und Auslöser der Beschaffungskriminalität
- verschiedene Formen und Typen der Beschaffungskriminalität
- Schwierigkeiten bei der Erfassung und statistischen Erfassung
- Der wirtschaftliche Schaden durch Beschaffungskriminalität
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort klärt einleitend wichtige Begrifflichkeiten und definiert den Rahmen der Arbeit. Es wird betont, dass der Begriff „Kriminalität“ nicht zwingend strafrechtlich relevantes Verhalten impliziert und Begriffe wie „Junkie“ oder „Stoff“ als allgemein verständlich vorausgesetzt werden. Der Fokus liegt auf der Abhängigkeit von illegalen harten Drogen.
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den persönlichen Hintergrund des Autors und seine anfängliche Annahme, das Thema Beschaffungskriminalität ausreichend zu kennen. Sie schildert die Schwierigkeiten bei der Informationsbeschaffung und die überraschende Erkenntnis, wie wenig über dieses Thema bekannt ist. Der Autor betont die Notwendigkeit, die Beschaffungskriminalität umfassender zu beleuchten.
Beschaffungskriminalität als Teilbereich der Drogenkriminalität: Dieses Kapitel positioniert die Beschaffungskriminalität als Teilbereich der Drogenkriminalität und differenziert verschiedene Kategorien innerhalb der Drogenkriminalität mittels eines Diagramms. Es wird kurz auf die Abgrenzung der verschiedenen Teilbereiche eingegangen, um den Kontext der Beschaffungskriminalität zu verdeutlichen.
Ursachen der Beschaffungskriminalität: (Kapitel fehlt im Ausgangstext, kann hier nur spekulativ ergänzt werden): Dieses Kapitel würde voraussichtlich die sozioökonomischen, psychischen und sozialen Faktoren erörtern, die zur Beschaffungskriminalität beitragen. Es könnte beispielsweise die Rolle von Armut, Arbeitslosigkeit, mangelnder sozialer Integration und die psychischen Folgen der Drogenabhängigkeit behandeln.
verschiedene Typen der Beschaffungskriminalität: (Kapitel fehlt im Ausgangstext, kann hier nur spekulativ ergänzt werden): Dieses Kapitel würde sich vermutlich mit der Unterscheidung zwischen direkter und indirekter Beschaffungskriminalität befassen. Direkte Delikte könnten Diebstähle und Raubüberfälle zur Finanzierung des Drogenkonsums umfassen, während indirekte Delikte Betrug, Prostitution oder andere Delikte zur Beschaffung von Geld beinhalten könnten.
Probleme der Erkennbarkeit: Dieses Kapitel würde die Schwierigkeiten bei der Erfassung von Beschaffungskriminalität analysieren. Es würde die Aussagekraft der Polizeilichen Kriminalstatistik hinterfragen und die „Gießener Studie“ als Beispiel für Forschungsansätze zur Erfassung des Problems diskutieren.
wirtschaftlicher Schaden: (Kapitel fehlt im Ausgangstext, kann hier nur spekulativ ergänzt werden): Dieses Kapitel würde sich mit den ökonomischen Folgen von Beschaffungskriminalität auseinandersetzen. Es könnte die Kosten für Strafverfolgung, Gesundheitswesen und soziale Leistungen betrachten sowie den Verlust von Arbeitsleistung und die Schäden an Eigentum einschließen.
Einfluss von Methadon-Programmen auf die Beschaffungskriminalität: (Kapitel fehlt im Ausgangstext, kann hier nur spekulativ ergänzt werden): Dieses Kapitel würde die Auswirkungen von Methadon-Programmen auf die Beschaffungskriminalität untersuchen und diskutieren, inwieweit diese Programme zur Reduktion der Kriminalität beitragen.
Schlüsselwörter
Beschaffungskriminalität, Drogenkriminalität, Drogenabhängigkeit, Kriminalstatistik, Methadonprogramme, soziale Ursachen, ökonomische Folgen, Forschungsmethoden, Präventionsstrategien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Beschaffungskriminalität
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Beschaffungskriminalität im Kontext des Drogenkonsums. Sie untersucht die Definition, Abgrenzung, Ursachen, Arten und Auswirkungen dieser Kriminalität, sowie die Schwierigkeiten bei ihrer Erfassung und Quantifizierung.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Definition und Abgrenzung der Beschaffungskriminalität, Ursachen und Auslöser, verschiedene Formen und Typen (direkte und indirekte Beschaffungskriminalität), Probleme der Erfassung und statistischen Erhebung (einschließlich der Kritik an der Polizeilichen Kriminalstatistik und der Erwähnung der „Gießener Studie“), der wirtschaftliche Schaden durch Beschaffungskriminalität und der Einfluss von Methadon-Programmen auf die Beschaffungskriminalität.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in ein Vorwort, eine Einleitung, Kapitel zur Beschaffungskriminalität als Teilbereich der Drogenkriminalität, zu den Ursachen, den verschiedenen Typen, den Problemen der Erkennbarkeit, dem wirtschaftlichen Schaden und dem Einfluss von Methadon-Programmen. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel kurz beschrieben. Ein Inhaltsverzeichnis und Schlüsselwörter erleichtern die Orientierung.
Welche Methoden werden zur Analyse verwendet?
Die Seminararbeit verwendet eine deskriptive und analytische Methode. Sie beschreibt das Phänomen der Beschaffungskriminalität, analysiert dessen Ursachen und Auswirkungen und diskutiert die Herausforderungen bei der Erfassung. Die „Gießener Studie“ wird als Beispiel für einen Forschungsansatz erwähnt.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert ein umfassenderes Verständnis der Beschaffungskriminalität, beleuchtet gängige Missverständnisse und zeigt die Schwierigkeiten bei der Erfassung und Quantifizierung auf. Die konkreten Ergebnisse der einzelnen Kapitel sind aufgrund der unvollständigen Textvorlage nur teilweise ersichtlich, einige Kapitel werden spekulativ ergänzt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Konkrete Schlussfolgerungen lassen sich aufgrund der unvollständigen Textvorlage nicht vollständig darstellen. Die Arbeit betont jedoch die Notwendigkeit, die Beschaffungskriminalität umfassender zu beleuchten und die Herausforderungen bei ihrer Erfassung zu berücksichtigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Beschaffungskriminalität, Drogenkriminalität, Drogenabhängigkeit, Kriminalstatistik, Methadonprogramme, soziale Ursachen, ökonomische Folgen, Forschungsmethoden, Präventionsstrategien.
Für wen ist diese Seminararbeit relevant?
Diese Seminararbeit ist relevant für alle, die sich akademisch mit dem Thema Drogenkriminalität, Beschaffungskriminalität, Suchtforschung und Kriminalprävention auseinandersetzen. Sie eignet sich für Studenten, Wissenschaftler und Fachkräfte im Bereich der Sozialarbeit, Kriminalistik und Suchthilfe.
- Quote paper
- Pascal Schulte (Author), 2002, Drogen in unserer Gesellschaft - Beschaffungskriminalität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8115