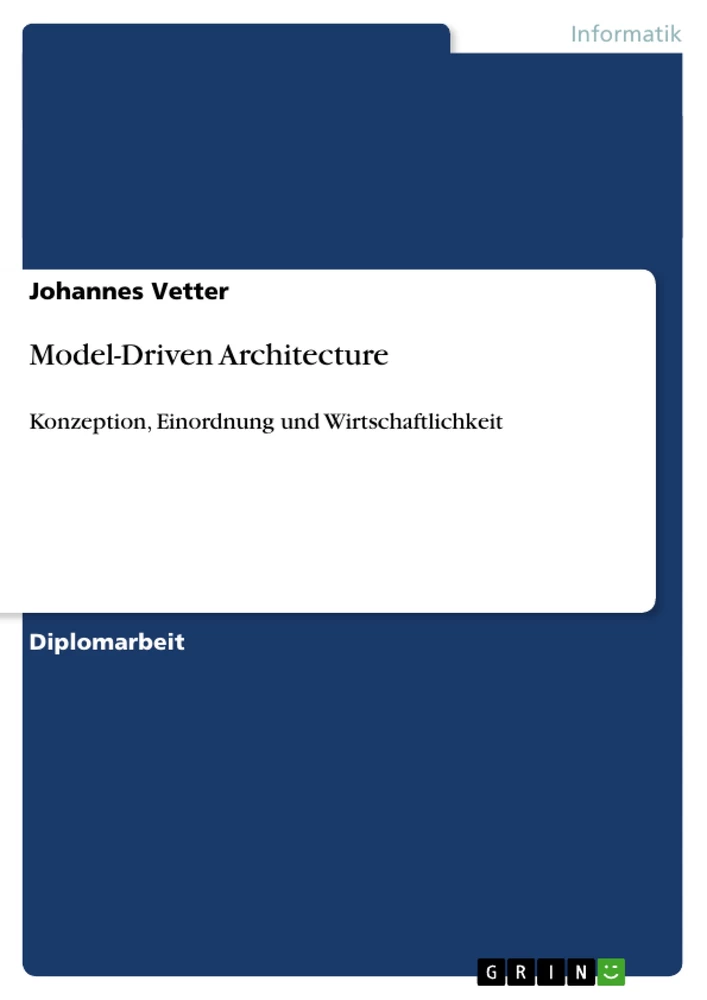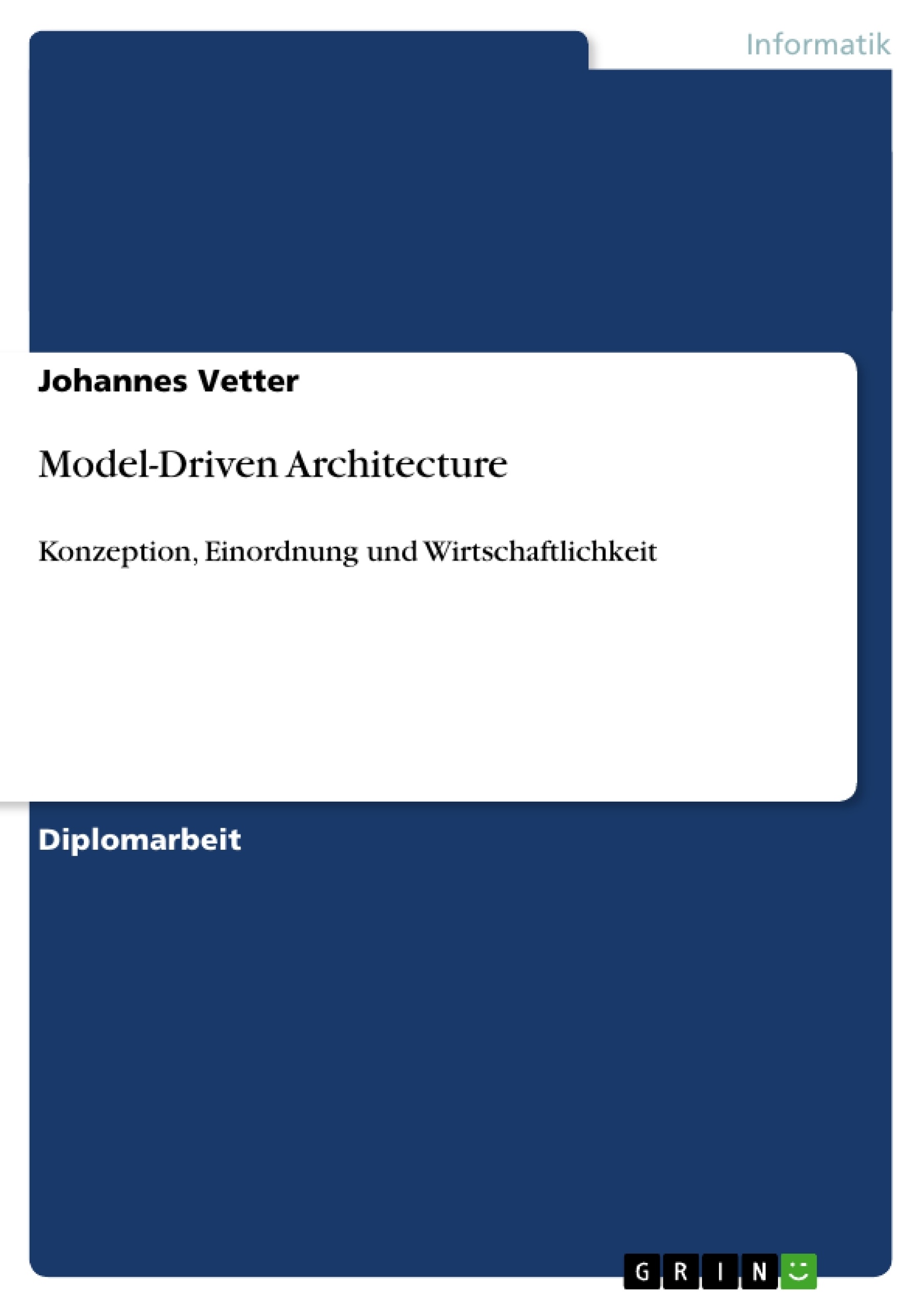Die Model-Driven Architecture (MDA) ist ein Standard der Object Management
Group (OMG), der in den vergangenen Jahren stark vorangetrieben
wurde. Die OMG verspricht sich, und vor allem den Anwendern der MDA eine
Effizienzsteigerung im Softwareentwicklungsprozess. Erreicht werden soll
diese Positiventwicklung durch unterschiedliche Ansätze, die von der MDA
verfolgt werden. Zum einen wird die Anhebung des Abstraktionsniveaus als
Treiber für eine schnellere Entwicklung propagiert. Das Abstraktionsniveau
soll von der momentan etablierten Codeebene auf die Ebene eines formalen
Modells angehoben werden. Für die Modellierung schlägt die OMG eigene
Standards vor, die schon länger Einsatz in der Softwareentwicklung finden.
Hierzu zählen beispielsweise die Unified Markup Language (UML) und die
Object Constraint Language (OCL). Des Weiteren verspricht die OMG eine
weitgehende Automatisierung der Codegenerierung aus den Modellen, die
während des Entwicklungsprozesses erstellt werden. Dies soll den Prozess
auf der einen Seite beschleunigen und auf der anderen Seite standardisieren,
um leichter anpassbaren Code zu bekommen. Zu guter Letzt ist ein gestecktes
Ziel der MDA die parallele Entwicklung eines Systems für unterschiedliche
Plattformen, wie .NET, J2EE oder CORBA. Dies soll durch die
technologie-, und plattformunabhängige Modellierung ermöglicht werden.
Diesen Zielen und Versprechen der OMG stehen die Realitäten der Informatik
sowie der Wirtschaft gegenüber. Daraus ergeben sich Forschungsbereiche,
die bisher unzureichend bedient wurden. Da die OMG nur das theoretische
Framework für die MDA, sowie die zu verwendenden Standards vorgibt,
ist die praktische Implementierung den Softwareunternehmen überlassen.
Nun stellt sich auf der einen Seite die Frage, ob die Beschreibungssprachen
der Informatik schon mächtig genug sind, um die Modellierung von Systemen
auf derart abstraktem Niveau durchzuführen und auf der anderen Seite, ob
die Unternehmen dazu bereit und in der Lage sind, MDA-Werkzeuge effektiv und effizient in ihren Softwareentwicklungsprozess zu integrieren, um die
gewünschten Erfolge zu erzielen. Die Problematik der Informatik wird in der
folgenden Arbeit nur vereinzelt mit einbezogen. Das Hauptaugenmerk liegt
vor allem auf der wirtschaftlichen Fragestellung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen der Model-Driven Architecture
- Definitionen
- Technischer Reifegrad der Model-Driven Architecture
- Konzepte
- Umsetzung
- Standards
- Einordnung und Einsatz der Model-Driven Architecture
- Einordnung der Model-Driven Architecture in die Historie der Softwareentwicklung
- Einsatz der Model-Driven Architecture
- Propagierte Ziele und Versprechen der Model-Driven Architecture
- Lösungsansätze für Probleme im Softwareentwicklungsprozess
- Potenzial der Model-Driven Architecture
- Wirtschaftlichkeitsaussagen zur Model-Driven Architecture
- Analyserahmen – Messung der Wirtschaftlichkeit in der Softwareentwicklung
- Untersuchungsansatz
- Problemeingrenzung: Gegenüberstellung der Model-Driven Architecture und des Computer-Aided Software Engineerings
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen des Computer-Aided Software Engineerings
- Erste Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen der Model-Driven Architecture
- Thesenbildung zur Model-Driven Architecture
- Untersuchung der Thesen zur Model-Driven Architecture
- Untersuchungsdesign
- Untersuchungsergebnisse
- Fazit und kritische Würdigung
- Zusammenfassung und Ausblick
- Zusammenfassung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Model-Driven Architecture (MDA) hinsichtlich ihrer Konzeption, Einordnung in den Softwareentwicklungsprozess und Wirtschaftlichkeit. Ziel ist es, die Vorteile und Herausforderungen der MDA im Vergleich zu etablierten Ansätzen aufzuzeigen und aussagekräftige Wirtschaftlichkeitsaussagen zu treffen.
- Konzeptionelle Grundlagen der Model-Driven Architecture
- Einordnung der MDA in die Softwareentwicklungsgeschichte und -praxis
- Wirtschaftlichkeitsanalyse der MDA im Vergleich zu anderen Ansätzen (z.B. Computer-Aided Software Engineering)
- Analyse der Auswirkungen auf den Softwareentwicklungsprozess (Kosten, Qualität, Zeitaufwand)
- Bewertung des Potenzials und der Grenzen der MDA
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Model-Driven Architecture ein und beschreibt die Motivation für die Arbeit sowie deren Aufbau und Zielsetzung. Sie skizziert den Rahmen der Untersuchung und die zu behandelnden Fragestellungen.
Grundlagen der Model-Driven Architecture: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Einführung in die Model-Driven Architecture. Es definiert zentrale Begriffe, beschreibt den technischen Reifegrad der MDA, ordnet sie in die Historie der Softwareentwicklung ein und beleuchtet ihren Einsatz in verschiedenen Kontexten. Die Diskussion der propagierten Ziele und Versprechen der MDA, einschließlich Lösungsansätzen für Probleme im Softwareentwicklungsprozess, bildet einen wichtigen Schwerpunkt dieses Kapitels. Es wird das Potenzial der MDA detailliert erörtert und mit existierenden Ansätzen verglichen.
Wirtschaftlichkeitsaussagen zur Model-Driven Architecture: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse der Wirtschaftlichkeit der MDA. Es etabliert zunächst einen Analyserahmen für die Messung der Wirtschaftlichkeit in der Softwareentwicklung und beschreibt den gewählten Untersuchungsansatz. Ein wichtiger Teil dieses Kapitels ist die Gegenüberstellung der MDA mit dem Computer-Aided Software Engineering (CASE), inklusive Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen für CASE. Die Kapitel schließt mit einer Thesenbildung zur Model-Driven Architecture ab, die im folgenden Kapitel empirisch untersucht wird.
Untersuchung der Thesen zur Model-Driven Architecture: Dieses Kapitel präsentiert die empirische Untersuchung der im vorherigen Kapitel formulierten Thesen zur Model-Driven Architecture. Es beschreibt das Untersuchungsdesign und präsentiert die gewonnenen Untersuchungsergebnisse. Eine kritische Würdigung der Ergebnisse und ein Fazit runden das Kapitel ab.
Schlüsselwörter
Model-Driven Architecture, Softwareentwicklung, Wirtschaftlichkeit, Computer-Aided Software Engineering (CASE), Modelltransformation, Softwarequalität, Kosten, Zeitaufwand, Potenzialanalyse, Empirische Untersuchung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Wirtschaftlichkeitsanalyse der Model-Driven Architecture
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Model-Driven Architecture (MDA) umfassend. Der Fokus liegt auf der Konzeption der MDA, ihrer Einordnung in den Softwareentwicklungsprozess und insbesondere auf ihrer Wirtschaftlichkeit. Ziel ist es, die Vor- und Nachteile der MDA im Vergleich zu etablierten Ansätzen aufzuzeigen und fundierte Aussagen zur Wirtschaftlichkeit zu treffen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt konzeptionelle Grundlagen der MDA, ihre Einordnung in die Geschichte und Praxis der Softwareentwicklung, eine Wirtschaftlichkeitsanalyse im Vergleich zu anderen Ansätzen (wie z.B. Computer-Aided Software Engineering - CASE), die Auswirkungen auf den Softwareentwicklungsprozess (Kosten, Qualität, Zeitaufwand), sowie eine Bewertung des Potenzials und der Grenzen der MDA.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Grundlagen der MDA, ein Kapitel zur Wirtschaftlichkeitsanalyse der MDA, ein Kapitel zur empirischen Untersuchung von aufgestellte Thesen und abschließend eine Zusammenfassung und einen Ausblick. Die Einleitung beschreibt die Motivation, den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Die Grundlagen der MDA umfassen Definitionen, den technischen Reifegrad, die Einordnung in die Softwareentwicklungsgeschichte und den Einsatz in verschiedenen Kontexten. Die Wirtschaftlichkeitsanalyse beinhaltet einen Analyserahmen, den Untersuchungsansatz (inkl. Vergleich mit CASE) und die Formulierung von Thesen. Das Kapitel zur Untersuchung der Thesen beschreibt das Untersuchungsdesign, präsentiert die Ergebnisse und bietet eine kritische Würdigung. Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet sowohl eine Literaturrecherche zur Erfassung der konzeptionellen Grundlagen und des Standes der Forschung als auch eine empirische Untersuchung zur Überprüfung aufgestellter Thesen zur Wirtschaftlichkeit der MDA. Ein expliziter Vergleich mit CASE-Ansätzen wird durchgeführt.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert Ergebnisse zu den konzeptionellen Grundlagen der MDA, zu ihrer Einordnung in die Softwareentwicklung, zu ihrer Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu CASE und zu den Auswirkungen auf den Softwareentwicklungsprozess. Die empirische Untersuchung liefert Daten, die die formulierten Thesen unterstützen oder widerlegen und zu einem fundierten Fazit führen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Model-Driven Architecture, Softwareentwicklung, Wirtschaftlichkeit, Computer-Aided Software Engineering (CASE), Modelltransformation, Softwarequalität, Kosten, Zeitaufwand, Potenzialanalyse, Empirische Untersuchung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Softwareentwickler, Projektleiter und alle, die sich mit der Model-Driven Architecture, Softwareentwicklungsprozessen und der Wirtschaftlichkeit von Softwareprojekten beschäftigen.
Wo finde ich den vollständigen Inhalt?
Der vollständige Inhalt der Diplomarbeit ist [hier den Link zum Dokument einfügen, falls verfügbar].
- Quote paper
- Johannes Vetter (Author), 2007, Model-Driven Architecture, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81137