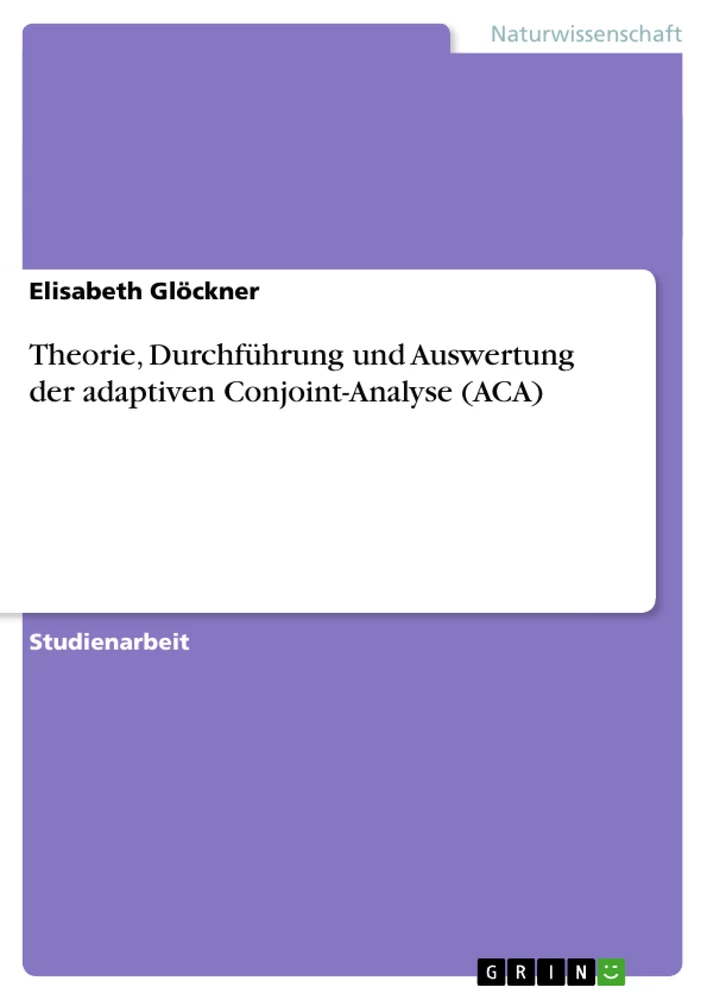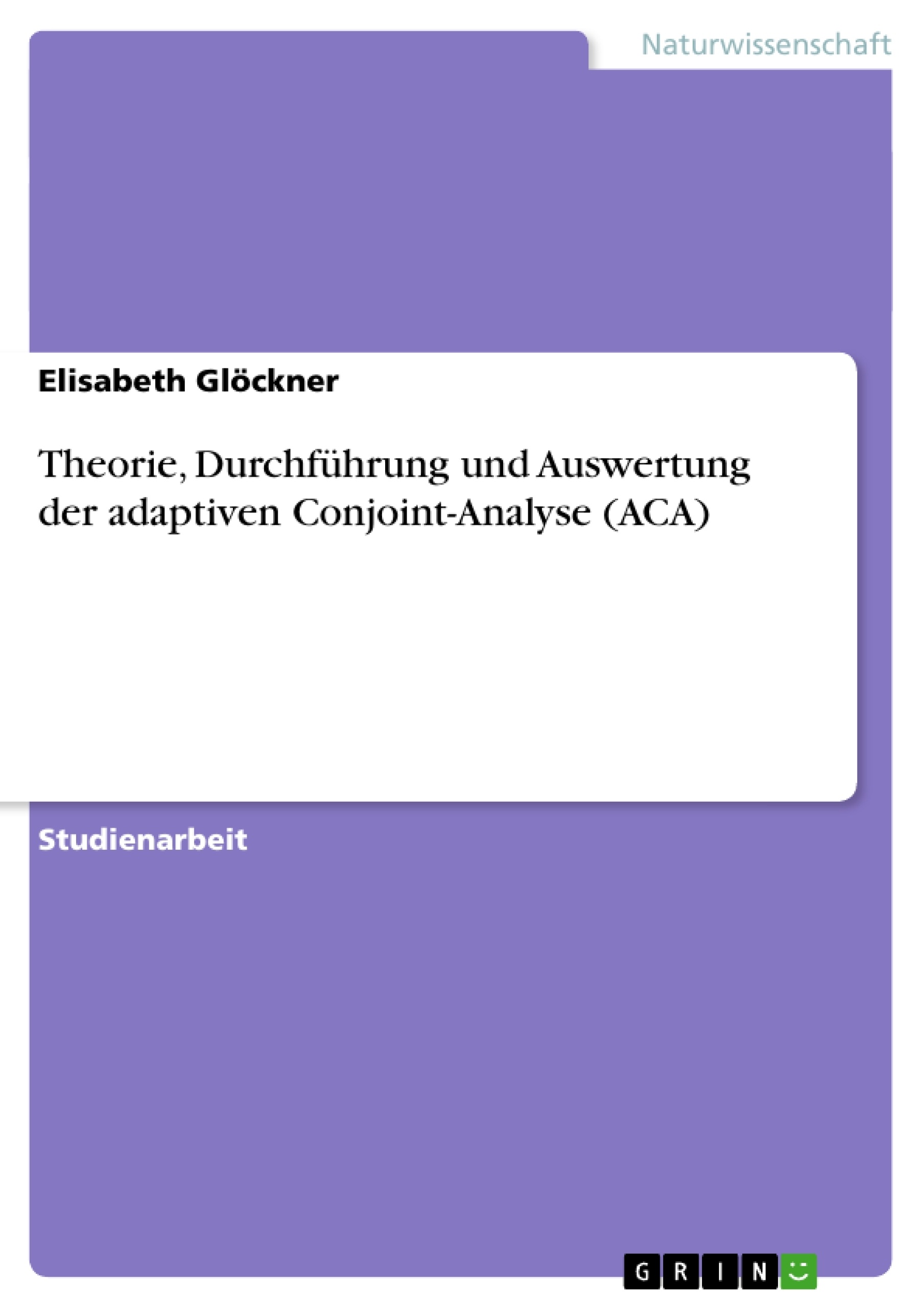Zunehmender Wettbewerbsdruck durch die Globalisierung und die damit verbundene Vielfalt an Produktvarianten verstärkt die Notwendigkeit der Unternehmen, sich den laufend ändernden Konsumpräferenzen anzupassen, um am Markt bestehen zu können. Dazu bedient man sich der CA, einem Instrument aus der Marktforschung, mit Hilfe dessen man die für den Kauf eines Produkts entscheidenden Kriterien selektiert. Die CA veranschaulicht die idealen Merkmalskombinationen eines Produkts, mit deren Hilfe sich die maximale Befriedigung der Kundenbedürfnisse und somit der größte Markterfolg eines Produkts erzielen lassen.
Neben der Marktforschung und der Neuproduktgestaltung wird die CA auch zur Preisbildung, zur Verbesserung bereits existierender Produkte, zur Marktsegmentierung und zu Imageanalysen eingesetzt.
Seit ihrer Einführung Anfang der Siebziger Jahre haben die CA und ihre verschiedenen Erscheinungsformen erheblich an Bedeutung gewonnen. Die einzelnen Verfahren ähneln sich in vielfacher Weise, weisen aber auch in gewissen Bereichen deutliche Unterschiede auf und bringen somit verschiedene Vor- und Nachteile mit sich. Heute bedient man sich unter anderem der ACA, einem neueren, weiterentwickelten Conjoint-Ansatz, bei dem sowohl die Datenerhebung als auch die Datenauswertung computergestützt erfolgt und sich die Befragung an den individuellen Präferenzen der Testpersonen (Probanden) orientiert. „Grundlage der ACA ist ein Softwareprogramm“ , mit Hilfe dessen die Datenerhebung und Auswertung automatisch erfolgt. Durch den Computer wird jede Befragung speziell auf die Bedürfnisse der einzelnen Probanden ausgerichtet, da der Ablauf der Befragung auf den bisher beantworteten Fragen aufbaut. Aufgrund ständiger Verbesserungen und die heutige Soft- und Hardware ließen sich die Kosten für den Einsatz der ACA in den letzten Jahren erheblich reduzieren. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Theorie, Durchführung und Auswertung der ACA, wobei ein Schwerpunkt auf die Durchführung gelegt wird. Abschließend werden die Vor- und Nachteile aufgezeigt und es wird die Frage geklärt, in welchen Situationen der Einsatz der ACA zu empfehlen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Zielsetzung der Conjoint-Analyse
- Der theoretische Hintergrund der Adaptiven Conjoint-Analyse
- Einordnung der ACA im Rahmen der Conjoint-Analyse
- Abgrenzung zu den klassischen Conjoint-Verfahren
- Durchführung der Adaptiven Conjoint-Analyse
- Vorbereitungen für die Durchführung
- Bestimmung der Merkmale und der Merkmalsausprägungen
- Elimination bestimmter Kombinationen von Merkmalsausprägungen
- Kurze Erklärung des Verfahrens für die Testpersonen
- Ablaufschritte der Adaptiven Conjoint-Analyse
- Ausschluss unakzeptabler Eigenschaftsausprägungen
- Präferenzordnung der Merkmalsausprägungen
- Ranking
- Rating
- Bestimmung der relativen Wichtigkeit der einzelnen Eigenschaften
- Paarvergleiche von Teilprofilen
- Kalibrierung der Produktkonzepte
- Vorbereitungen für die Durchführung
- Auswertung und Interpretation der Ergebnisse
- Analyse der Teilnutzenwerte sowie der Bedeutung der Merkmale
- Durchführung von Marktsimulationen und deren Interpretation
- Beurteilung der Adaptiven Conjoint-Analyse
- Vor- und Nachteile
- Einsatzgebiete der ACA
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Adaptiven Conjoint-Analyse (ACA) als einem Verfahren der Conjoint-Analyse. Sie erläutert die theoretischen Grundlagen der ACA, beschreibt die Durchführung des Verfahrens und interpretiert die gewonnenen Ergebnisse.
- Einordnung der ACA im Kontext der Conjoint-Analyse
- Abgrenzung der ACA zu klassischen Conjoint-Verfahren
- Durchführungsschritte der ACA, einschließlich Vorbereitungen und Ablauf
- Auswertung und Interpretation von Daten aus der ACA
- Bewertung der ACA hinsichtlich Vor- und Nachteilen sowie Einsatzgebieten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel dieser Arbeit führt in die Zielsetzung der Conjoint-Analyse ein. Das zweite Kapitel erläutert den theoretischen Hintergrund der Adaptiven Conjoint-Analyse (ACA), indem es die Einordnung der ACA im Rahmen der Conjoint-Analyse und die Abgrenzung zu den klassischen Conjoint-Verfahren behandelt. Das dritte Kapitel beschreibt die Durchführung der ACA, beginnend mit den Vorbereitungen wie der Bestimmung von Merkmalen und Merkmalsausprägungen, der Elimination von Kombinationen, und der Erklärung des Verfahrens für Testpersonen. Anschließend werden die einzelnen Ablaufschritte der ACA dargestellt, darunter der Ausschluss von unakzeptablen Ausprägungen, die Präferenzordnung von Merkmalsausprägungen durch Ranking und Rating, die Bestimmung der relativen Wichtigkeit von Eigenschaften, Paarvergleiche von Teilprofilen und die Kalibrierung der Produktkonzepte. Das vierte Kapitel widmet sich der Auswertung und Interpretation der Ergebnisse der ACA, wobei die Analyse der Teilnutzenwerte und die Bedeutung der Merkmale im Vordergrund stehen. Darüber hinaus werden Marktsimulationen und deren Interpretation betrachtet. Schließlich beurteilt das fünfte Kapitel die ACA hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile sowie ihrer Einsatzgebiete.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Adaptive Conjoint-Analyse (ACA) als ein Verfahren der Conjoint-Analyse. Wichtige Themen sind die Einordnung und Abgrenzung der ACA im Kontext der Conjoint-Analyse, die Durchführung des Verfahrens, die Auswertung und Interpretation der Ergebnisse sowie die Bewertung der ACA hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile und Einsatzgebiete.
- Citar trabajo
- Diplom-Kauffrau Elisabeth Glöckner (Autor), 2005, Theorie, Durchführung und Auswertung der adaptiven Conjoint-Analyse (ACA), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81104